Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
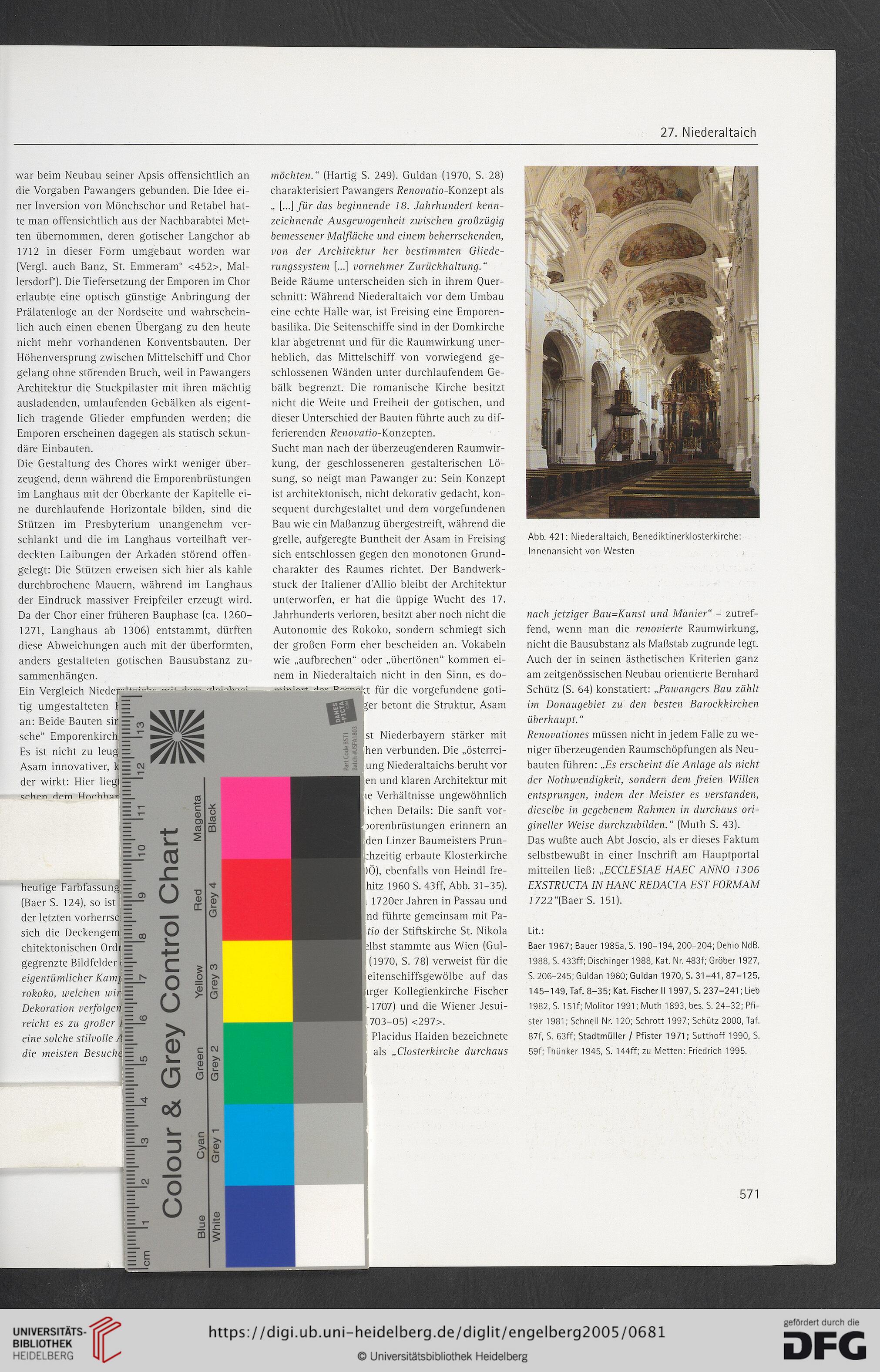
TI. Niederaltaich
war beim Neubau seiner Apsis offensichtlich an
die Vorgaben Pawangers gebunden. Die Idee ei-
ner Inversion von Mönchschor und Retabel hat-
te man offensichtlich aus der Nachbarabtei Met-
ten übernommen, deren gotischer Langchor ab
1712 in dieser Form umgebaut worden war
(Vergl. auch Banz, St. Emmeram0 <452>, Mal-
lersdorP). Die Tiefersetzung der Emporen im Chor
erlaubte eine optisch günstige Anbringung der
Prälatenloge an der Nordseite und wahrschein-
lich auch einen ebenen Übergang zu den heute
nicht mehr vorhandenen Konventsbauten. Der
Höhenversprung zwischen Mittelschiff und Chor
gelang ohne störenden Bruch, weil in Pawangers
Architektur die Stuckpilaster mit ihren mächtig
ausladenden, umlaufenden Gebälken als eigent-
lich tragende Glieder empfunden werden; die
Emporen erscheinen dagegen als statisch sekun-
däre Einbauten.
Die Gestaltung des Chores wirkt weniger über-
zeugend, denn während die Emporenbrüstungen
im Langhaus mit der Oberkante der Kapitelle ei-
ne durchlaufende Horizontale bilden, sind die
Stützen im Presbyterium unangenehm ver-
schlankt und die im Langhaus vorteilhaft ver-
deckten Laibungen der Arkaden störend offen-
gelegt: Die Stützen erweisen sich hier als kahle
durchbrochene Mauern, während im Langhaus
möchten.“ (Hartig S. 249). Guldan (1970, S. 28)
charakterisiert Pawangers Renowitio-Konzept als
„ [...] für das beginnende 18. Jahrhundert kenn-
zeichnende Ausgewogenheit zwischen großzügig
bemessener Malfläche und einem beherrschenden,
von der Architektur her bestimmten Gliede-
rungssystem [...] vornehmer Zurückhaltung.“
Beide Räume unterscheiden sich in ihrem Quer-
schnitt: Während Niederaltaich vor dem Umbau
eine echte Halle war, ist Freising eine Emporen-
basilika. Die Seitenschiffe sind in der Domkirche
klar abgetrennt und für die Raumwirkung uner-
heblich, das Mittelschiff von vorwiegend ge-
schlossenen Wänden unter durchlaufendem Ge-
bälk begrenzt. Die romanische Kirche besitzt
nicht die Weite und Freiheit der gotischen, und
dieser Unterschied der Bauten führte auch zu dif-
ferierenden Renovatio-Konzepten.
Sucht man nach der überzeugenderen Raumwir-
kung, der geschlosseneren gestalterischen Lö-
sung, so neigt man Pawanger zu: Sein Konzept
ist architektonisch, nicht dekorativ gedacht, kon-
sequent durchgestaltet und dem vorgefundenen
Bau wie ein Maßanzug übergestreift, während die
grelle, aufgeregte Buntheit der Asam in Freising
sich entschlossen gegen den monotonen Grund-
charakter des Raumes richtet. Der Bandwerk-
stuck der Italiener d’Allio bleibt der Architektur
Abb. 421: Niederaltaich, Benediktinerklosterkirche:
Innenansicht von Westen
der Eindruck massiver Freipfeiler erzeugt wird.
Da der Chor einer früheren Bauphase (ca. 1260-
1271, Langhaus ab 1306) entstammt, dürften
unterworfen, er hat die üppige Wucht des 17.
Jahrhunderts verloren, besitzt aber noch nicht die
Autonomie des Rokoko, sondern schmiegt sich
nach Jetziger Bau=Kunst und Manier“ - zutref-
fend, wenn man die renovierte Raumwirkung,
o
571
heutige Farbfassung
(Baer S. 124), so ist I
der letzten vorherrsc
sich die Deckengem
chitektonischen Ordi
gegrenzte Bildfelder i
eigentümlicher Kam],
rokoko, welchen wir,
Dekoration verfolgen
reicht es zu großer 1
eine solche stilvolle A
die meisten Besuche
Lit:
Baer 1967; Bauer 1985a, S. 190-194, 200-204; Dehio NdB.
1988, S. 433ff; Dischinger 1988, Kat. Nr. 483f; Gröber 1927,
S. 206-245; Guldan 1960; Guldan 1970, S. 31-41, 87-125,
145-149, Taf. 8-35; Kat. Fischer II 1997, S. 237-241; Lieb
1982, S. 151f; Molitor 1991; Muth 1893, bes. S. 24-32; Pfi-
ster 1981; Schnell Nr. 120; Schrott 1997; Schütz 2000, Taf.
87f, S. 63ff; Stadtmüller / Pfister 1971; Sutthoff 1990, S.
59f;Thünker 1945, S. 144ff; zu Metten: Friedrich 1995.
st Niederbayern stärker mit
hen verbunden. Die „österrei-
ung Niederaltaichs beruht vor
en und klaren Architektur mit
le Verhältnisse ungewöhnlich
ichen Details: Die sanft vor-
borenbrüstungen erinnern an
den Linzer Baumeisters Prun-
chzeitig erbaute Klosterkirche
)Ö), ebenfalls von Heindl fre-
hitz 1960 S. 43ff, Abb. 31-35).
i 1720er Jahren in Passau und
nd führte gemeinsam mit Pa-
tio der Stiftskirche St. Nikola
Gibst stammte aus Wien (Gul-
(1970, S. 78) verweist für die
kitenschiffsgewölbe auf das
Hrger Kollegienkirche Fischer
1-1707) und die Wiener Jesui-
703-05) <297>.
Placidus Haiden bezeichnete
als „Klosterkirche durchaus
diese Abweichungen auch mit der überformten,
anders gestalteten gotischen Bausubstanz Zu-
sammenhängen.
Ein Vergleich Nieder^
tig umgestalteten I
an: Beide Bauten sir
sehe“ Emporenkirch
Es ist nicht zu leug
Asam innovativer, k
der wirkt: Hier liegt
cehpn dpm Hncbhor
nicht die Bausubstanz als Maßstab zugrunde legt.
Auch der in seinen ästhetischen Kriterien ganz
am zeitgenössischen Neubau orientierte Bernhard
Schütz (S. 64) konstatiert: „Pawangers Bau zählt
im Donaugebiet zu den besten Barockkirchen
überhaupt.“
Renovationes müssen nicht in jedem Falle zu we-
niger überzeugenden Raumschöpfungen als Neu-
bauten führen: „Es erscheint die Anlage als nicht
der Nothwendigkeit, sondern dem freien Willen
entsprungen, indem der Meister es verstanden,
dieselbe in gegebenem Rahmen in durchaus ori-
gineller Weise durchzubilden.“ (Muth S. 43).
Das wußte auch Abt Joscio, als er dieses Faktum
selbstbewußt in einer Inschrift am Hauptportal
mitteilen ließ: „ECCLESIAE HAEC ANNO 1306
EXSTRUCTA IN HANG REDACTA EST FORMAM
1722 “(Baer S. 151).
der großen Form eher bescheiden an. Vokabeln
wie „aufbrechen“ oder „übertönen“ kommen ei-
nem in Niederaltaich nicht in den Sinn, es do-
'kt für die vorgefundene güti-
ger betont die Struktur, Asam
o
o
war beim Neubau seiner Apsis offensichtlich an
die Vorgaben Pawangers gebunden. Die Idee ei-
ner Inversion von Mönchschor und Retabel hat-
te man offensichtlich aus der Nachbarabtei Met-
ten übernommen, deren gotischer Langchor ab
1712 in dieser Form umgebaut worden war
(Vergl. auch Banz, St. Emmeram0 <452>, Mal-
lersdorP). Die Tiefersetzung der Emporen im Chor
erlaubte eine optisch günstige Anbringung der
Prälatenloge an der Nordseite und wahrschein-
lich auch einen ebenen Übergang zu den heute
nicht mehr vorhandenen Konventsbauten. Der
Höhenversprung zwischen Mittelschiff und Chor
gelang ohne störenden Bruch, weil in Pawangers
Architektur die Stuckpilaster mit ihren mächtig
ausladenden, umlaufenden Gebälken als eigent-
lich tragende Glieder empfunden werden; die
Emporen erscheinen dagegen als statisch sekun-
däre Einbauten.
Die Gestaltung des Chores wirkt weniger über-
zeugend, denn während die Emporenbrüstungen
im Langhaus mit der Oberkante der Kapitelle ei-
ne durchlaufende Horizontale bilden, sind die
Stützen im Presbyterium unangenehm ver-
schlankt und die im Langhaus vorteilhaft ver-
deckten Laibungen der Arkaden störend offen-
gelegt: Die Stützen erweisen sich hier als kahle
durchbrochene Mauern, während im Langhaus
möchten.“ (Hartig S. 249). Guldan (1970, S. 28)
charakterisiert Pawangers Renowitio-Konzept als
„ [...] für das beginnende 18. Jahrhundert kenn-
zeichnende Ausgewogenheit zwischen großzügig
bemessener Malfläche und einem beherrschenden,
von der Architektur her bestimmten Gliede-
rungssystem [...] vornehmer Zurückhaltung.“
Beide Räume unterscheiden sich in ihrem Quer-
schnitt: Während Niederaltaich vor dem Umbau
eine echte Halle war, ist Freising eine Emporen-
basilika. Die Seitenschiffe sind in der Domkirche
klar abgetrennt und für die Raumwirkung uner-
heblich, das Mittelschiff von vorwiegend ge-
schlossenen Wänden unter durchlaufendem Ge-
bälk begrenzt. Die romanische Kirche besitzt
nicht die Weite und Freiheit der gotischen, und
dieser Unterschied der Bauten führte auch zu dif-
ferierenden Renovatio-Konzepten.
Sucht man nach der überzeugenderen Raumwir-
kung, der geschlosseneren gestalterischen Lö-
sung, so neigt man Pawanger zu: Sein Konzept
ist architektonisch, nicht dekorativ gedacht, kon-
sequent durchgestaltet und dem vorgefundenen
Bau wie ein Maßanzug übergestreift, während die
grelle, aufgeregte Buntheit der Asam in Freising
sich entschlossen gegen den monotonen Grund-
charakter des Raumes richtet. Der Bandwerk-
stuck der Italiener d’Allio bleibt der Architektur
Abb. 421: Niederaltaich, Benediktinerklosterkirche:
Innenansicht von Westen
der Eindruck massiver Freipfeiler erzeugt wird.
Da der Chor einer früheren Bauphase (ca. 1260-
1271, Langhaus ab 1306) entstammt, dürften
unterworfen, er hat die üppige Wucht des 17.
Jahrhunderts verloren, besitzt aber noch nicht die
Autonomie des Rokoko, sondern schmiegt sich
nach Jetziger Bau=Kunst und Manier“ - zutref-
fend, wenn man die renovierte Raumwirkung,
o
571
heutige Farbfassung
(Baer S. 124), so ist I
der letzten vorherrsc
sich die Deckengem
chitektonischen Ordi
gegrenzte Bildfelder i
eigentümlicher Kam],
rokoko, welchen wir,
Dekoration verfolgen
reicht es zu großer 1
eine solche stilvolle A
die meisten Besuche
Lit:
Baer 1967; Bauer 1985a, S. 190-194, 200-204; Dehio NdB.
1988, S. 433ff; Dischinger 1988, Kat. Nr. 483f; Gröber 1927,
S. 206-245; Guldan 1960; Guldan 1970, S. 31-41, 87-125,
145-149, Taf. 8-35; Kat. Fischer II 1997, S. 237-241; Lieb
1982, S. 151f; Molitor 1991; Muth 1893, bes. S. 24-32; Pfi-
ster 1981; Schnell Nr. 120; Schrott 1997; Schütz 2000, Taf.
87f, S. 63ff; Stadtmüller / Pfister 1971; Sutthoff 1990, S.
59f;Thünker 1945, S. 144ff; zu Metten: Friedrich 1995.
st Niederbayern stärker mit
hen verbunden. Die „österrei-
ung Niederaltaichs beruht vor
en und klaren Architektur mit
le Verhältnisse ungewöhnlich
ichen Details: Die sanft vor-
borenbrüstungen erinnern an
den Linzer Baumeisters Prun-
chzeitig erbaute Klosterkirche
)Ö), ebenfalls von Heindl fre-
hitz 1960 S. 43ff, Abb. 31-35).
i 1720er Jahren in Passau und
nd führte gemeinsam mit Pa-
tio der Stiftskirche St. Nikola
Gibst stammte aus Wien (Gul-
(1970, S. 78) verweist für die
kitenschiffsgewölbe auf das
Hrger Kollegienkirche Fischer
1-1707) und die Wiener Jesui-
703-05) <297>.
Placidus Haiden bezeichnete
als „Klosterkirche durchaus
diese Abweichungen auch mit der überformten,
anders gestalteten gotischen Bausubstanz Zu-
sammenhängen.
Ein Vergleich Nieder^
tig umgestalteten I
an: Beide Bauten sir
sehe“ Emporenkirch
Es ist nicht zu leug
Asam innovativer, k
der wirkt: Hier liegt
cehpn dpm Hncbhor
nicht die Bausubstanz als Maßstab zugrunde legt.
Auch der in seinen ästhetischen Kriterien ganz
am zeitgenössischen Neubau orientierte Bernhard
Schütz (S. 64) konstatiert: „Pawangers Bau zählt
im Donaugebiet zu den besten Barockkirchen
überhaupt.“
Renovationes müssen nicht in jedem Falle zu we-
niger überzeugenden Raumschöpfungen als Neu-
bauten führen: „Es erscheint die Anlage als nicht
der Nothwendigkeit, sondern dem freien Willen
entsprungen, indem der Meister es verstanden,
dieselbe in gegebenem Rahmen in durchaus ori-
gineller Weise durchzubilden.“ (Muth S. 43).
Das wußte auch Abt Joscio, als er dieses Faktum
selbstbewußt in einer Inschrift am Hauptportal
mitteilen ließ: „ECCLESIAE HAEC ANNO 1306
EXSTRUCTA IN HANG REDACTA EST FORMAM
1722 “(Baer S. 151).
der großen Form eher bescheiden an. Vokabeln
wie „aufbrechen“ oder „übertönen“ kommen ei-
nem in Niederaltaich nicht in den Sinn, es do-
'kt für die vorgefundene güti-
ger betont die Struktur, Asam
o
o



