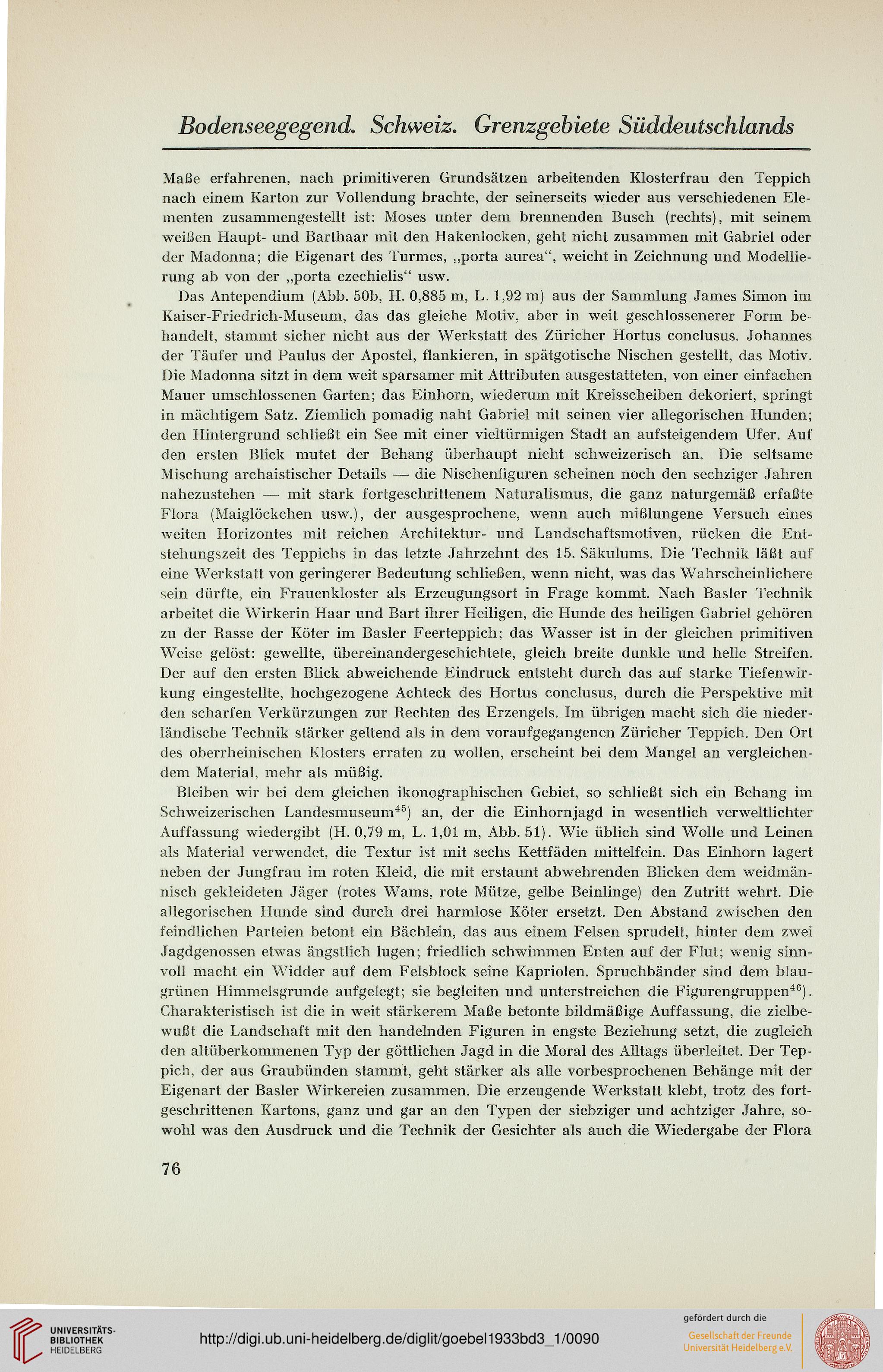Bodenseegegend. Schweiz. Grenzgebiete Süddeutschlands
Maße erfahrenen, nach primitiveren Grundsätzen arbeitenden Klosterfrau den Teppich
nach einem Karton zur Vollendung brachte, der seinerseits wieder aus verschiedenen Ele-
menten zusammengestellt ist: Moses unter dem brennenden Busch (rechts), mit seinem
weißen Haupt- und Barthaar mit den Hakenlocken, geht nicht zusammen mit Gabriel oder
der Madonna; die Eigenart des Turmes, ,,porta aurea", weicht in Zeichnung und Modellie-
rung ab von der „porta ezechielis" usw.
Das Antependium (Abb. 50b, H. 0,885 m, L. 1,92 m) aus der Sammlung James Simon im
Kaiser-Friedrich-Museum, das das gleiche Motiv, aber in weit geschlossenerer Form be-
handelt, stammt sicher nicht aus der Werkstatt des Züricher Hortus conclusus. Johannes
der Täufer und Paulus der Apostel, flankieren, in spätgotische Nischen gestellt, das Motiv.
Die Madonna sitzt in dem weit sparsamer mit Attributen ausgestatteten, von einer einfachen
Mauer umschlossenen Garten; das Einhorn, wiederum mit Kreisscheiben dekoriert, springt
in mächtigem Satz. Ziemlich pomadig naht Gabriel mit seinen vier allegorischen Hunden;
den Hintergrund schließt ein See mit einer vieltürmigen Stadt an aufsteigendem Ufer. Auf
den ersten Blick mutet der Behang überhaupt nicht schweizerisch an. Die seltsame
Mischung archaistischer Details — die Nischenfiguren scheinen noch den sechziger Jahren
nahezustehen — mit stark fortgeschrittenem Naturalismus, die ganz naturgemäß erfaßte
Flora (Maiglöckchen usw.), der ausgesprochene, wenn auch mißlungene Versuch eines
weiten Horizontes mit reichen Architektur- und Landschaftsmotiven, rücken die Ent-
stehungszeit des Teppichs in das letzte Jahrzehnt des 15. Säkulums. Die Technik läßt auf
eine Werkstatt von geringerer Bedeutung schließen, wenn nicht, was das Wahrscheinlichere
sein dürfte, ein Frauenkloster als Erzeugungsort in Frage kommt. Nach Basler Technik
arbeitet die Wirkerin Haar und Bart ihrer Heiligen, die Hunde des heiligen Gabriel gehören
zu der Rasse der Köter im Basler Feerteppich; das Wasser ist in der gleichen primitiven
Weise gelöst: gewellte, übereinandergeschichtete, gleich breite dunkle und helle Streifen.
Der auf den ersten Blick abweichende Eindruck entsteht durch das auf starke Tiefenwir-
kung eingestellte, hochgezogene Achteck des Hortus conclusus, durch die Perspektive mit
den scharfen Verkürzungen zur Rechten des Erzengels. Im übrigen macht sich die nieder-
ländische Technik stärker geltend als in dem voraufgegangenen Züricher Teppich. Den Ort
des oberrheinischen Klosters erraten zu wollen, erscheint bei dem Mangel an vergleichen-
dem Material, mehr als müßig.
Bleiben wir bei dem gleichen ikonographischen Gebiet, so schließt sich ein Behang im
Schweizerischen Landesmuseum45) an, der die Einhornjagd in wesentlich verweltlichter
Auffassung wiedergibt (H. 0,79 m, L. 1,01 m, Abb. 51). Wie üblich sind Wolle und Leinen
als Material verwendet, die Textur ist mit sechs Kettfäden mittelfein. Das Einhorn lagert
neben der Jungfrau im roten Kleid, die mit erstaunt abwehrenden Blicken dem weidmän-
nisch gekleideten Jäger (rotes Wams, rote Mütze, gelbe Beinlinge) den Zutritt wehrt. Die
allegorischen Hunde sind durch drei harmlose Köter ersetzt. Den Abstand zwischen den
feindlichen Parteien betont ein Bächlein, das aus einem Felsen sprudelt, hinter dem zwei
Jagdgenossen etwas ängstlich lugen; friedlich schwimmen Enten auf der Flut; wenig sinn-
voll macht ein Widder auf dem Felsblock seine Kapriolen. Spruchbänder sind dem blau-
grünen Himmelsgrunde aufgelegt; sie begleiten und unterstreichen die Figurengruppen46).
Charakteristisch ist die in weit stärkerem Maße betonte bildmäßige Auffassung, die zielbe-
wußt die Landschaft mit den handelnden Figuren in engste Beziehung setzt, die zugleich
den altüberkommenen Typ der göttlichen Jagd in die Moral des Alltags überleitet. Der Tep-
pich, der aus Graubünden stammt, geht stärker als alle vorbesprochenen Behänge mit der
Eigenart der Basler Wirkereien zusammen. Die erzeugende Werkstatt klebt, trotz des fort-
geschrittenen Kartons, ganz und gar an den Typen der siebziger und achtziger Jahre, so-
wohl was den Ausdruck und die Technik der Gesichter als auch die Wiedergabe der Flora
76
Maße erfahrenen, nach primitiveren Grundsätzen arbeitenden Klosterfrau den Teppich
nach einem Karton zur Vollendung brachte, der seinerseits wieder aus verschiedenen Ele-
menten zusammengestellt ist: Moses unter dem brennenden Busch (rechts), mit seinem
weißen Haupt- und Barthaar mit den Hakenlocken, geht nicht zusammen mit Gabriel oder
der Madonna; die Eigenart des Turmes, ,,porta aurea", weicht in Zeichnung und Modellie-
rung ab von der „porta ezechielis" usw.
Das Antependium (Abb. 50b, H. 0,885 m, L. 1,92 m) aus der Sammlung James Simon im
Kaiser-Friedrich-Museum, das das gleiche Motiv, aber in weit geschlossenerer Form be-
handelt, stammt sicher nicht aus der Werkstatt des Züricher Hortus conclusus. Johannes
der Täufer und Paulus der Apostel, flankieren, in spätgotische Nischen gestellt, das Motiv.
Die Madonna sitzt in dem weit sparsamer mit Attributen ausgestatteten, von einer einfachen
Mauer umschlossenen Garten; das Einhorn, wiederum mit Kreisscheiben dekoriert, springt
in mächtigem Satz. Ziemlich pomadig naht Gabriel mit seinen vier allegorischen Hunden;
den Hintergrund schließt ein See mit einer vieltürmigen Stadt an aufsteigendem Ufer. Auf
den ersten Blick mutet der Behang überhaupt nicht schweizerisch an. Die seltsame
Mischung archaistischer Details — die Nischenfiguren scheinen noch den sechziger Jahren
nahezustehen — mit stark fortgeschrittenem Naturalismus, die ganz naturgemäß erfaßte
Flora (Maiglöckchen usw.), der ausgesprochene, wenn auch mißlungene Versuch eines
weiten Horizontes mit reichen Architektur- und Landschaftsmotiven, rücken die Ent-
stehungszeit des Teppichs in das letzte Jahrzehnt des 15. Säkulums. Die Technik läßt auf
eine Werkstatt von geringerer Bedeutung schließen, wenn nicht, was das Wahrscheinlichere
sein dürfte, ein Frauenkloster als Erzeugungsort in Frage kommt. Nach Basler Technik
arbeitet die Wirkerin Haar und Bart ihrer Heiligen, die Hunde des heiligen Gabriel gehören
zu der Rasse der Köter im Basler Feerteppich; das Wasser ist in der gleichen primitiven
Weise gelöst: gewellte, übereinandergeschichtete, gleich breite dunkle und helle Streifen.
Der auf den ersten Blick abweichende Eindruck entsteht durch das auf starke Tiefenwir-
kung eingestellte, hochgezogene Achteck des Hortus conclusus, durch die Perspektive mit
den scharfen Verkürzungen zur Rechten des Erzengels. Im übrigen macht sich die nieder-
ländische Technik stärker geltend als in dem voraufgegangenen Züricher Teppich. Den Ort
des oberrheinischen Klosters erraten zu wollen, erscheint bei dem Mangel an vergleichen-
dem Material, mehr als müßig.
Bleiben wir bei dem gleichen ikonographischen Gebiet, so schließt sich ein Behang im
Schweizerischen Landesmuseum45) an, der die Einhornjagd in wesentlich verweltlichter
Auffassung wiedergibt (H. 0,79 m, L. 1,01 m, Abb. 51). Wie üblich sind Wolle und Leinen
als Material verwendet, die Textur ist mit sechs Kettfäden mittelfein. Das Einhorn lagert
neben der Jungfrau im roten Kleid, die mit erstaunt abwehrenden Blicken dem weidmän-
nisch gekleideten Jäger (rotes Wams, rote Mütze, gelbe Beinlinge) den Zutritt wehrt. Die
allegorischen Hunde sind durch drei harmlose Köter ersetzt. Den Abstand zwischen den
feindlichen Parteien betont ein Bächlein, das aus einem Felsen sprudelt, hinter dem zwei
Jagdgenossen etwas ängstlich lugen; friedlich schwimmen Enten auf der Flut; wenig sinn-
voll macht ein Widder auf dem Felsblock seine Kapriolen. Spruchbänder sind dem blau-
grünen Himmelsgrunde aufgelegt; sie begleiten und unterstreichen die Figurengruppen46).
Charakteristisch ist die in weit stärkerem Maße betonte bildmäßige Auffassung, die zielbe-
wußt die Landschaft mit den handelnden Figuren in engste Beziehung setzt, die zugleich
den altüberkommenen Typ der göttlichen Jagd in die Moral des Alltags überleitet. Der Tep-
pich, der aus Graubünden stammt, geht stärker als alle vorbesprochenen Behänge mit der
Eigenart der Basler Wirkereien zusammen. Die erzeugende Werkstatt klebt, trotz des fort-
geschrittenen Kartons, ganz und gar an den Typen der siebziger und achtziger Jahre, so-
wohl was den Ausdruck und die Technik der Gesichter als auch die Wiedergabe der Flora
76