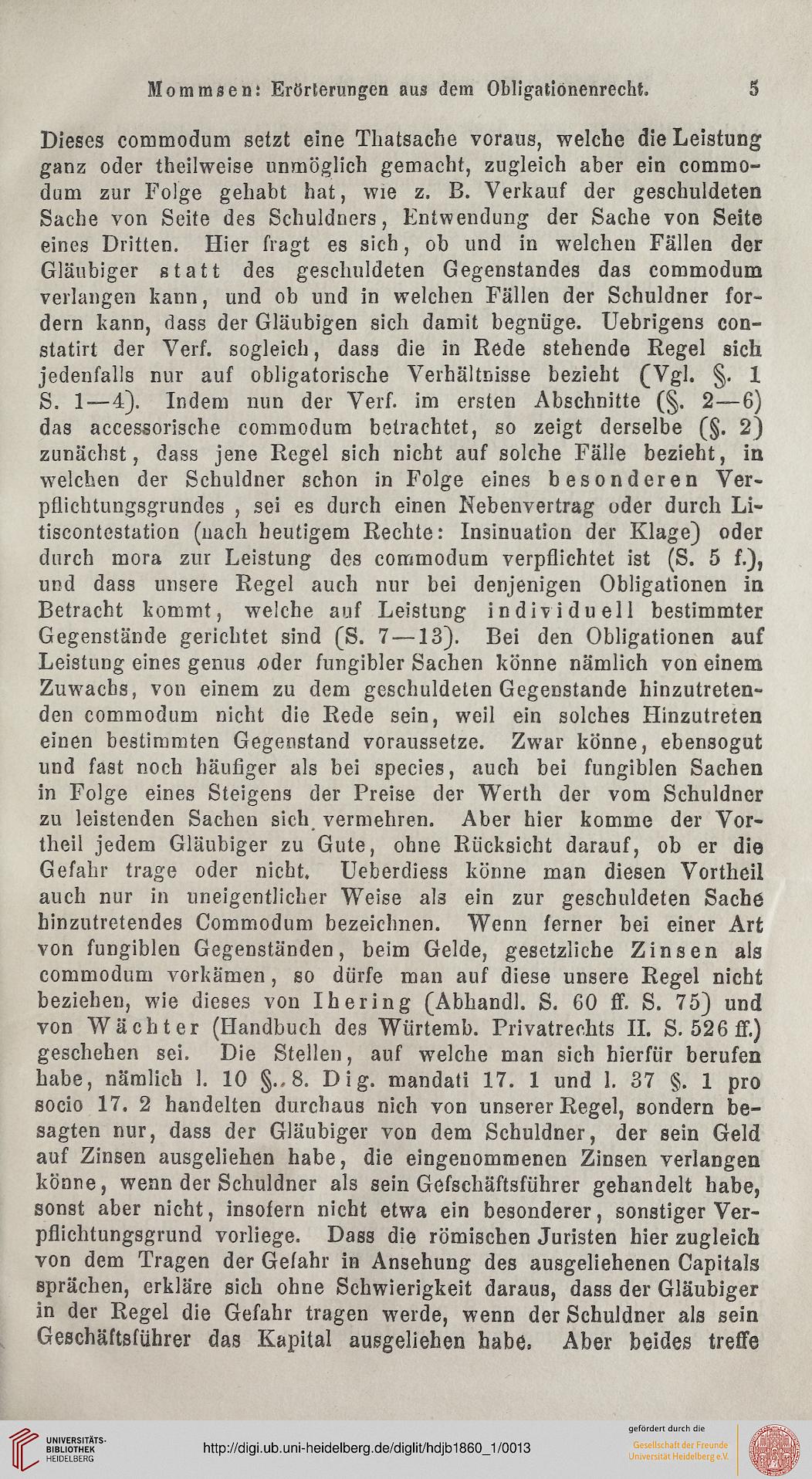Mommsen: Erörterungen aus dem Obligatiönenrecht. 5
Dieses commodum setzt eine Thatsache voraus, welche die Leistung
ganz oder theilweise unmöglich gemacht, zugleich aber ein commo-
dum zur Folge gehabt hat, wie z. B. Verkauf der geschuldeten
Sache von Seite des Schuldners, Entwendung der Sache von Seite
eines Dritten. Hier fragt es sich, ob und in welchen Fällen der
Gläubiger statt des geschuldeten Gegenstandes das commodum
verlangen kann, und ob und in welchen Fällen der Schuldner for-
dern kann, dass der Gläubigen sich damit begnüge. Uebrigens con-
statirt der Verf. sogleich, dass die in Rede stehende Regel sich
jedenfalls nur auf obligatorische Verhältnisse bezieht {Vgl. §. 1
S. 1—4). Indem nun der Verf. im ersten Abschnitte (§. 2—6)
das accessorische commodum betrachtet, so zeigt derselbe (§. 2)
zunächst, dass jene Regel sich nicht auf solche Fälle bezieht, in
welchen der Schuldner schon in Folge eines besonderen Ver-
pflichtungsgrundes , sei es durch einen Nebenvertrag oder durch Li-
tiscontestation (nach heutigem Rechte: Insinuation der Klage) oder
durch mora zur Leistung des commodum verpflichtet ist (S. 5 f.),
und dass unsere Regel auch nur bei denjenigen Obligationen in
Betracht kommt, welche auf Leistung individuell bestimmter
Gegenstände gerichtet sind (S. 7 —13). Bei den Obligationen auf
Leistung eines genus oder fungibler Sachen könne nämlich von einem
Zuwachs, von einem zu dem geschuldeten Gegenstände hinzutreten-
den commodum nicht die Rede sein, weil ein solches Hinzutreten
einen bestimmten Gegenstand voraussetze. Zwar könne, ebensogut
und fast noch häufiger als bei species, auch bei fungiblen Sachen
in Folge eines Steigens der Preise der Werth der vom Schuldner
zu leistenden Sachen sich, vermehren. Aber hier komme der Vor-
theil jedem Gläubiger zu Gute, ohne Rücksicht darauf, ob er die
Gefahr trage oder nicht. Ueberdiess könne man diesen Vortheil
auch nur in uneigentlicher Weise als ein zur geschuldeten Sache
hinzutretendes Commodum bezeichnen. Wenn ferner bei einer Art
von fungiblen Gegenständen, beim Gelde, gesetzliche Zinsen als
commodum vorkämen, so dürfe man auf diese unsere Regel nicht
beziehen, wie dieses von Ihering (Abhandl. S. 60 ff. S. 75) und
von Wächter (Handbuch des Würtemb. Privatrechts II. S. 526 ff.)
geschehen sei. Die Stellen, auf welche man sich hierfür berufen
habe, nämlich 1. 10 §..8. Dig. mandati 17. 1 und 1. 37 §. 1 pro
socio 17. 2 handelten durchaus nich von unserer Regel, sondern be-
sagten nur, dass der Gläubiger von dem Schuldner, der sein Geld
auf Zinsen ausgeliehen habe, die eingenommenen Zinsen verlangen
könne, wenn der Schuldner als sein Gefschäftsführer gehandelt habe,
sonst aber nicht, insofern nicht etwa ein besonderer, sonstiger Ver-
pflichtungsgrund vorliege. Dass die römischen Juristen hier zugleich
von dem Tragen der Gefahr in Ansehung des ausgeliehenen Capitals
sprächen, erkläre sich ohne Schwierigkeit daraus, dass der Gläubiger
in der Regel die Gefahr tragen werde, wenn der Schuldner als sein
Geschäftsführer das Kapital ausgeliehen habe. Aber beides treffe
Dieses commodum setzt eine Thatsache voraus, welche die Leistung
ganz oder theilweise unmöglich gemacht, zugleich aber ein commo-
dum zur Folge gehabt hat, wie z. B. Verkauf der geschuldeten
Sache von Seite des Schuldners, Entwendung der Sache von Seite
eines Dritten. Hier fragt es sich, ob und in welchen Fällen der
Gläubiger statt des geschuldeten Gegenstandes das commodum
verlangen kann, und ob und in welchen Fällen der Schuldner for-
dern kann, dass der Gläubigen sich damit begnüge. Uebrigens con-
statirt der Verf. sogleich, dass die in Rede stehende Regel sich
jedenfalls nur auf obligatorische Verhältnisse bezieht {Vgl. §. 1
S. 1—4). Indem nun der Verf. im ersten Abschnitte (§. 2—6)
das accessorische commodum betrachtet, so zeigt derselbe (§. 2)
zunächst, dass jene Regel sich nicht auf solche Fälle bezieht, in
welchen der Schuldner schon in Folge eines besonderen Ver-
pflichtungsgrundes , sei es durch einen Nebenvertrag oder durch Li-
tiscontestation (nach heutigem Rechte: Insinuation der Klage) oder
durch mora zur Leistung des commodum verpflichtet ist (S. 5 f.),
und dass unsere Regel auch nur bei denjenigen Obligationen in
Betracht kommt, welche auf Leistung individuell bestimmter
Gegenstände gerichtet sind (S. 7 —13). Bei den Obligationen auf
Leistung eines genus oder fungibler Sachen könne nämlich von einem
Zuwachs, von einem zu dem geschuldeten Gegenstände hinzutreten-
den commodum nicht die Rede sein, weil ein solches Hinzutreten
einen bestimmten Gegenstand voraussetze. Zwar könne, ebensogut
und fast noch häufiger als bei species, auch bei fungiblen Sachen
in Folge eines Steigens der Preise der Werth der vom Schuldner
zu leistenden Sachen sich, vermehren. Aber hier komme der Vor-
theil jedem Gläubiger zu Gute, ohne Rücksicht darauf, ob er die
Gefahr trage oder nicht. Ueberdiess könne man diesen Vortheil
auch nur in uneigentlicher Weise als ein zur geschuldeten Sache
hinzutretendes Commodum bezeichnen. Wenn ferner bei einer Art
von fungiblen Gegenständen, beim Gelde, gesetzliche Zinsen als
commodum vorkämen, so dürfe man auf diese unsere Regel nicht
beziehen, wie dieses von Ihering (Abhandl. S. 60 ff. S. 75) und
von Wächter (Handbuch des Würtemb. Privatrechts II. S. 526 ff.)
geschehen sei. Die Stellen, auf welche man sich hierfür berufen
habe, nämlich 1. 10 §..8. Dig. mandati 17. 1 und 1. 37 §. 1 pro
socio 17. 2 handelten durchaus nich von unserer Regel, sondern be-
sagten nur, dass der Gläubiger von dem Schuldner, der sein Geld
auf Zinsen ausgeliehen habe, die eingenommenen Zinsen verlangen
könne, wenn der Schuldner als sein Gefschäftsführer gehandelt habe,
sonst aber nicht, insofern nicht etwa ein besonderer, sonstiger Ver-
pflichtungsgrund vorliege. Dass die römischen Juristen hier zugleich
von dem Tragen der Gefahr in Ansehung des ausgeliehenen Capitals
sprächen, erkläre sich ohne Schwierigkeit daraus, dass der Gläubiger
in der Regel die Gefahr tragen werde, wenn der Schuldner als sein
Geschäftsführer das Kapital ausgeliehen habe. Aber beides treffe