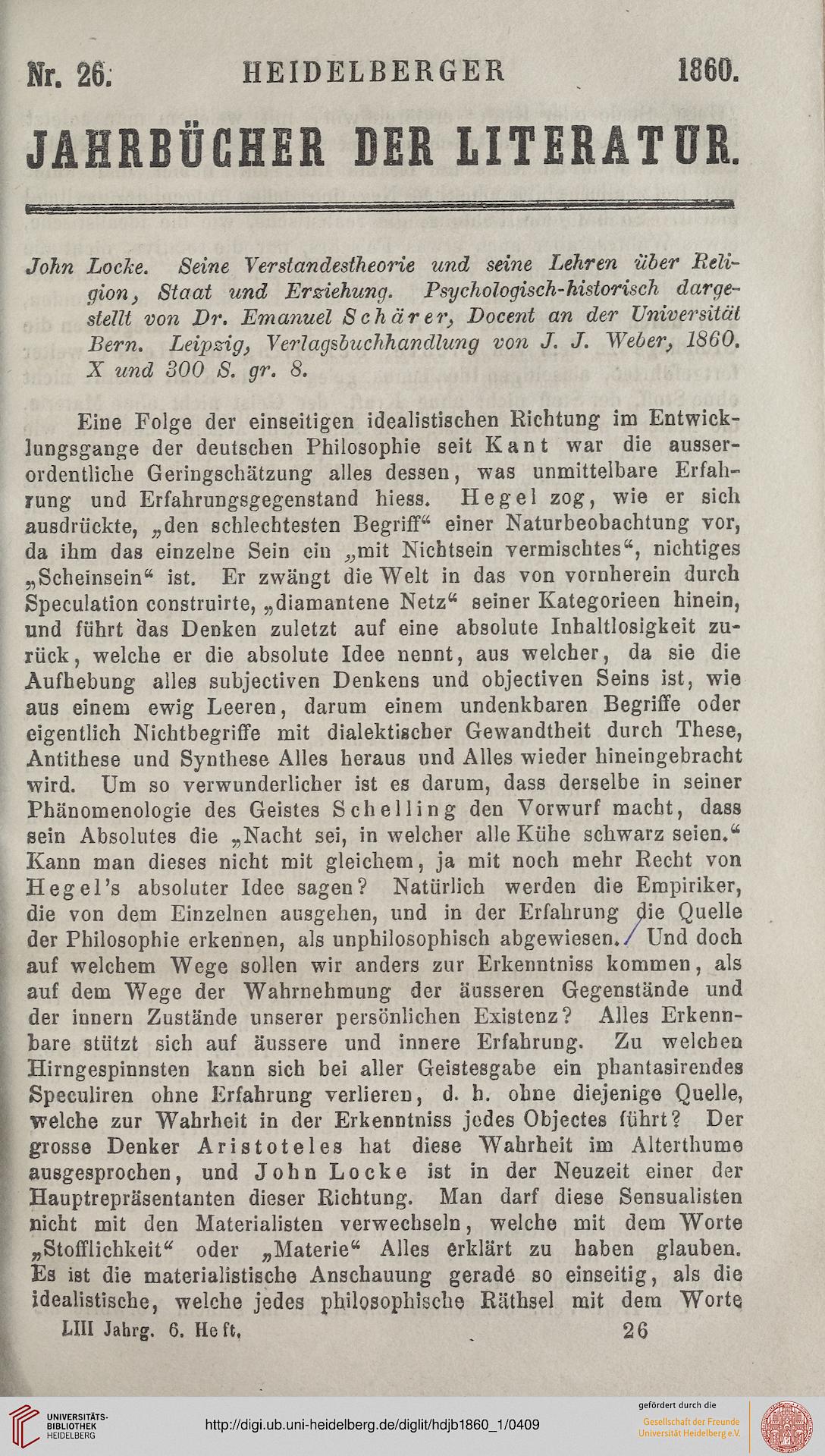Nr. 26.
HEIDELBERGER
1860.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
John Locke. Seine Verstandestheorie und seine Lehren über Reli-
gion , Staat und Erziehung. Psychologisch-historisch darge-
stellt von Dr. Emanuel Sc h är er, Docent an der Universität
Bern. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. 'Weber, 1860.
X und 300 S. gr. 8.
Eine Folge der einseitigen idealistischen Richtung im Entwick-
lungsgänge der deutschen Philosophie seit Kant war die ausser-
ordentliche Geringschätzung alles dessen, was unmittelbare Erfah-
rung und Erfahrungsgegenstand hiess. Hegel zog, wie er sich
ausdrückte, „den schlechtesten Begriff“ einer Naturbeobachtung vor,
da ihm das einzelne Sein ein „mit Nichtsein vermischtes“, nichtiges
„Scheinsein“ ist. Er zwängt die Welt in das von vornherein durch
Speculation construirte, „diamantene Netz“ seiner Kategorieen hinein,
und führt das Denken zuletzt auf eine absolute Inhaltlosigkeit zu-
rück, welche er die absolute Idee nennt, aus welcher, da sie die
Aufhebung alles subjectiven Denkens und objectiven Seins ist, wie
aus einem ewig Leeren, darum einem undenkbaren Begriffe oder
eigentlich Nichtbegriffe mit dialektischer Gewandtheit durch These,
Antithese und Synthese Alles heraus und Alles wieder hineingebracht
wird. Um so verwunderlicher ist es darum, dass derselbe in seiner
Phänomenologie des Geistes Schelling den Vorwurf macht, dass
sein Absolutes die „Nacht sei, in welcher alle Kühe schwarz seien.“
Kann man dieses nicht mit gleichem, ja mit noch mehr Recht von
Hegel’s absoluter Idee sagen? Natürlich werden die Empiriker,
die von dem Einzelnen ausgehen, und in der Erfahrung die Quelle
der Philosophie erkennen, als unpbilosophisch abgewiesen. / Und doch
auf welchem Wege sollen wir anders zur Erkenntniss kommen, als
auf dem Wege der Wahrnehmung der äusseren Gegenstände und
der innern Zustände unserer persönlichen Existenz? Alles Erkenn-
bare stützt sich auf äussere und innere Erfahrung. Zu welchen
Hirngespinnsten kann sich bei aller Geistesgabe ein phantasirendes
ISpeculiren ohne Erfahrung verlieren, d. h. ohne diejenige Quelle,
welche zur Wahrheit in der Erkenntniss jedes Objectes führt? Der
grosse Denker Aristoteles hat diese Wahrheit im Alterthume
ausgesprochen, und John Locke ist in der Neuzeit einer der
Hauptrepräsentanten dieser Richtung. Man darf diese Sensualisten
nicht mit den Materialisten verwechseln, welche mit dem Worte
„Stofflichkeit“ oder „Materie“ Alles erklärt zu haben glauben.
Es ist die materialistische Anschauung gerade so einseitig, als die
idealistische, welche jedes philosophische Räthsel mit dem Worte
LIII Jahrg. 6. Heft, 26
HEIDELBERGER
1860.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
John Locke. Seine Verstandestheorie und seine Lehren über Reli-
gion , Staat und Erziehung. Psychologisch-historisch darge-
stellt von Dr. Emanuel Sc h är er, Docent an der Universität
Bern. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von J. J. 'Weber, 1860.
X und 300 S. gr. 8.
Eine Folge der einseitigen idealistischen Richtung im Entwick-
lungsgänge der deutschen Philosophie seit Kant war die ausser-
ordentliche Geringschätzung alles dessen, was unmittelbare Erfah-
rung und Erfahrungsgegenstand hiess. Hegel zog, wie er sich
ausdrückte, „den schlechtesten Begriff“ einer Naturbeobachtung vor,
da ihm das einzelne Sein ein „mit Nichtsein vermischtes“, nichtiges
„Scheinsein“ ist. Er zwängt die Welt in das von vornherein durch
Speculation construirte, „diamantene Netz“ seiner Kategorieen hinein,
und führt das Denken zuletzt auf eine absolute Inhaltlosigkeit zu-
rück, welche er die absolute Idee nennt, aus welcher, da sie die
Aufhebung alles subjectiven Denkens und objectiven Seins ist, wie
aus einem ewig Leeren, darum einem undenkbaren Begriffe oder
eigentlich Nichtbegriffe mit dialektischer Gewandtheit durch These,
Antithese und Synthese Alles heraus und Alles wieder hineingebracht
wird. Um so verwunderlicher ist es darum, dass derselbe in seiner
Phänomenologie des Geistes Schelling den Vorwurf macht, dass
sein Absolutes die „Nacht sei, in welcher alle Kühe schwarz seien.“
Kann man dieses nicht mit gleichem, ja mit noch mehr Recht von
Hegel’s absoluter Idee sagen? Natürlich werden die Empiriker,
die von dem Einzelnen ausgehen, und in der Erfahrung die Quelle
der Philosophie erkennen, als unpbilosophisch abgewiesen. / Und doch
auf welchem Wege sollen wir anders zur Erkenntniss kommen, als
auf dem Wege der Wahrnehmung der äusseren Gegenstände und
der innern Zustände unserer persönlichen Existenz? Alles Erkenn-
bare stützt sich auf äussere und innere Erfahrung. Zu welchen
Hirngespinnsten kann sich bei aller Geistesgabe ein phantasirendes
ISpeculiren ohne Erfahrung verlieren, d. h. ohne diejenige Quelle,
welche zur Wahrheit in der Erkenntniss jedes Objectes führt? Der
grosse Denker Aristoteles hat diese Wahrheit im Alterthume
ausgesprochen, und John Locke ist in der Neuzeit einer der
Hauptrepräsentanten dieser Richtung. Man darf diese Sensualisten
nicht mit den Materialisten verwechseln, welche mit dem Worte
„Stofflichkeit“ oder „Materie“ Alles erklärt zu haben glauben.
Es ist die materialistische Anschauung gerade so einseitig, als die
idealistische, welche jedes philosophische Räthsel mit dem Worte
LIII Jahrg. 6. Heft, 26