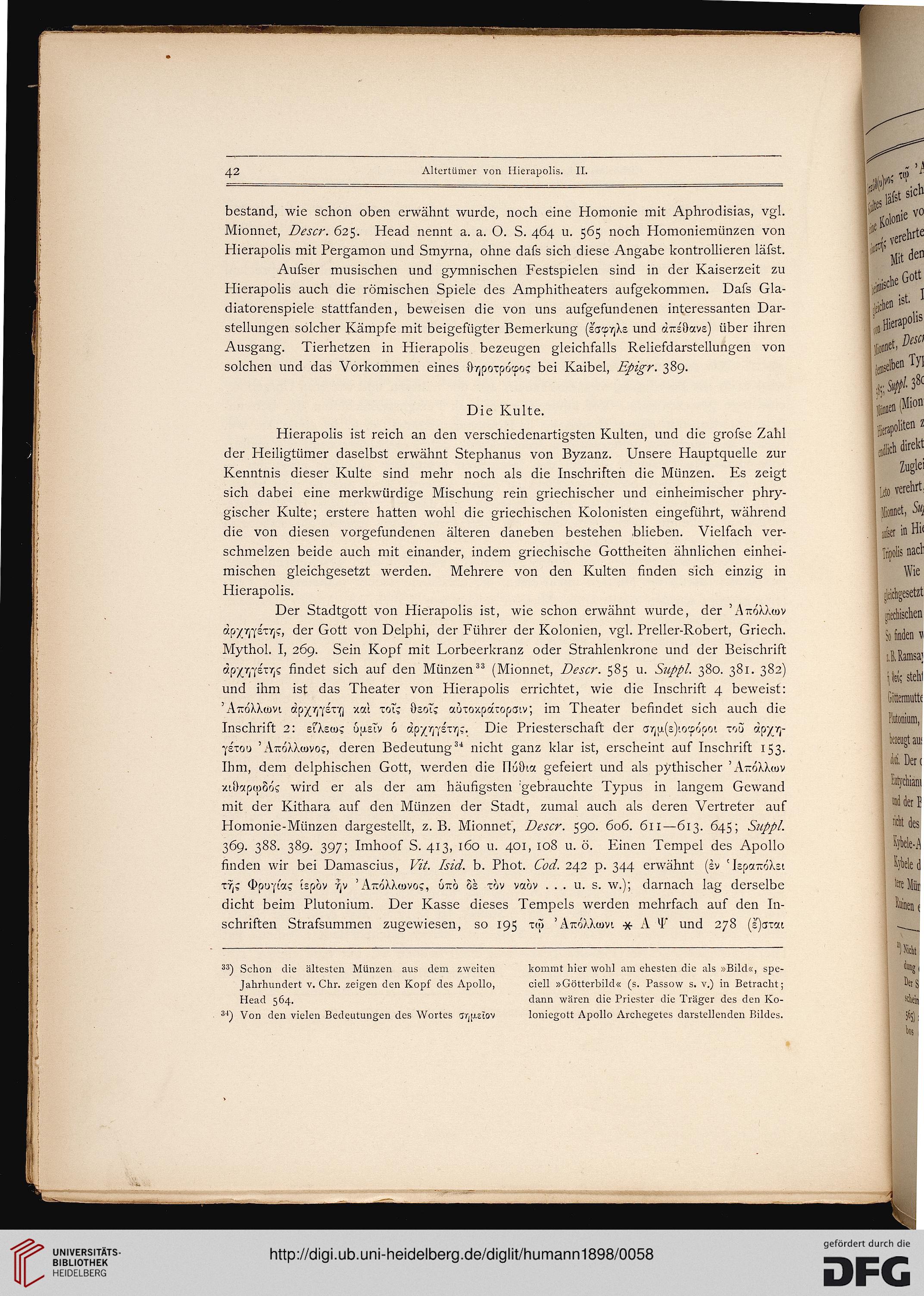42
Altertümer von Hierapolis. II.
bestand, wie schon oben erwähnt wurde, noch eine Homonie mit Aphrodisias, vgl.
Mionnet, Descr. 625. Head nennt a. a. O. S. 464 u. 565 noch Homoniemiinzen von
Hierapolis mit Pergamon und Smyrna, ohne dafs sich diese Angabe kontrollieren läfst.
Aufser musischen und gymnischen Festspielen sind in der Kaiserzeit zu
Hierapolis auch die römischen Spiele des Amphitheaters aufgekommen. Dafs Gla-
diatorenspiele stattfanden, beweisen die von uns aufgefundenen interessanten Dar-
stellungen solcher Kämpfe mit beigefügter Bemerkung (sacpvjXs und d-söocve) über ihren
Ausgang. Tierhetzen in Hierapolis bezeugen gleichfalls Reliefdarstellungen von
solchen und das Vorkommen eines övjpoTpocao; bei Kaibel, Epigr. 389.
Die Kulte.
Hierapolis ist reich an den verschiedenartigsten Kulten, und die grofse Zahl
der Heiligtümer daselbst erwähnt Stephanus von Byzanz. Unsere Hauptquelle zur
Kenntnis dieser Kulte sind mehr noch als die Inschriften die Münzen. Es zeigt
sich dabei eine merkwürdige Mischung rein griechischer und einheimischer phry-
gischer Kulte; erstere hatten wohl die griechischen Kolonisten eingeführt, während
die von diesen vorgefundenen älteren daneben bestehen blieben. Vielfach ver-
schmelzen beide auch mit einander, indem griechische Gottheiten ähnlichen einhei-
mischen gleichgesetzt werden. Mehrere von den Kulten finden sich einzig in
Hierapolis.
Der Stadtgott von Hierapolis ist, wie schon erwähnt wurde, der ' A-oXXwv
apyr^sr/jc, der Gott von Delphi, der Führer der Kolonien, vgl. Preller-Robert, Griech.
Mythol. I, 269. Sein Kopf mit Lorbeerkranz oder Strahlenkrone und der Beischrift
äpyj^ixrfi findet sich auf den Münzen33 (Mionnet, Descr. 585 u. Suppl. 380. 381. 382)
und ihm ist das Theater von Hierapolis errichtet, wie die Inschrift 4 beweist:
'A-öWauvi äpyjflirQ xal toi; ösotc auxoxpa'-opatv; im Theater befindet sich auch die
Inschrift 2: sfXstu; uptstv 6 dpyrf;i--q;. Die Priesterschaft der rjyj}j.(e)to!p6pot toö äpffl-
fsiou 'AkoXXwvoc, deren Bedeutung34 nicht ganz klar ist, erscheint auf Inschrift 153.
Ihm, dem delphischen Gott, werden die ilu&i« gefeiert und als pythischer 'A-oXXwv
xt&otptpSos wird er als der am häufigsten 'gebrauchte Typus in langem Gewand
mit der Kithara auf den Münzen der Stadt, zumal auch als deren Vertreter auf
Homonie-Münzen dargestellt, z.B. Mionnet", Descr. 590. 606. 611—613. 645; Suppl.
369. 388. 389. 397; Imhoof S. 413, 160 u. 401, 108 u. ö. Einen Tempel des Apollo
finden wir bei Damascius, Vit. Isid. b. Phot. Cod. 242 p. 344 erwähnt (sv 'Iöpct-oXii
xr(; <l>pi>Ytc(? [spöv vjv 'A-oXXwvoc, 6~ö Ss töv vaov ... u. s. w.); darnach lag derselbe
dicht beim Plutonium. Der Kasse dieses Tempels werden mehrfach auf den In-
schriften Strafsummen zugewiesen, so 195 xtjS 'AnoXXwvi •* A lF und 278 (s)<jTat
33) Schon die ältesten Münzen aus dem zweiten
Jahrhundert v. Chr. zeigen den Kopf des Apollo,
Head 564.
3l) Von den vielen Bedeutungen des Wortes rr^ziow
kommt hier wohl am ehesten die als »Bild«, spe-
ciell »Götterbild« (s. Passow s. v.) in Betracht;
dann wären die Priester die Träger des den Ko-
loniegott Apollo Archegetes darstellenden Bildes.
Altertümer von Hierapolis. II.
bestand, wie schon oben erwähnt wurde, noch eine Homonie mit Aphrodisias, vgl.
Mionnet, Descr. 625. Head nennt a. a. O. S. 464 u. 565 noch Homoniemiinzen von
Hierapolis mit Pergamon und Smyrna, ohne dafs sich diese Angabe kontrollieren läfst.
Aufser musischen und gymnischen Festspielen sind in der Kaiserzeit zu
Hierapolis auch die römischen Spiele des Amphitheaters aufgekommen. Dafs Gla-
diatorenspiele stattfanden, beweisen die von uns aufgefundenen interessanten Dar-
stellungen solcher Kämpfe mit beigefügter Bemerkung (sacpvjXs und d-söocve) über ihren
Ausgang. Tierhetzen in Hierapolis bezeugen gleichfalls Reliefdarstellungen von
solchen und das Vorkommen eines övjpoTpocao; bei Kaibel, Epigr. 389.
Die Kulte.
Hierapolis ist reich an den verschiedenartigsten Kulten, und die grofse Zahl
der Heiligtümer daselbst erwähnt Stephanus von Byzanz. Unsere Hauptquelle zur
Kenntnis dieser Kulte sind mehr noch als die Inschriften die Münzen. Es zeigt
sich dabei eine merkwürdige Mischung rein griechischer und einheimischer phry-
gischer Kulte; erstere hatten wohl die griechischen Kolonisten eingeführt, während
die von diesen vorgefundenen älteren daneben bestehen blieben. Vielfach ver-
schmelzen beide auch mit einander, indem griechische Gottheiten ähnlichen einhei-
mischen gleichgesetzt werden. Mehrere von den Kulten finden sich einzig in
Hierapolis.
Der Stadtgott von Hierapolis ist, wie schon erwähnt wurde, der ' A-oXXwv
apyr^sr/jc, der Gott von Delphi, der Führer der Kolonien, vgl. Preller-Robert, Griech.
Mythol. I, 269. Sein Kopf mit Lorbeerkranz oder Strahlenkrone und der Beischrift
äpyj^ixrfi findet sich auf den Münzen33 (Mionnet, Descr. 585 u. Suppl. 380. 381. 382)
und ihm ist das Theater von Hierapolis errichtet, wie die Inschrift 4 beweist:
'A-öWauvi äpyjflirQ xal toi; ösotc auxoxpa'-opatv; im Theater befindet sich auch die
Inschrift 2: sfXstu; uptstv 6 dpyrf;i--q;. Die Priesterschaft der rjyj}j.(e)to!p6pot toö äpffl-
fsiou 'AkoXXwvoc, deren Bedeutung34 nicht ganz klar ist, erscheint auf Inschrift 153.
Ihm, dem delphischen Gott, werden die ilu&i« gefeiert und als pythischer 'A-oXXwv
xt&otptpSos wird er als der am häufigsten 'gebrauchte Typus in langem Gewand
mit der Kithara auf den Münzen der Stadt, zumal auch als deren Vertreter auf
Homonie-Münzen dargestellt, z.B. Mionnet", Descr. 590. 606. 611—613. 645; Suppl.
369. 388. 389. 397; Imhoof S. 413, 160 u. 401, 108 u. ö. Einen Tempel des Apollo
finden wir bei Damascius, Vit. Isid. b. Phot. Cod. 242 p. 344 erwähnt (sv 'Iöpct-oXii
xr(; <l>pi>Ytc(? [spöv vjv 'A-oXXwvoc, 6~ö Ss töv vaov ... u. s. w.); darnach lag derselbe
dicht beim Plutonium. Der Kasse dieses Tempels werden mehrfach auf den In-
schriften Strafsummen zugewiesen, so 195 xtjS 'AnoXXwvi •* A lF und 278 (s)<jTat
33) Schon die ältesten Münzen aus dem zweiten
Jahrhundert v. Chr. zeigen den Kopf des Apollo,
Head 564.
3l) Von den vielen Bedeutungen des Wortes rr^ziow
kommt hier wohl am ehesten die als »Bild«, spe-
ciell »Götterbild« (s. Passow s. v.) in Betracht;
dann wären die Priester die Träger des den Ko-
loniegott Apollo Archegetes darstellenden Bildes.