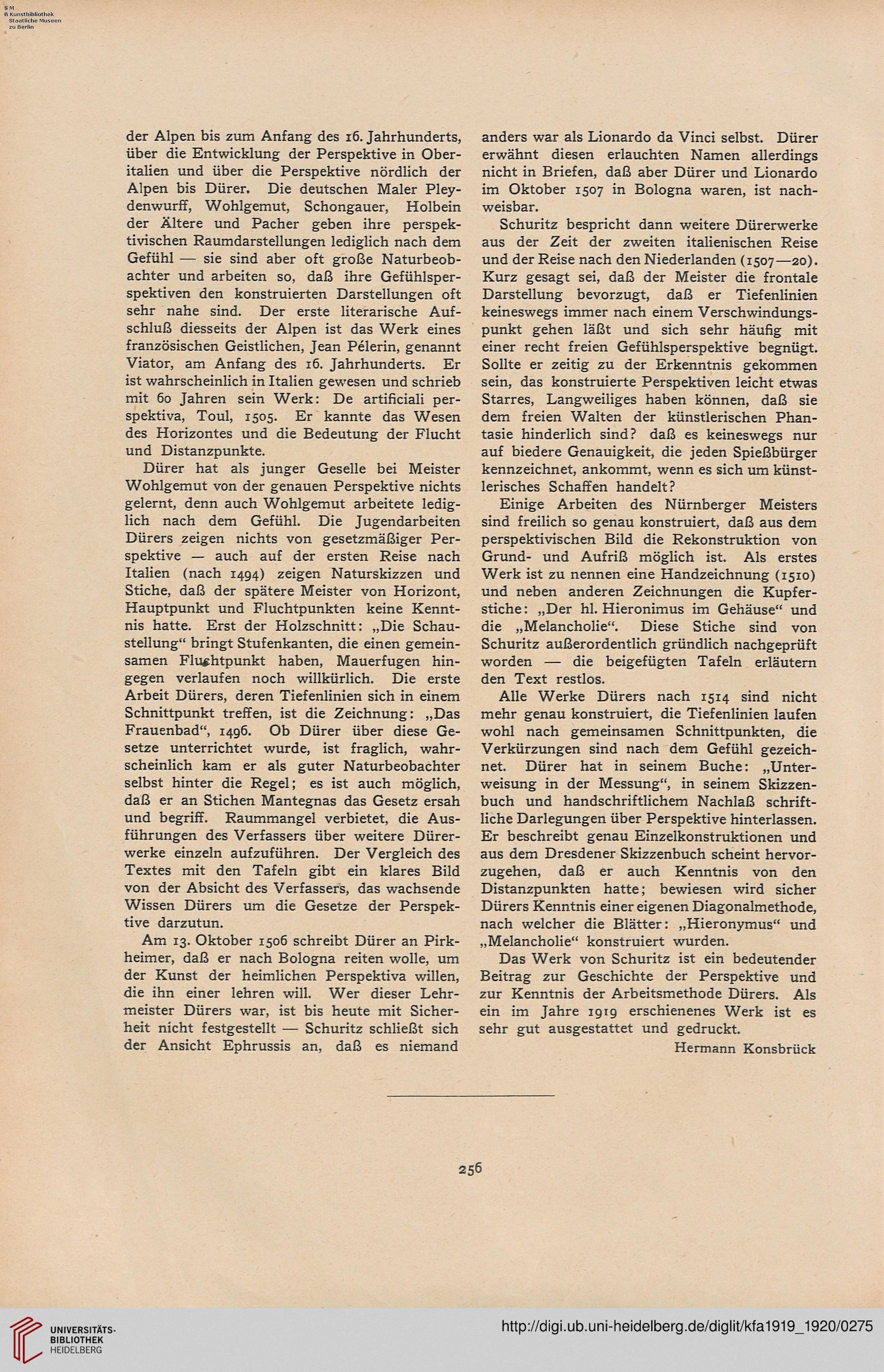der Alpen bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts,
über die Entwicklung der Perspektive in Ober-
italien und über die Perspektive nördlich der
Alpen bis Dürer. Die deutschen Maler Pley-
denwurff, Wohlgemut, Schongauer, Holbein
der Ältere und Pacher geben ihre perspek-
tivischen Raumdarstellungen lediglich nach dem
Gefühl — sie sind aber oft große Naturbeob-
achter und arbeiten so, daß ihre Gefühlsper-
spektiven den konstruierten Darstellungen oft
sehr nahe sind. Der erste literarische Auf-
schluß diesseits der Alpen ist das Werk eines
französischen Geistlichen, Jean Pelerin, genannt
Viator, am Anfang des 16. Jahrhunderts. Er
ist wahrscheinlich in Italien gewesen und schrieb
mit 60 Jahren sein Werk: De artificiali per-
spektiva, Toul, 1505. Er kannte das Wesen
des Horizontes und die Bedeutung der Flucht
und Distanzpunkte.
Dürer hat als junger Geselle bei Meister
Wohlgemut von der genauen Perspektive nichts
gelernt, denn auch Wohlgemut arbeitete ledig-
lich nach dem Gefühl. Die Jugendarbeiten
Dürers zeigen nichts von gesetzmäßiger Per-
spektive — auch auf der ersten Reise nach
Italien (nach 1494) zeigen Naturskizzen und
Stiche, daß der spätere Meister von Horizont,
Hauptpunkt und Fluchtpunkten keine Kennt-
nis hatte. Erst der Holzschnitt: „Die Schau-
stellung" bringt Stufenkanten, die einen gemein-
samen Fluchtpunkt haben, Mauerfugen hin-
gegen verlaufen noch willkürlich. Die erste
Arbeit Dürers, deren Tiefenlinien sich in einem
Schnittpunkt treffen, ist die Zeichnung: „Das
Frauenbad", 1496. Ob Dürer über diese Ge-
setze unterrichtet wurde, ist fraglich, wahr-
scheinlich kam er als guter Naturbeobachter
selbst hinter die Regel; es ist auch möglich,
daß er an Stichen Mantegnas das Gesetz ersah
und begriff. Raummangel verbietet, die Aus-
führungen des Verfassers über weitere Dürer-
werke einzeln aufzuführen. Der Vergleich des
Textes mit den Tafeln gibt ein klares Bild
von der Absicht des Verfassers, das wachsende
Wissen Dürers um die Gesetze der Perspek-
tive darzutun.
Am 13. Oktober 1506 schreibt Dürer an Pirk-
heimer, daß er nach Bologna reiten wolle, um
der Kunst der heimlichen Perspektiva willen,
die ihn einer lehren will. Wer dieser Lehr-
meister Dürers war, ist bis heute mit Sicher-
heit nicht festgestellt — Schuritz schließt sich
der Ansicht Ephrussis an, daß es niemand
anders war als Lionardo da Vinci selbst. Dürer
erwähnt diesen erlauchten Namen allerdings
nicht in Briefen, daß aber Dürer und Lionardo
im Oktober 1507 in Bologna waren, ist nach-
weisbar.
Schuritz bespricht dann weitere Dürerwerke
aus der Zeit der zweiten italienischen Reise
und der Reise nach den Niederlanden (1507—20).
Kurz gesagt sei, daß der Meister die frontale
Darstellung bevorzugt, daß er Tiefenlinien
keineswegs immer nach einem Verschwindungs-
punkt gehen läßt und sich sehr häufig mit
einer recht freien Gefühlsperspektive begnügt.
Sollte er zeitig zu der Erkenntnis gekommen
sein, das konstruierte Perspektiven leicht etwas
Starres, Langweiliges haben können, daß sie
dem freien Walten der künstlerischen Phan-
tasie hinderlich sind? daß es keineswegs nur
auf biedere Genauigkeit, die jeden Spießbürger
kennzeichnet, ankommt, wenn es sich um künst-
lerisches Schaffen handelt?
Einige Arbeiten des Nürnberger Meisters
sind freilich so genau konstruiert, daß aus dem
perspektivischen Bild die Rekonstruktion von
Grund- und Aufriß möglich ist. Als erstes
Werk ist zu nennen eine Handzeichnung (1510)
und neben anderen Zeichnungen die Kupfer-
stiche: „Der hl. Hieronimus im Gehäuse" und
die „Melancholie". Diese Stiche sind von
Schuritz außerordentlich gründlich nachgeprüft
worden — die beigefügten Tafeln erläutern
den Text restlos.
Alle Werke Dürers nach 1514 sind nicht
mehr genau konstruiert, die Tiefenlinien laufen
wohl nach gemeinsamen Schnittpunkten, die
Verkürzungen sind nach dem Gefühl gezeich-
net. Dürer hat in seinem Buche: „Unter-
weisung in der Messung", in seinem Skizzen-
buch und handschriftlichem Nachlaß schrift-
liche Darlegungen über Perspektive hinterlassen.
Er beschreibt genau Einzelkonstruktionen und
aus dem Dresdener Skizzenbuch scheint hervor-
zugehen, daß er auch Kenntnis von den
Distanzpunkten hatte; bewiesen wird sicher
Dürers Kenntnis einer eigenen Diagonalmethode,
nach welcher die Blätter: „Hieronymus" und
„Melancholie" konstruiert wurden.
Das Werk von Schuritz ist ein bedeutender
Beitrag zur Geschichte der Perspektive und
zur Kenntnis der Arbeitsmethode Dürers. Als
ein im Jahre 1919 erschienenes Werk ist es
sehr gut ausgestattet und gedruckt.
Hermann Konsbrück
256
über die Entwicklung der Perspektive in Ober-
italien und über die Perspektive nördlich der
Alpen bis Dürer. Die deutschen Maler Pley-
denwurff, Wohlgemut, Schongauer, Holbein
der Ältere und Pacher geben ihre perspek-
tivischen Raumdarstellungen lediglich nach dem
Gefühl — sie sind aber oft große Naturbeob-
achter und arbeiten so, daß ihre Gefühlsper-
spektiven den konstruierten Darstellungen oft
sehr nahe sind. Der erste literarische Auf-
schluß diesseits der Alpen ist das Werk eines
französischen Geistlichen, Jean Pelerin, genannt
Viator, am Anfang des 16. Jahrhunderts. Er
ist wahrscheinlich in Italien gewesen und schrieb
mit 60 Jahren sein Werk: De artificiali per-
spektiva, Toul, 1505. Er kannte das Wesen
des Horizontes und die Bedeutung der Flucht
und Distanzpunkte.
Dürer hat als junger Geselle bei Meister
Wohlgemut von der genauen Perspektive nichts
gelernt, denn auch Wohlgemut arbeitete ledig-
lich nach dem Gefühl. Die Jugendarbeiten
Dürers zeigen nichts von gesetzmäßiger Per-
spektive — auch auf der ersten Reise nach
Italien (nach 1494) zeigen Naturskizzen und
Stiche, daß der spätere Meister von Horizont,
Hauptpunkt und Fluchtpunkten keine Kennt-
nis hatte. Erst der Holzschnitt: „Die Schau-
stellung" bringt Stufenkanten, die einen gemein-
samen Fluchtpunkt haben, Mauerfugen hin-
gegen verlaufen noch willkürlich. Die erste
Arbeit Dürers, deren Tiefenlinien sich in einem
Schnittpunkt treffen, ist die Zeichnung: „Das
Frauenbad", 1496. Ob Dürer über diese Ge-
setze unterrichtet wurde, ist fraglich, wahr-
scheinlich kam er als guter Naturbeobachter
selbst hinter die Regel; es ist auch möglich,
daß er an Stichen Mantegnas das Gesetz ersah
und begriff. Raummangel verbietet, die Aus-
führungen des Verfassers über weitere Dürer-
werke einzeln aufzuführen. Der Vergleich des
Textes mit den Tafeln gibt ein klares Bild
von der Absicht des Verfassers, das wachsende
Wissen Dürers um die Gesetze der Perspek-
tive darzutun.
Am 13. Oktober 1506 schreibt Dürer an Pirk-
heimer, daß er nach Bologna reiten wolle, um
der Kunst der heimlichen Perspektiva willen,
die ihn einer lehren will. Wer dieser Lehr-
meister Dürers war, ist bis heute mit Sicher-
heit nicht festgestellt — Schuritz schließt sich
der Ansicht Ephrussis an, daß es niemand
anders war als Lionardo da Vinci selbst. Dürer
erwähnt diesen erlauchten Namen allerdings
nicht in Briefen, daß aber Dürer und Lionardo
im Oktober 1507 in Bologna waren, ist nach-
weisbar.
Schuritz bespricht dann weitere Dürerwerke
aus der Zeit der zweiten italienischen Reise
und der Reise nach den Niederlanden (1507—20).
Kurz gesagt sei, daß der Meister die frontale
Darstellung bevorzugt, daß er Tiefenlinien
keineswegs immer nach einem Verschwindungs-
punkt gehen läßt und sich sehr häufig mit
einer recht freien Gefühlsperspektive begnügt.
Sollte er zeitig zu der Erkenntnis gekommen
sein, das konstruierte Perspektiven leicht etwas
Starres, Langweiliges haben können, daß sie
dem freien Walten der künstlerischen Phan-
tasie hinderlich sind? daß es keineswegs nur
auf biedere Genauigkeit, die jeden Spießbürger
kennzeichnet, ankommt, wenn es sich um künst-
lerisches Schaffen handelt?
Einige Arbeiten des Nürnberger Meisters
sind freilich so genau konstruiert, daß aus dem
perspektivischen Bild die Rekonstruktion von
Grund- und Aufriß möglich ist. Als erstes
Werk ist zu nennen eine Handzeichnung (1510)
und neben anderen Zeichnungen die Kupfer-
stiche: „Der hl. Hieronimus im Gehäuse" und
die „Melancholie". Diese Stiche sind von
Schuritz außerordentlich gründlich nachgeprüft
worden — die beigefügten Tafeln erläutern
den Text restlos.
Alle Werke Dürers nach 1514 sind nicht
mehr genau konstruiert, die Tiefenlinien laufen
wohl nach gemeinsamen Schnittpunkten, die
Verkürzungen sind nach dem Gefühl gezeich-
net. Dürer hat in seinem Buche: „Unter-
weisung in der Messung", in seinem Skizzen-
buch und handschriftlichem Nachlaß schrift-
liche Darlegungen über Perspektive hinterlassen.
Er beschreibt genau Einzelkonstruktionen und
aus dem Dresdener Skizzenbuch scheint hervor-
zugehen, daß er auch Kenntnis von den
Distanzpunkten hatte; bewiesen wird sicher
Dürers Kenntnis einer eigenen Diagonalmethode,
nach welcher die Blätter: „Hieronymus" und
„Melancholie" konstruiert wurden.
Das Werk von Schuritz ist ein bedeutender
Beitrag zur Geschichte der Perspektive und
zur Kenntnis der Arbeitsmethode Dürers. Als
ein im Jahre 1919 erschienenes Werk ist es
sehr gut ausgestattet und gedruckt.
Hermann Konsbrück
256