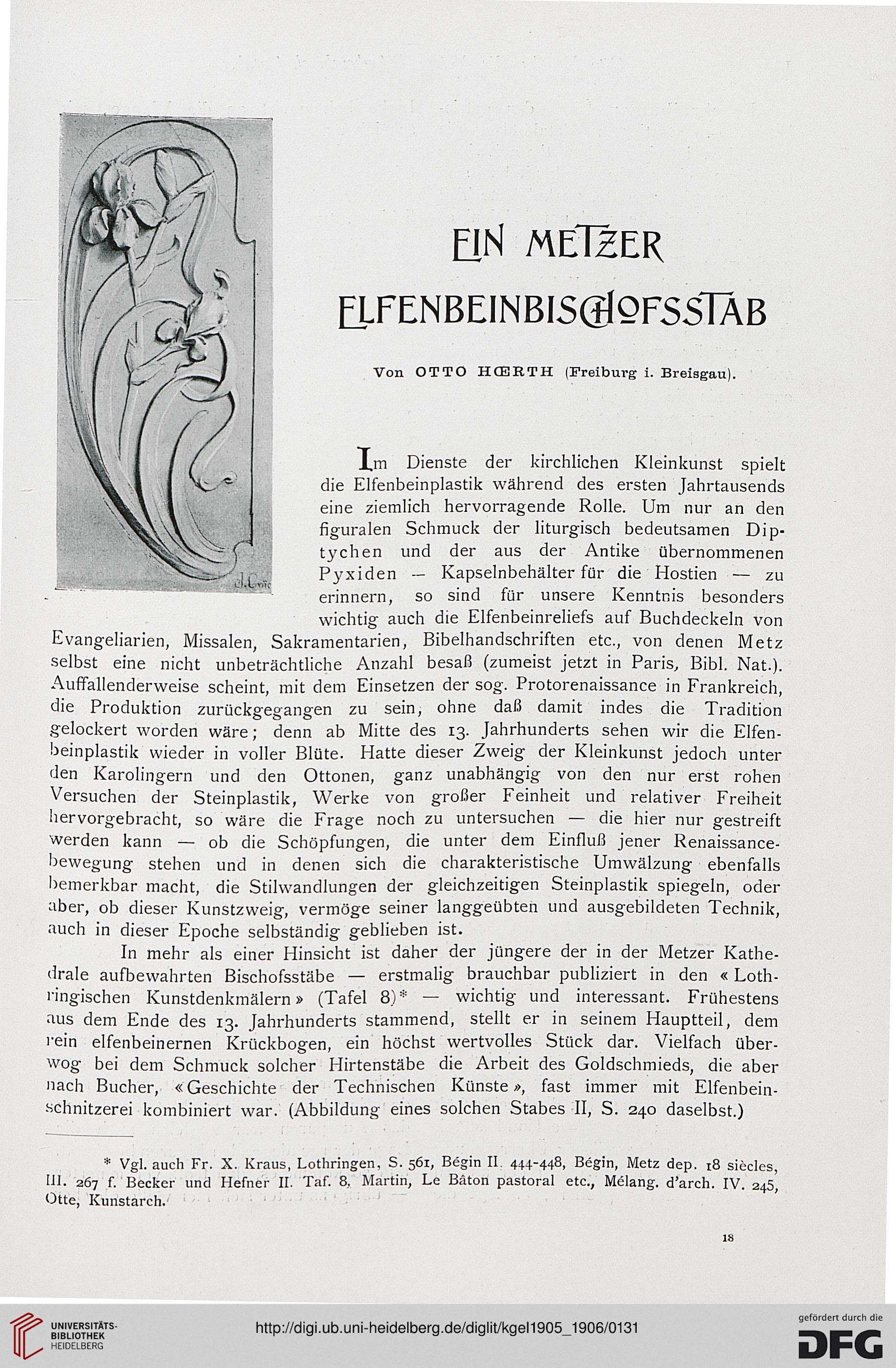EIN METZER
ELFENBEINBISGlQFSSTÄB
Von OTTO HCERTH [Freiburg i. Breisgau).
JLm Dienste der kirchlichen Kleinkunst spielt
die Elfenbeinplastik während des ersten Jahrtausends
eine ziemlich hervorragende Rolle. Um nur an den
figuralen Schmuck der liturgisch bedeutsamen Dip-
tychen und der aus der Antike übernommenen
Pyxiden — Kapselnbehälter für die Hostien — zu
erinnern, so sind für unsere Kenntnis besonders
wichtig auch die Elfenbeinreliefs auf Buchdeckeln von
Evangeliarien, Missalen, Sakramentarien, Bibelhandschriften etc., von denen Metz
selbst eine nicht unbeträchtliche Anzahl besaß (zumeist jetzt in Paris, Bibl. Nat).
Auffallenderweise scheint, mit dem Einsetzen der sog. Protorenaissance in Frankreich,
die Produktion zurücke-e^aneen zu sein, ohne daß damit indes die Tradition
gelockert worden wäre; denn ab Mitte des 13. Jahrhunderts sehen wir die Elfen-
beinplastik wieder in voller Blüte. Hatte dieser Zweig der Kleinkunst jedoch unter
den Karolingern und den Ottonen, ganz unabhängig von den nur erst rohen
Versuchen der Steinplastik, Werke von großer Feinheit und relativer Freiheit
hervorgebracht, so wäre die Frage noch zu untersuchen — die hier nur gestreift
werden kann — ob die Schöpfungen, die unter dem Einfluß jener Renaissance-
bewegung stehen und in denen sich die charakteristische Umwälzung ebenfalls
bemerkbar macht, die Stilwandlungen der gleichzeitigen Steinplastik spiegeln, oder
aber, ob dieser Kunstzweig, vermöge seiner langgeübten und ausgebildeten Technik,
auch in dieser Epoche selbständig geblieben ist.
In mehr als einer Hinsicht ist daher der jüngere der in der Metzer Kathe-
drale aufbewahrten Bischofsstäbe — erstmalig brauchbar publiziert in den « Loth-
ringischen Kunstdenkmälern» (Tafel 8)* — wichtig und interessant. Frühestens
aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammend, stellt er in seinem Hauptteil, dem
rein elfenbeinernen Krückbogen, ein höchst wertvolles Stück dar. Vielfach über-
wog bei dem Schmuck solcher Hirtenstäbe die Arbeit des Goldschmieds, die aber
nach Bucher, «Geschichte der Technischen Künste», fast immer mit Elfenbein-
schnitzerei kombiniert war. (Abbildung eines solchen Stabes II, S. 240 daselbst.)
* Vgl. auch Fr. X. Kraus, Lothringen, S. 561, Begin II 4+4-448, Begin, Metz dep. 18 siecles,
HI. 267 f. Becker und Hefner II. Täf. 8, Martin, Le Bäton pastoral etc., Mclang. d'arch. IV. 245,
Otte, Kunstarch.
18
ELFENBEINBISGlQFSSTÄB
Von OTTO HCERTH [Freiburg i. Breisgau).
JLm Dienste der kirchlichen Kleinkunst spielt
die Elfenbeinplastik während des ersten Jahrtausends
eine ziemlich hervorragende Rolle. Um nur an den
figuralen Schmuck der liturgisch bedeutsamen Dip-
tychen und der aus der Antike übernommenen
Pyxiden — Kapselnbehälter für die Hostien — zu
erinnern, so sind für unsere Kenntnis besonders
wichtig auch die Elfenbeinreliefs auf Buchdeckeln von
Evangeliarien, Missalen, Sakramentarien, Bibelhandschriften etc., von denen Metz
selbst eine nicht unbeträchtliche Anzahl besaß (zumeist jetzt in Paris, Bibl. Nat).
Auffallenderweise scheint, mit dem Einsetzen der sog. Protorenaissance in Frankreich,
die Produktion zurücke-e^aneen zu sein, ohne daß damit indes die Tradition
gelockert worden wäre; denn ab Mitte des 13. Jahrhunderts sehen wir die Elfen-
beinplastik wieder in voller Blüte. Hatte dieser Zweig der Kleinkunst jedoch unter
den Karolingern und den Ottonen, ganz unabhängig von den nur erst rohen
Versuchen der Steinplastik, Werke von großer Feinheit und relativer Freiheit
hervorgebracht, so wäre die Frage noch zu untersuchen — die hier nur gestreift
werden kann — ob die Schöpfungen, die unter dem Einfluß jener Renaissance-
bewegung stehen und in denen sich die charakteristische Umwälzung ebenfalls
bemerkbar macht, die Stilwandlungen der gleichzeitigen Steinplastik spiegeln, oder
aber, ob dieser Kunstzweig, vermöge seiner langgeübten und ausgebildeten Technik,
auch in dieser Epoche selbständig geblieben ist.
In mehr als einer Hinsicht ist daher der jüngere der in der Metzer Kathe-
drale aufbewahrten Bischofsstäbe — erstmalig brauchbar publiziert in den « Loth-
ringischen Kunstdenkmälern» (Tafel 8)* — wichtig und interessant. Frühestens
aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammend, stellt er in seinem Hauptteil, dem
rein elfenbeinernen Krückbogen, ein höchst wertvolles Stück dar. Vielfach über-
wog bei dem Schmuck solcher Hirtenstäbe die Arbeit des Goldschmieds, die aber
nach Bucher, «Geschichte der Technischen Künste», fast immer mit Elfenbein-
schnitzerei kombiniert war. (Abbildung eines solchen Stabes II, S. 240 daselbst.)
* Vgl. auch Fr. X. Kraus, Lothringen, S. 561, Begin II 4+4-448, Begin, Metz dep. 18 siecles,
HI. 267 f. Becker und Hefner II. Täf. 8, Martin, Le Bäton pastoral etc., Mclang. d'arch. IV. 245,
Otte, Kunstarch.
18