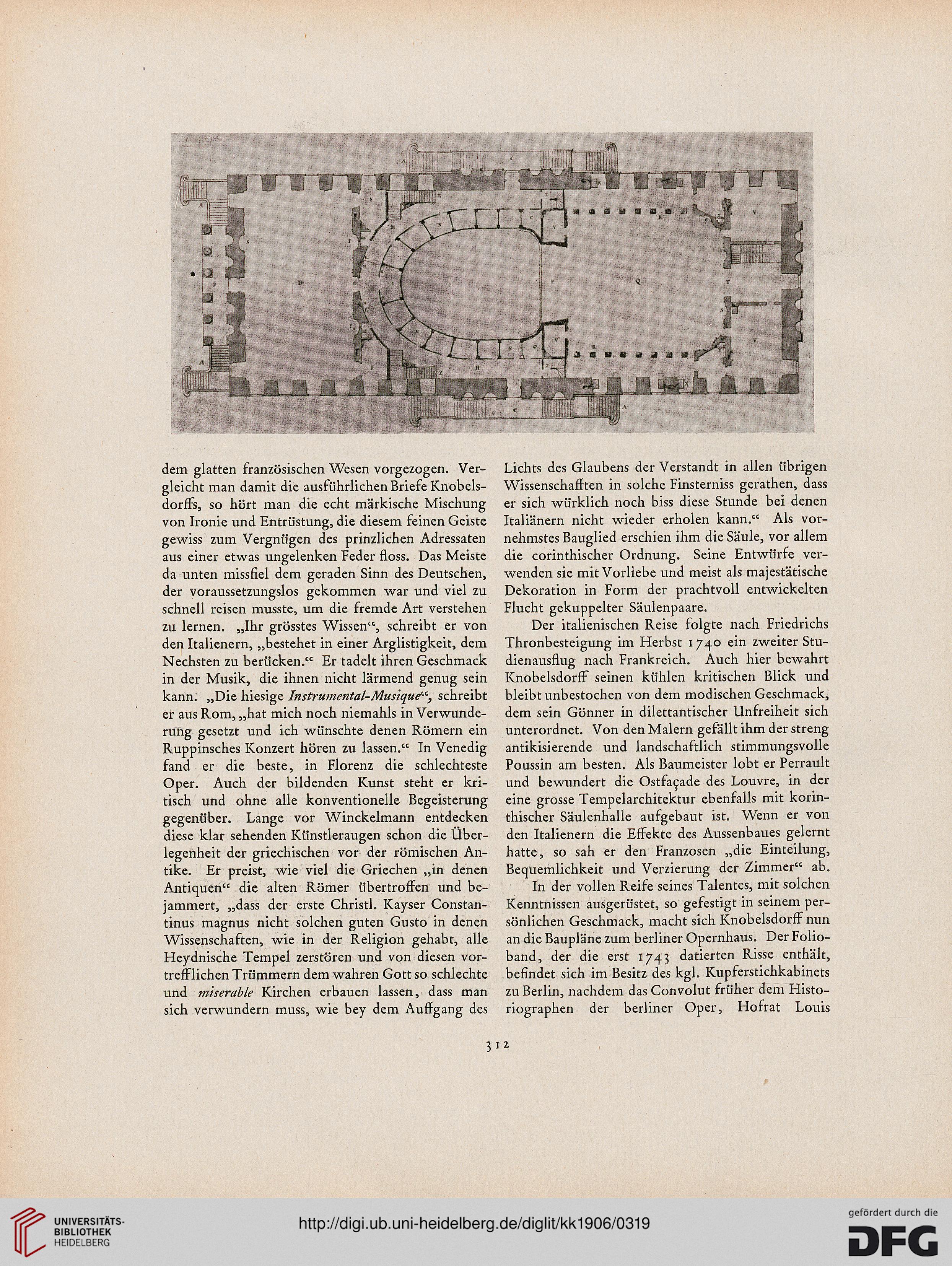,*.
■ •' !
J
9
■Kl A
ixirh"
« ■ ■ m
~~y------T"
... L_ L
A --JU_J lau « * a /«'■.«
. .iiyiM^i
dem glatten französischen Wesen vorgezogen. Ver-
gleicht man damit die ausführlichen Briefe Knobels-
dorffs, so hört man die echt märkische Mischung
von Ironie und Entrüstung, die diesem feinen Geiste
gewiss zum Vergnügen des prinzlichen Adressaten
aus einer etwas ungelenken Feder floss. Das Meiste
da unten missfiel dem geraden Sinn des Deutschen,
der voraussetzungslos gekommen war und viel zu
schnell reisen musste, um die fremde Art verstehen
zu lernen. „Ihr grösstes Wissen", schreibt er von
den Italienern, „bestehet in einer Arglistigkeit, dem
Nechsten zu berücken." Er tadelt ihren Geschmack
in der Musik, die ihnen nicht lärmend genug sein
kann. „Die hiesige Instrumental-Musique", schreibt
er aus Rom, „hat mich noch niemahls in Verwunde-
rung gesetzt und ich wünschte denen Römern ein
Ruppinsches Konzert hören zu lassen." In Venedig
fand er die beste, in Florenz die schlechteste
Oper. Auch der bildenden Kunst steht er kri-
tisch und ohne alle konventionelle Begeisterung
gegenüber. Lange vor Winckelmann entdecken
diese klar sehenden Künstleraugen schon die Über-
legenheit der griechischen vor der römischen An-
tike. Er preist, wie viel die Griechen „in denen
Antiquen" die alten Römer übertroffen und be-
jammert, „dass der erste Christi. Kayser Constan-
tinus magnus nicht solchen guten Gusto in denen
Wissenschaften, wie in der Religion gehabt, alle
Heydnische Tempel zerstören und von diesen vor-
trefflichen Trümmern dem wahren Gott so schlechte
und miserable Kirchen erbauen lassen, dass man
sich verwundern muss, wie bey dem Auffgang des
Lichts des Glaubens der Verstandt in allen übrigen
Wissenschafften in solche Finsterniss gerathen, dass
er sich würklich noch biss diese Stunde bei denen
Italiänern nicht wieder erholen kann." Als vor-
nehmstes Bauglied erschien ihm die Säule, vor allem
die corinthischer Ordnung. Seine Entwürfe ver-
wenden sie mit Vorliebe und meist als majestätische
Dekoration in Form der prachtvoll entwickelten
Flucht gekuppelter Säulenpaare.
Der italienischen Reise folgte nach Friedrichs
Thronbesteigung im Herbst 1740 ein zweiter Stu-
dienausflug nach Frankreich. Auch hier bewahrt
Knobelsdorff seinen kühlen kritischen Blick und
bleibt unbestochen von dem modischen Geschmack,
dem sein Gönner in dilettantischer Unfreiheit sich
unterordnet. Von den Malern gefällt ihm der streng
antikisierende und landschaftlich stimmungsvolle
Poussin am besten. Als Baumeister lobt er Perrault
und bewundert die Ostfacade des Louvre, in der
eine grosse Tempelarchitektur ebenfalls mit korin-
thischer Säulenhalle aufgebaut ist. Wenn er von
den Italienern die Effekte des Aussenbaues gelernt
hatte, so sah er den Franzosen „die Einteilung,
Bequemlichkeit und Verzierung der Zimmer" ab.
In der vollen Reife seines Talentes, mit solchen
Kenntnissen ausgerüstet, so gefestigt in seinem per-
sönlichen Geschmack, macht sich Knobelsdorff nun
an die Baupläne zum berliner Opernhaus. Der Folio-
band, der die erst 1743 datierten Risse enthält,
befindet sich im Besitz des kgl. Kupferstichkabinets
zu Berlin, nachdem das Convolut früher dem Histo-
riographen der berliner Oper, Hofrat Louis
312
■ •' !
J
9
■Kl A
ixirh"
« ■ ■ m
~~y------T"
... L_ L
A --JU_J lau « * a /«'■.«
. .iiyiM^i
dem glatten französischen Wesen vorgezogen. Ver-
gleicht man damit die ausführlichen Briefe Knobels-
dorffs, so hört man die echt märkische Mischung
von Ironie und Entrüstung, die diesem feinen Geiste
gewiss zum Vergnügen des prinzlichen Adressaten
aus einer etwas ungelenken Feder floss. Das Meiste
da unten missfiel dem geraden Sinn des Deutschen,
der voraussetzungslos gekommen war und viel zu
schnell reisen musste, um die fremde Art verstehen
zu lernen. „Ihr grösstes Wissen", schreibt er von
den Italienern, „bestehet in einer Arglistigkeit, dem
Nechsten zu berücken." Er tadelt ihren Geschmack
in der Musik, die ihnen nicht lärmend genug sein
kann. „Die hiesige Instrumental-Musique", schreibt
er aus Rom, „hat mich noch niemahls in Verwunde-
rung gesetzt und ich wünschte denen Römern ein
Ruppinsches Konzert hören zu lassen." In Venedig
fand er die beste, in Florenz die schlechteste
Oper. Auch der bildenden Kunst steht er kri-
tisch und ohne alle konventionelle Begeisterung
gegenüber. Lange vor Winckelmann entdecken
diese klar sehenden Künstleraugen schon die Über-
legenheit der griechischen vor der römischen An-
tike. Er preist, wie viel die Griechen „in denen
Antiquen" die alten Römer übertroffen und be-
jammert, „dass der erste Christi. Kayser Constan-
tinus magnus nicht solchen guten Gusto in denen
Wissenschaften, wie in der Religion gehabt, alle
Heydnische Tempel zerstören und von diesen vor-
trefflichen Trümmern dem wahren Gott so schlechte
und miserable Kirchen erbauen lassen, dass man
sich verwundern muss, wie bey dem Auffgang des
Lichts des Glaubens der Verstandt in allen übrigen
Wissenschafften in solche Finsterniss gerathen, dass
er sich würklich noch biss diese Stunde bei denen
Italiänern nicht wieder erholen kann." Als vor-
nehmstes Bauglied erschien ihm die Säule, vor allem
die corinthischer Ordnung. Seine Entwürfe ver-
wenden sie mit Vorliebe und meist als majestätische
Dekoration in Form der prachtvoll entwickelten
Flucht gekuppelter Säulenpaare.
Der italienischen Reise folgte nach Friedrichs
Thronbesteigung im Herbst 1740 ein zweiter Stu-
dienausflug nach Frankreich. Auch hier bewahrt
Knobelsdorff seinen kühlen kritischen Blick und
bleibt unbestochen von dem modischen Geschmack,
dem sein Gönner in dilettantischer Unfreiheit sich
unterordnet. Von den Malern gefällt ihm der streng
antikisierende und landschaftlich stimmungsvolle
Poussin am besten. Als Baumeister lobt er Perrault
und bewundert die Ostfacade des Louvre, in der
eine grosse Tempelarchitektur ebenfalls mit korin-
thischer Säulenhalle aufgebaut ist. Wenn er von
den Italienern die Effekte des Aussenbaues gelernt
hatte, so sah er den Franzosen „die Einteilung,
Bequemlichkeit und Verzierung der Zimmer" ab.
In der vollen Reife seines Talentes, mit solchen
Kenntnissen ausgerüstet, so gefestigt in seinem per-
sönlichen Geschmack, macht sich Knobelsdorff nun
an die Baupläne zum berliner Opernhaus. Der Folio-
band, der die erst 1743 datierten Risse enthält,
befindet sich im Besitz des kgl. Kupferstichkabinets
zu Berlin, nachdem das Convolut früher dem Histo-
riographen der berliner Oper, Hofrat Louis
312