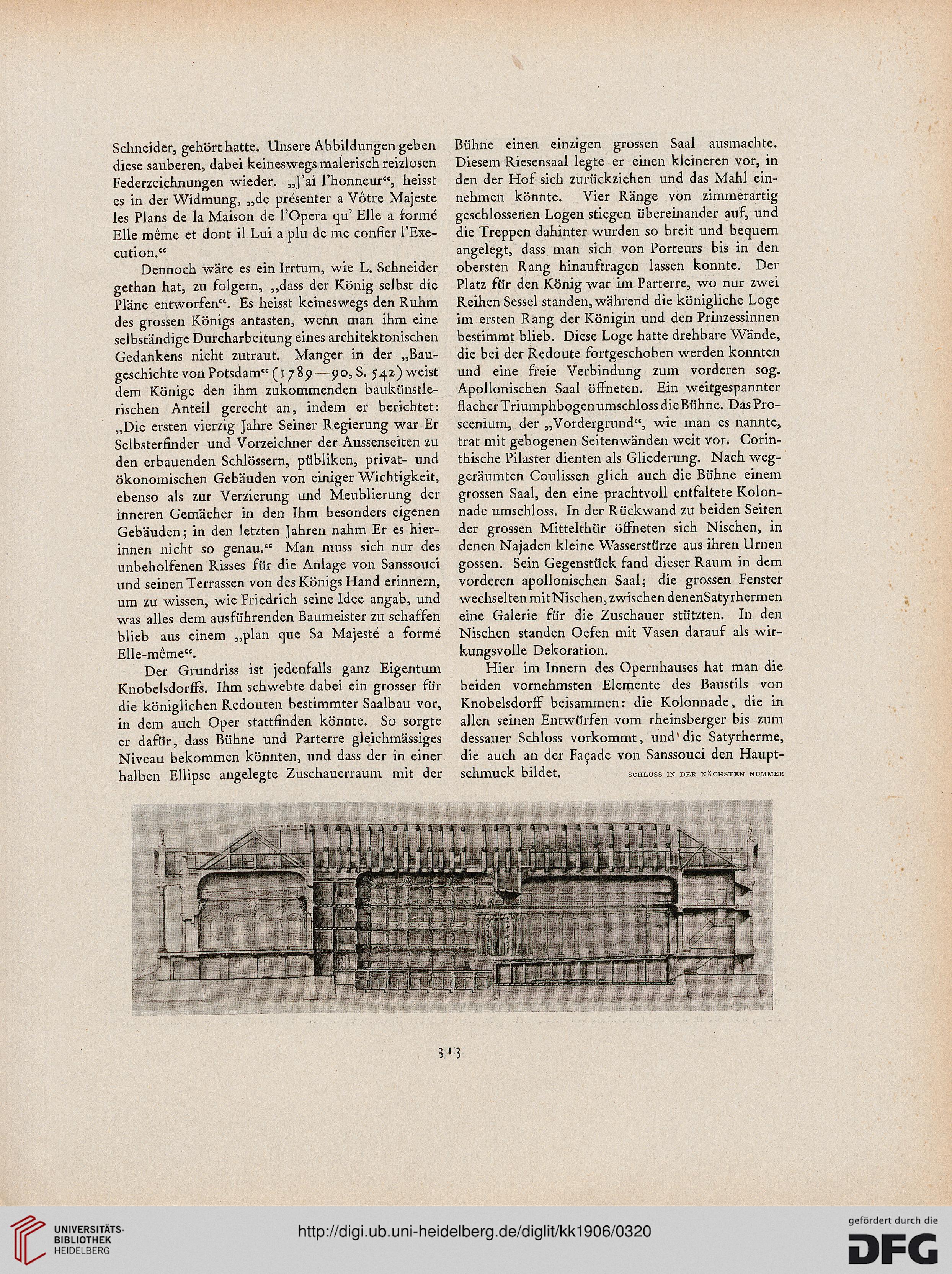Schneider, gehört hatte. Unsere Abbildungen geben
diese sauberen, dabei keineswegs malerisch reizlosen
Federzeichnungen wieder. „J'ai l'honneur", heisst
es in der Widmung, „de presenter a Votre Majeste
les Plans de la Maison de l'Opera qu' Elle a forme
Elle meme et dont il Lui a plu de me confier l'Exe-
cution."
Dennoch wäre es ein Irrtum, wie L. Schneider
gethan hat, zu folgern, „dass der König selbst die
Pläne entworfen". Es heisst keineswegs den Ruhm
des grossen Königs antasten, wenn man ihm eine
selbständige Durcharbeitung eines architektonischen
Gedankens nicht zutraut. Manger in der „Bau-
geschichte von Potsdam" (178p — 90, S. 542) weist
dem Könige den ihm zukommenden baukünstle-
rischen Anteil gerecht an, indem er berichtet:
„Die ersten vierzig Jahre Seiner Regierung war Er
Selbsterfinder und Vorzeichner der Aussenseiten zu
den erbauenden Schlössern, publiken, privat- und
ökonomischen Gebäuden von einiger Wichtigkeit,
ebenso als zur Verzierung und Meublierung der
inneren Gemächer in den Ihm besonders eigenen
Gebäuden; in den letzten Jahren nahm Er es hier-
innen nicht so genau." Man muss sich nur des
unbeholfenen Risses für die Anlage von Sanssouci
und seinen Terrassen von des Königs Hand erinnern,
um zu wissen, wie Friedrich seine Idee angab, und
was alles dem ausführenden Baumeister zu schaffen
blieb aus einem „plan que Sa Majeste a forme
Elle-meme".
Der Grundriss ist jedenfalls ganz Eigentum
KnobelsdorfFs. Ihm schwebte dabei ein grosser für
die königlichen Redouten bestimmter Saalbau vor,
in dem auch Oper stattfinden könnte. So sorgte
er dafür, dass Bühne und Parterre gleichmässiges
Niveau bekommen könnten, und dass der in einer
halben Ellipse angelegte Zuschauerraum mit der
Bühne einen einzigen grossen Saal ausmachte.
Diesem Riesensaal legte er einen kleineren vor, in
den der Hof sich zurückziehen und das Mahl ein-
nehmen könnte. Vier Ränge von zimmerartig
geschlossenen Logen stiegen übereinander auf, und
die Treppen dahinter wurden so breit und bequem
angelegt, dass man sich von Porteurs bis in den
obersten Rang hinauftragen lassen konnte. Der
Platz für den König war im Parterre, wo nur zwei
Reihen Sessel standen, während die königliche Loge
im ersten Rang der Königin und den Prinzessinnen
bestimmt blieb. Diese Loge hatte drehbare Wände,
die bei der Redoute fortgeschoben werden konnten
und eine freie Verbindung zum vorderen sog.
Apollonischen Saal öffneten. Ein weitgespannter
flacher Triumphbogen umschloss dieBühne. Das Pro-
scenium, der „Vordergrund", wie man es nannte,
trat mit gebogenen Seitenwänden weit vor. Corin-
thische Pilaster dienten als Gliederung. Nach weg-
geräumten Coulissen glich auch die Bühne einem
grossen Saal, den eine prachtvoll entfaltete Kolon-
nade umschloss. In der Rückwand zu beiden Seiten
der grossen Mittelthür öffneten sich Nischen, in
denen Najaden kleine Wasserstürze aus ihren Urnen
gössen. Sein Gegenstück fand dieser Raum in dem
vorderen apollonischen Saal; die grossen Fenster
wechselten mit Nischen, zwischen denenSatyrhermen
eine Galerie für die Zuschauer stützten. In den
Nischen standen Oefen mit Vasen darauf als wir-
kungsvolle Dekoration.
Hier im Innern des Opernhauses hat man die
beiden vornehmsten Elemente des Baustils von
Knobelsdorff beisammen: die Kolonnade, die in
allen seinen Entwürfen vom rheinsberger bis zum
dessauer Schloss vorkommt, und* die Satyrherme,
die auch an der Fa^ade von Sanssouci den Haupt-
schmuck bildet.
SCHLUSS IN DER NÄCHSTEN NUMMER
?»3
diese sauberen, dabei keineswegs malerisch reizlosen
Federzeichnungen wieder. „J'ai l'honneur", heisst
es in der Widmung, „de presenter a Votre Majeste
les Plans de la Maison de l'Opera qu' Elle a forme
Elle meme et dont il Lui a plu de me confier l'Exe-
cution."
Dennoch wäre es ein Irrtum, wie L. Schneider
gethan hat, zu folgern, „dass der König selbst die
Pläne entworfen". Es heisst keineswegs den Ruhm
des grossen Königs antasten, wenn man ihm eine
selbständige Durcharbeitung eines architektonischen
Gedankens nicht zutraut. Manger in der „Bau-
geschichte von Potsdam" (178p — 90, S. 542) weist
dem Könige den ihm zukommenden baukünstle-
rischen Anteil gerecht an, indem er berichtet:
„Die ersten vierzig Jahre Seiner Regierung war Er
Selbsterfinder und Vorzeichner der Aussenseiten zu
den erbauenden Schlössern, publiken, privat- und
ökonomischen Gebäuden von einiger Wichtigkeit,
ebenso als zur Verzierung und Meublierung der
inneren Gemächer in den Ihm besonders eigenen
Gebäuden; in den letzten Jahren nahm Er es hier-
innen nicht so genau." Man muss sich nur des
unbeholfenen Risses für die Anlage von Sanssouci
und seinen Terrassen von des Königs Hand erinnern,
um zu wissen, wie Friedrich seine Idee angab, und
was alles dem ausführenden Baumeister zu schaffen
blieb aus einem „plan que Sa Majeste a forme
Elle-meme".
Der Grundriss ist jedenfalls ganz Eigentum
KnobelsdorfFs. Ihm schwebte dabei ein grosser für
die königlichen Redouten bestimmter Saalbau vor,
in dem auch Oper stattfinden könnte. So sorgte
er dafür, dass Bühne und Parterre gleichmässiges
Niveau bekommen könnten, und dass der in einer
halben Ellipse angelegte Zuschauerraum mit der
Bühne einen einzigen grossen Saal ausmachte.
Diesem Riesensaal legte er einen kleineren vor, in
den der Hof sich zurückziehen und das Mahl ein-
nehmen könnte. Vier Ränge von zimmerartig
geschlossenen Logen stiegen übereinander auf, und
die Treppen dahinter wurden so breit und bequem
angelegt, dass man sich von Porteurs bis in den
obersten Rang hinauftragen lassen konnte. Der
Platz für den König war im Parterre, wo nur zwei
Reihen Sessel standen, während die königliche Loge
im ersten Rang der Königin und den Prinzessinnen
bestimmt blieb. Diese Loge hatte drehbare Wände,
die bei der Redoute fortgeschoben werden konnten
und eine freie Verbindung zum vorderen sog.
Apollonischen Saal öffneten. Ein weitgespannter
flacher Triumphbogen umschloss dieBühne. Das Pro-
scenium, der „Vordergrund", wie man es nannte,
trat mit gebogenen Seitenwänden weit vor. Corin-
thische Pilaster dienten als Gliederung. Nach weg-
geräumten Coulissen glich auch die Bühne einem
grossen Saal, den eine prachtvoll entfaltete Kolon-
nade umschloss. In der Rückwand zu beiden Seiten
der grossen Mittelthür öffneten sich Nischen, in
denen Najaden kleine Wasserstürze aus ihren Urnen
gössen. Sein Gegenstück fand dieser Raum in dem
vorderen apollonischen Saal; die grossen Fenster
wechselten mit Nischen, zwischen denenSatyrhermen
eine Galerie für die Zuschauer stützten. In den
Nischen standen Oefen mit Vasen darauf als wir-
kungsvolle Dekoration.
Hier im Innern des Opernhauses hat man die
beiden vornehmsten Elemente des Baustils von
Knobelsdorff beisammen: die Kolonnade, die in
allen seinen Entwürfen vom rheinsberger bis zum
dessauer Schloss vorkommt, und* die Satyrherme,
die auch an der Fa^ade von Sanssouci den Haupt-
schmuck bildet.
SCHLUSS IN DER NÄCHSTEN NUMMER
?»3