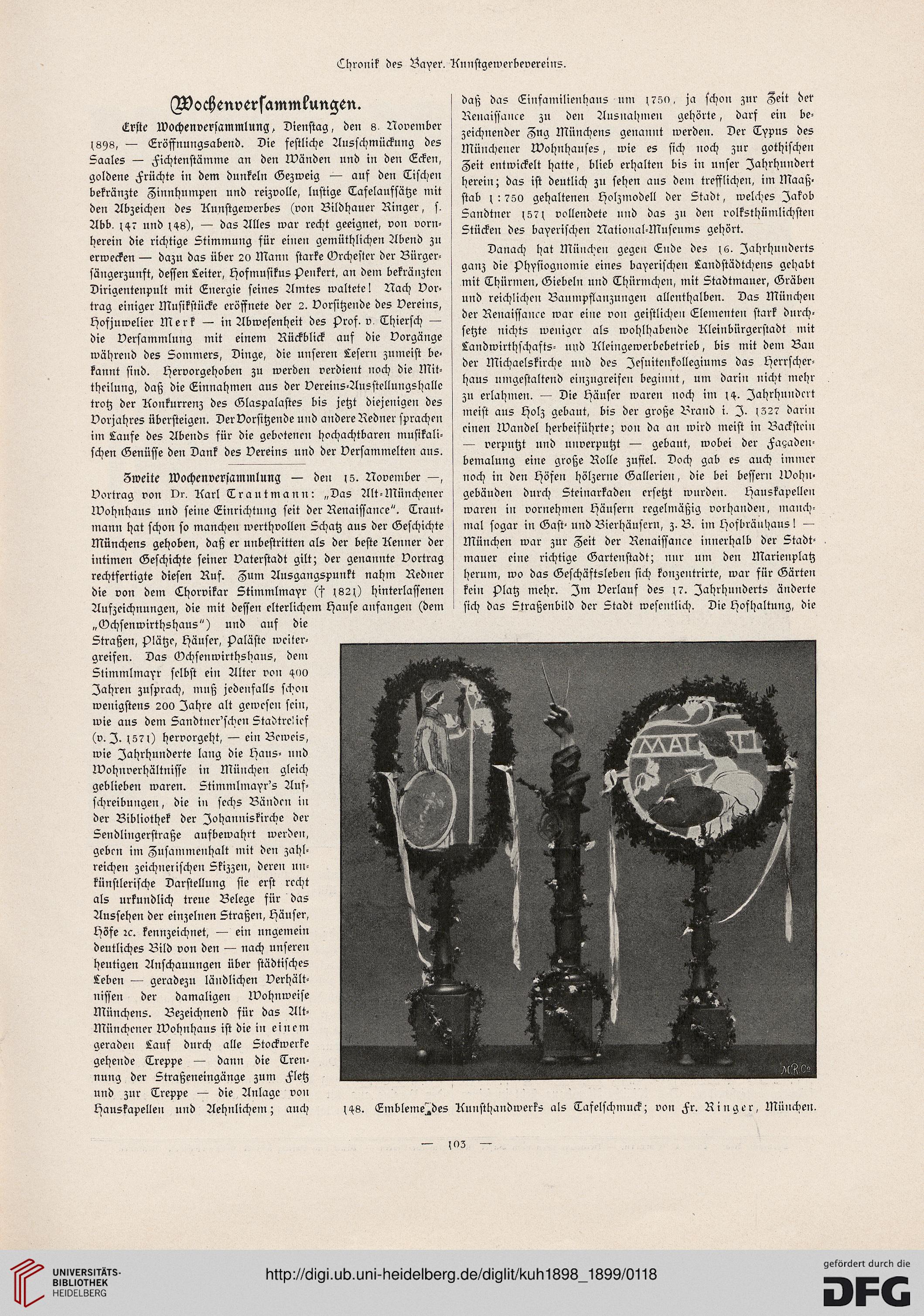(übrouif des Bayer. Annstgewerbevereins.
Mochenversammkungen.
Erste Ivochenversammlung, Dienstag, den 8. November
(898, — Lröffnungsabend. Die festliche Ausschmückung des
Saales — Fichtenstämme an den Wänden und in den Ecken,
goldene Früchte in dem dunkeln Gezweig — ans den Tischen
bekränzte Zinnhnmpen und reizvolle, lustige Tafelaufsätze mit
den Abzeichen des Runstgewerbes (von Bildhauer Ringer, f.
Abb. (-(7 und (-(8), — das Alles war recht geeignet, von vorn-
herein die richtige Stimmung für einen gemüthlichen Abend zu
erwecken — dazu das über 20 Mann starke Orchester der Bürgcr-
sängerzunft, dessen Leiter, pofmusikus Penkert, an dem bekränzten
Dirigentenpult mit Energie seines Amtes waltete! Nach Vor-
trag einiger Musikstücke eröffnete der 2. Vorsitzende des Vereins,
pofjuwelier Merk — in Abwesenheit des Prof. v Thiersch —
die Versammlung mit einem Rückblick auf die Vorgänge
während des Sommers, Dinge, die unseren Lesern zumeist be-
kannt sind, pervorgehoben zu werden verdient noch die Mit-
theilung, daß die Einnahmen aus der Vereins-Ausstellungshalle
trotz der Konkurrenz des Glaspalastes bis jetzt diejenigen des
Vorjahres übersteigen. Der Vorsitzende und andere Redner sprachen
im Laufe des Abends für die gebotenen hochachtbaren musikali-
schen Genüsse den Dank des Vereins und der versammelten aus.
Zweite wochenversammlung — den ,5. November —,
Vortrag von vr. Karl Trautmanu: „Das Alt-Münchener
Wohnhaus und seine Einrichtung seit der Renaissance". Traut-
mann hat schon so manchen werthvollen Schatz aus der Geschichte
Münchens gehoben, daß er unbestritten als der beste Renner der
intimen Geschichte seiner Vaterstadt gilt; der genannte Vortrag
rechtfertigte diesen Ruf. Zum Ausgangspunkt »ahm Redner
die von dein Ehorvikar Stimmlmayr (ff (82() hinterlaffenen
Aufzeichnungen, die mit dessen elterlichem Pause anfangen (dem
„Ochsenwirthshaus") und auf die
Straßen, Plätze, päuser, Paläste weiter-
greisen. Das Ochsenwirthshaus, deur
Stimmlmayr selbst ein Alter von 400
Jahren znsprach, muß jedenfalls schon
wenigstens 200 Jahre alt gewesen sein,
wie aus dem Sandtncr'schen Stadtrclief
(v.I. (57>) hervorgeht, — ein Beweis,
wie Jahrhunderte lang die paus- und
Wohnverhältnisse in München gleich
geblieben waren. Stimmlinayr's Aus-
schreibungen , die in sechs Bänden in
der Bibliothek der Johanniskircho der
Sendlingerstraße ausbewahrt werden,
geben im Zusammenhalt mit den zahl-
reichen zeichnerischen Skizzen, deren un-
künstlerische Darstellung sie erst recht
als urkundlich treue Belege für das
Aussehen der einzelnen Straßen, Käufer,
Päse rc. kennzeichnet, — ein ungemein
deutliches Bild von den — nach unseren
heutigen Anschauungen über städtisches
Leben — geradezu ländlichen Verhält-
nissen der damaligen Wohnweise
Münchens. Bezeichnend für das Alt-
Münchener Wohnhaus ist die in einem
geraden kauf durch alle Stockwerke
gehende Treppe — dann die Tren-
nung der Straßeneingänge zum Fletz
und zur Treppe — die Anlage von
Panskapellen und Aehnlichem; auch
daß das Einfamilienhaus um (750, ja schon zur Zeit der
Renaissance zu den Ausnahmen gehörte, darf ein be-
zeichnender Zug Münchens genannt werden. Der Typus des
Münchener Wohnhauses, wie es sich noch zur gothischen
Zeit entwickelt hatte, blieb erhalten bis in unser Jahrhundert
herein; das ist deutlich zu sehen aus dem trefflichen, im Maaß-
stab (: 750 gehaltenen polzmodell der Stadt, welches Jakob
Sandtner (57( vollendete und das zu den volksthümlichsten
Stücken des bayerischen Natioual-Museums gehört.
Danach hat München gegen Ende des (S. Jahrhunderts
ganz die Physiognomie eines bayerischen Landstädtchens gehabt
mit Thürmen, Giebeln und Thürmchen, mit Stadtmauer, Gräben
und reichlichen Baumpstanzungen allenthalben. Das München
der Renaissance war eine von geistlichen Elementen stark durch-
setzte nichts weniger als wohlhabende Aleinbürgerstadt mit
Landwirthschafts- und Rleingewerbebetrieb, bis mit dem Ban
der Michaelskirche und des Jesuitenkollegiums das perrscher-
haus umgestaltend einzugreifcn beginnt, um darin nicht mehr
zu erlahinen. — Die päuser waren noch im (4. Jahrhundert
meist aus polz gebaut, bis der große Brand i. I. (527 darin
einen Wandel herbciführte; von da an wird meist in Backstein
— verputzt und unverputzt — gebaut, wobei der Fa?aden-
bemalung eine große Rolle zufiel. Doch gab es auch immer
noch in den pöfen hölzerne Gallerien, die bei bessern Wohn-
gebäuden durch Steinarkaden ersetzt wurden. Pauskapellen
waren in vornehmen päusern regelmäßig vorhanden, mauch-
mal sogar in Gast- und Bierhäusern, z. B. iin pofbräuhaus I —
München war zur Zeit der Renaissance innerhalb der Stadt-
mauer eine richtige Gartenstadt; nur um den Marienplatz
herum, wo das Geschäftsleben sich konzentrirte, war für Gärten
kein Platz mehr. Im Verlauf des (7. Jahrhunderts änderte
sich das Straßenbild der Stadt wesentlich. Die Hofhaltung, die
(48. Emblenie.des Runsthandwerks als Tafelschmuck; von Fr. Ringer, München.
Mochenversammkungen.
Erste Ivochenversammlung, Dienstag, den 8. November
(898, — Lröffnungsabend. Die festliche Ausschmückung des
Saales — Fichtenstämme an den Wänden und in den Ecken,
goldene Früchte in dem dunkeln Gezweig — ans den Tischen
bekränzte Zinnhnmpen und reizvolle, lustige Tafelaufsätze mit
den Abzeichen des Runstgewerbes (von Bildhauer Ringer, f.
Abb. (-(7 und (-(8), — das Alles war recht geeignet, von vorn-
herein die richtige Stimmung für einen gemüthlichen Abend zu
erwecken — dazu das über 20 Mann starke Orchester der Bürgcr-
sängerzunft, dessen Leiter, pofmusikus Penkert, an dem bekränzten
Dirigentenpult mit Energie seines Amtes waltete! Nach Vor-
trag einiger Musikstücke eröffnete der 2. Vorsitzende des Vereins,
pofjuwelier Merk — in Abwesenheit des Prof. v Thiersch —
die Versammlung mit einem Rückblick auf die Vorgänge
während des Sommers, Dinge, die unseren Lesern zumeist be-
kannt sind, pervorgehoben zu werden verdient noch die Mit-
theilung, daß die Einnahmen aus der Vereins-Ausstellungshalle
trotz der Konkurrenz des Glaspalastes bis jetzt diejenigen des
Vorjahres übersteigen. Der Vorsitzende und andere Redner sprachen
im Laufe des Abends für die gebotenen hochachtbaren musikali-
schen Genüsse den Dank des Vereins und der versammelten aus.
Zweite wochenversammlung — den ,5. November —,
Vortrag von vr. Karl Trautmanu: „Das Alt-Münchener
Wohnhaus und seine Einrichtung seit der Renaissance". Traut-
mann hat schon so manchen werthvollen Schatz aus der Geschichte
Münchens gehoben, daß er unbestritten als der beste Renner der
intimen Geschichte seiner Vaterstadt gilt; der genannte Vortrag
rechtfertigte diesen Ruf. Zum Ausgangspunkt »ahm Redner
die von dein Ehorvikar Stimmlmayr (ff (82() hinterlaffenen
Aufzeichnungen, die mit dessen elterlichem Pause anfangen (dem
„Ochsenwirthshaus") und auf die
Straßen, Plätze, päuser, Paläste weiter-
greisen. Das Ochsenwirthshaus, deur
Stimmlmayr selbst ein Alter von 400
Jahren znsprach, muß jedenfalls schon
wenigstens 200 Jahre alt gewesen sein,
wie aus dem Sandtncr'schen Stadtrclief
(v.I. (57>) hervorgeht, — ein Beweis,
wie Jahrhunderte lang die paus- und
Wohnverhältnisse in München gleich
geblieben waren. Stimmlinayr's Aus-
schreibungen , die in sechs Bänden in
der Bibliothek der Johanniskircho der
Sendlingerstraße ausbewahrt werden,
geben im Zusammenhalt mit den zahl-
reichen zeichnerischen Skizzen, deren un-
künstlerische Darstellung sie erst recht
als urkundlich treue Belege für das
Aussehen der einzelnen Straßen, Käufer,
Päse rc. kennzeichnet, — ein ungemein
deutliches Bild von den — nach unseren
heutigen Anschauungen über städtisches
Leben — geradezu ländlichen Verhält-
nissen der damaligen Wohnweise
Münchens. Bezeichnend für das Alt-
Münchener Wohnhaus ist die in einem
geraden kauf durch alle Stockwerke
gehende Treppe — dann die Tren-
nung der Straßeneingänge zum Fletz
und zur Treppe — die Anlage von
Panskapellen und Aehnlichem; auch
daß das Einfamilienhaus um (750, ja schon zur Zeit der
Renaissance zu den Ausnahmen gehörte, darf ein be-
zeichnender Zug Münchens genannt werden. Der Typus des
Münchener Wohnhauses, wie es sich noch zur gothischen
Zeit entwickelt hatte, blieb erhalten bis in unser Jahrhundert
herein; das ist deutlich zu sehen aus dem trefflichen, im Maaß-
stab (: 750 gehaltenen polzmodell der Stadt, welches Jakob
Sandtner (57( vollendete und das zu den volksthümlichsten
Stücken des bayerischen Natioual-Museums gehört.
Danach hat München gegen Ende des (S. Jahrhunderts
ganz die Physiognomie eines bayerischen Landstädtchens gehabt
mit Thürmen, Giebeln und Thürmchen, mit Stadtmauer, Gräben
und reichlichen Baumpstanzungen allenthalben. Das München
der Renaissance war eine von geistlichen Elementen stark durch-
setzte nichts weniger als wohlhabende Aleinbürgerstadt mit
Landwirthschafts- und Rleingewerbebetrieb, bis mit dem Ban
der Michaelskirche und des Jesuitenkollegiums das perrscher-
haus umgestaltend einzugreifcn beginnt, um darin nicht mehr
zu erlahinen. — Die päuser waren noch im (4. Jahrhundert
meist aus polz gebaut, bis der große Brand i. I. (527 darin
einen Wandel herbciführte; von da an wird meist in Backstein
— verputzt und unverputzt — gebaut, wobei der Fa?aden-
bemalung eine große Rolle zufiel. Doch gab es auch immer
noch in den pöfen hölzerne Gallerien, die bei bessern Wohn-
gebäuden durch Steinarkaden ersetzt wurden. Pauskapellen
waren in vornehmen päusern regelmäßig vorhanden, mauch-
mal sogar in Gast- und Bierhäusern, z. B. iin pofbräuhaus I —
München war zur Zeit der Renaissance innerhalb der Stadt-
mauer eine richtige Gartenstadt; nur um den Marienplatz
herum, wo das Geschäftsleben sich konzentrirte, war für Gärten
kein Platz mehr. Im Verlauf des (7. Jahrhunderts änderte
sich das Straßenbild der Stadt wesentlich. Die Hofhaltung, die
(48. Emblenie.des Runsthandwerks als Tafelschmuck; von Fr. Ringer, München.