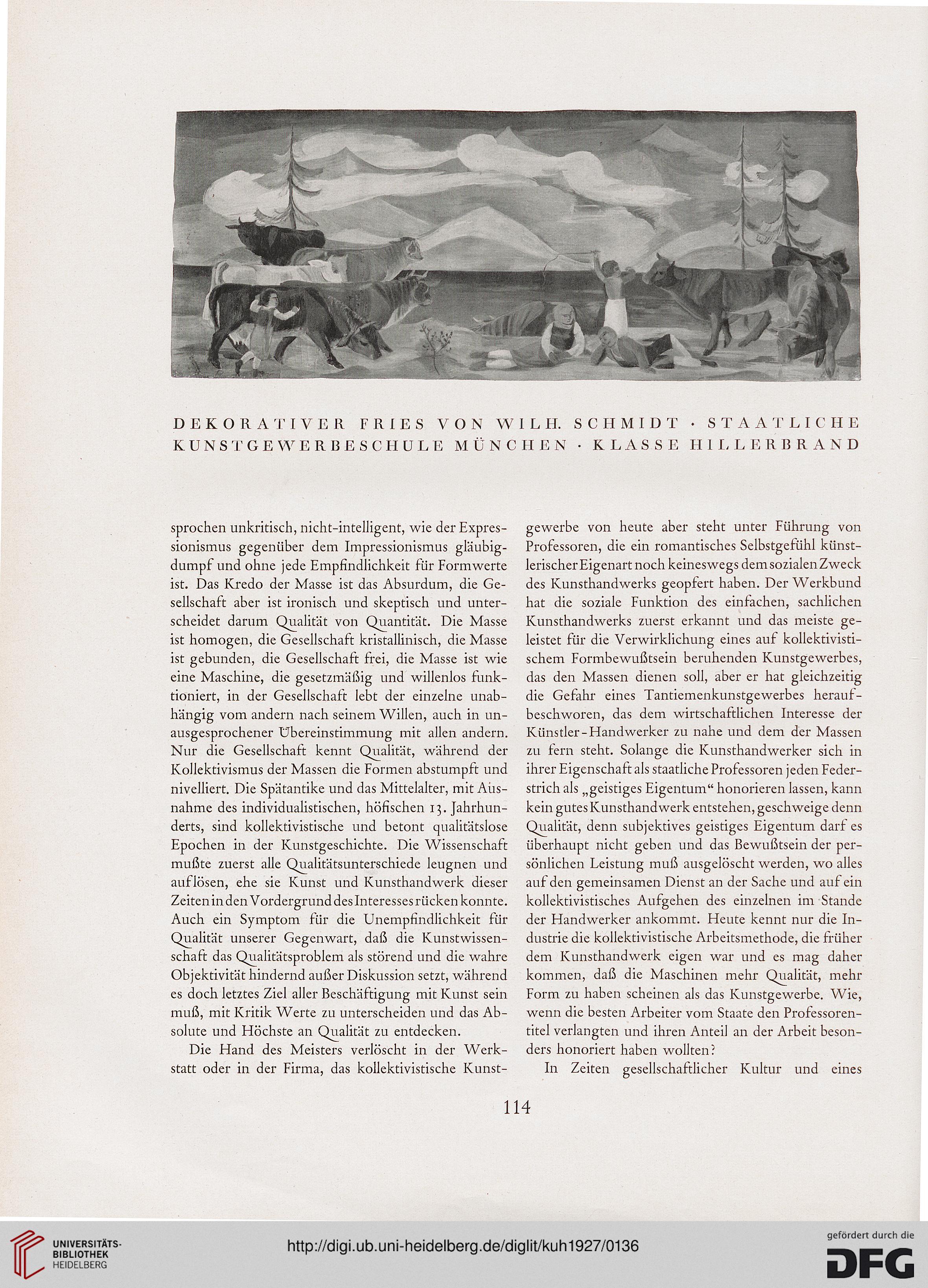DEKORATIVER FRIES VON W I LII. SCHMIDT • STAATLICHE
KUNSTGEWERBESCHULE MÜNCHEN • KLASSE HILLERBRAND
sprachen unkritisch, nicht-intelligent, wie der Expres-
sionismus gegenüber dem Impressionismus gläubig-
dumpf und ohne jede Empfindlichkeit für Formwerte
ist. Das Kredo der Masse ist das Absurdum, die Ge-
sellschaft aber ist ironisch und skeptisch und unter-
scheidet darum Qualität von Quantität. Die Masse
ist homogen, die Gesellschaft kristallinisch, die Masse
ist gebunden, die Gesellschaft frei, die Masse ist wie
eine Maschine, die gesetzmäßig und willenlos funk-
tioniert, in der Gesellschaft lebt der einzelne unab-
hängig vom andern nach seinem Willen, auch in un-
ausgesprochener Übereinstimmung mit allen andern.
Nur die Gesellschaft kennt Qualität, während der
Kollektivismus der Massen die Formen abstumpft und
nivelliert. Die Spätantike und das Mittelalter, mit Aus-
nahme des individualistischen, höfischen 13. Jahrhun-
derts, sind kollektivistische und betont qualitätslose
Epochen in der Kunstgeschichte. Die Wissenschaft
mußte zuerst alle Qualitätsunterschiede leugnen und
auflösen, ehe sie Kunst und Kunsthandwerk dieser
Zeiten in den Vordergrund des Interesses rücken konnte.
Auch ein Symptom für die Unempfindlichkeit für
Qualität unserer Gegenwart, daß die Kunstwissen-
schaft das Qualitätsproblem als störend und die wahre
Objektivität hindernd außer Diskussion setzt, während
es doch letztes Ziel aller Beschäftigung mit Kunst sein
muß, mit Kritik Werte zu unterscheiden und das Ab-
solute und Höchste an Qualität zu entdecken.
Die Hand des Meisters verlöscht in der Werk-
statt oder in der Firma, das kollektivistische Kunst-
gewerbe von heute aber steht unter Führung von
Professoren, die ein romantisches Selbstgefühl künst-
lerischer Eigenart noch keineswegs dem sozialen Zweck
des Kunsthandwerks geopfert haben. Der Werkbund
hat die soziale Funktion des einfachen, sachlichen
Kunsthandwerks zuerst erkannt und das meiste ge-
leistet für die Verwirklichung eines auf kollektivisti-
schem Formbewußtsein beruhenden Kunstgewerbes,
das den Massen dienen soll, aber er hat gleichzeitig
die Gefahr eines Tantiemenkunstgewerbes herauf-
beschworen, das dem wirtschaftlichen Interesse der
Künstler-Handwerker zu nahe und dem der Massen
zu fern steht. Solange die Kunsthandwerker sich in
ihrer Eigenschaft als staatliche Professoren jeden Feder-
strich als „geistiges Eigentum“ honorieren lassen, kann
kein gutes Kunsthandwerk entstehen, geschweige denn
Qualität, denn subjektives geistiges Eigentum darf es
überhaupt nicht geben und das Bewußtsein der per-
sönlichen Leistung muß ausgelöscht werden, wo alles
auf den gemeinsamen Dienst an der Sache und auf ein
kollektivistisches Aufgehen des einzelnen im Stande
der Handwerker ankommt. Heute kennt nur die In-
dustrie die kollektivistische Arbeitsmethode, die früher
dem Kunsthandwerk eigen war und es mag daher
kommen, daß die Maschinen mehr Qualität, mehr
Form zu haben scheinen als das Kunstgewerbe. Wie,
wenn die besten Arbeiter vom Staate den Professoren-
titel verlangten und ihren Anteil an der Arbeit beson-
ders honoriert haben wollten?
In Zeiten gesellschaftlicher Kultur und eines
114
KUNSTGEWERBESCHULE MÜNCHEN • KLASSE HILLERBRAND
sprachen unkritisch, nicht-intelligent, wie der Expres-
sionismus gegenüber dem Impressionismus gläubig-
dumpf und ohne jede Empfindlichkeit für Formwerte
ist. Das Kredo der Masse ist das Absurdum, die Ge-
sellschaft aber ist ironisch und skeptisch und unter-
scheidet darum Qualität von Quantität. Die Masse
ist homogen, die Gesellschaft kristallinisch, die Masse
ist gebunden, die Gesellschaft frei, die Masse ist wie
eine Maschine, die gesetzmäßig und willenlos funk-
tioniert, in der Gesellschaft lebt der einzelne unab-
hängig vom andern nach seinem Willen, auch in un-
ausgesprochener Übereinstimmung mit allen andern.
Nur die Gesellschaft kennt Qualität, während der
Kollektivismus der Massen die Formen abstumpft und
nivelliert. Die Spätantike und das Mittelalter, mit Aus-
nahme des individualistischen, höfischen 13. Jahrhun-
derts, sind kollektivistische und betont qualitätslose
Epochen in der Kunstgeschichte. Die Wissenschaft
mußte zuerst alle Qualitätsunterschiede leugnen und
auflösen, ehe sie Kunst und Kunsthandwerk dieser
Zeiten in den Vordergrund des Interesses rücken konnte.
Auch ein Symptom für die Unempfindlichkeit für
Qualität unserer Gegenwart, daß die Kunstwissen-
schaft das Qualitätsproblem als störend und die wahre
Objektivität hindernd außer Diskussion setzt, während
es doch letztes Ziel aller Beschäftigung mit Kunst sein
muß, mit Kritik Werte zu unterscheiden und das Ab-
solute und Höchste an Qualität zu entdecken.
Die Hand des Meisters verlöscht in der Werk-
statt oder in der Firma, das kollektivistische Kunst-
gewerbe von heute aber steht unter Führung von
Professoren, die ein romantisches Selbstgefühl künst-
lerischer Eigenart noch keineswegs dem sozialen Zweck
des Kunsthandwerks geopfert haben. Der Werkbund
hat die soziale Funktion des einfachen, sachlichen
Kunsthandwerks zuerst erkannt und das meiste ge-
leistet für die Verwirklichung eines auf kollektivisti-
schem Formbewußtsein beruhenden Kunstgewerbes,
das den Massen dienen soll, aber er hat gleichzeitig
die Gefahr eines Tantiemenkunstgewerbes herauf-
beschworen, das dem wirtschaftlichen Interesse der
Künstler-Handwerker zu nahe und dem der Massen
zu fern steht. Solange die Kunsthandwerker sich in
ihrer Eigenschaft als staatliche Professoren jeden Feder-
strich als „geistiges Eigentum“ honorieren lassen, kann
kein gutes Kunsthandwerk entstehen, geschweige denn
Qualität, denn subjektives geistiges Eigentum darf es
überhaupt nicht geben und das Bewußtsein der per-
sönlichen Leistung muß ausgelöscht werden, wo alles
auf den gemeinsamen Dienst an der Sache und auf ein
kollektivistisches Aufgehen des einzelnen im Stande
der Handwerker ankommt. Heute kennt nur die In-
dustrie die kollektivistische Arbeitsmethode, die früher
dem Kunsthandwerk eigen war und es mag daher
kommen, daß die Maschinen mehr Qualität, mehr
Form zu haben scheinen als das Kunstgewerbe. Wie,
wenn die besten Arbeiter vom Staate den Professoren-
titel verlangten und ihren Anteil an der Arbeit beson-
ders honoriert haben wollten?
In Zeiten gesellschaftlicher Kultur und eines
114