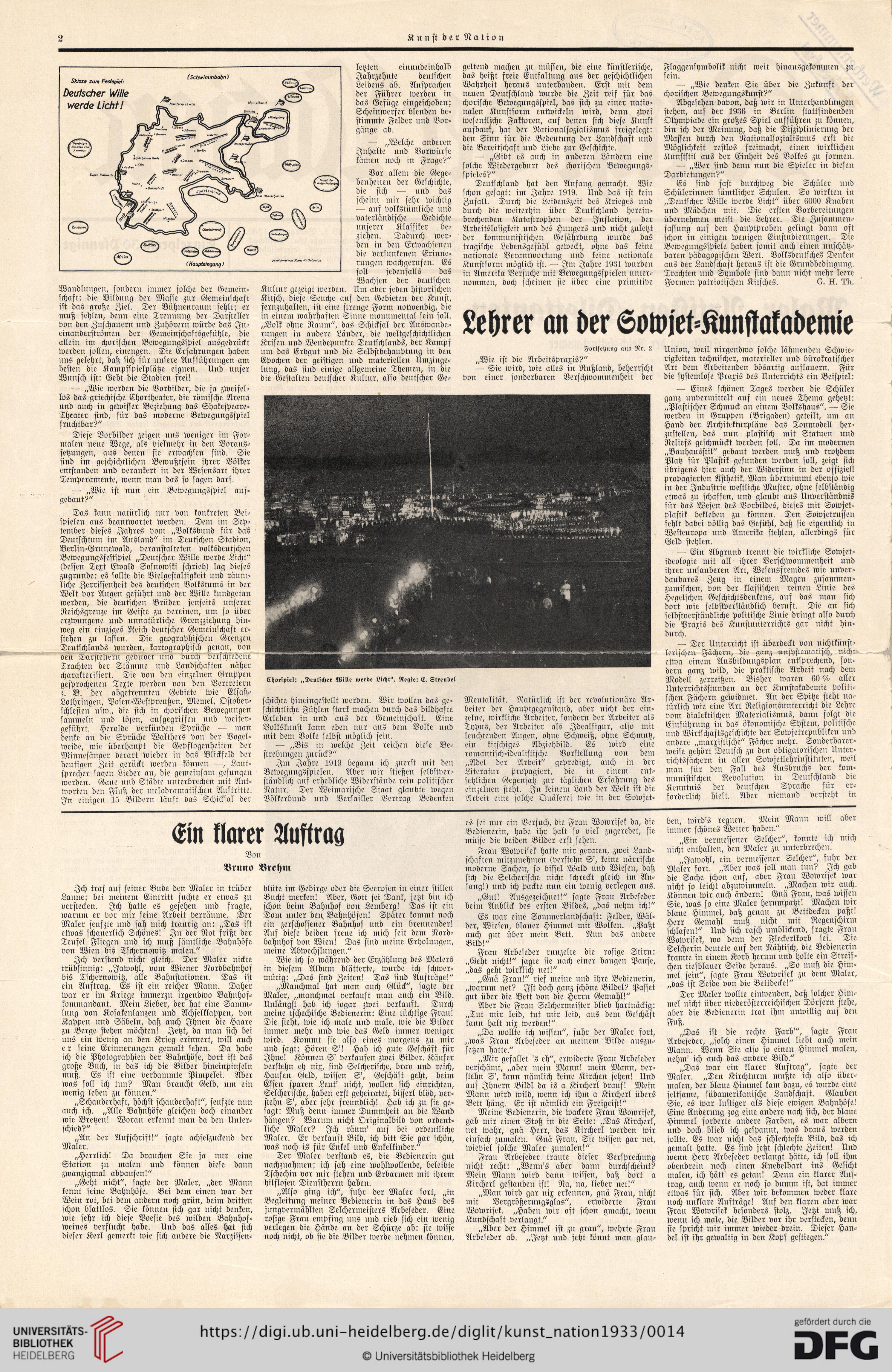2
Kunst der Nation
Wandlungen, sondern immer solche der Gemein-
schaft; die Bildung der Masse zur Gemeinschaft
ist das große Ziel. Der Bühnenraum fehlt; er
muß fehlen, denn eine Trennung der Darsteller
von den Zuschauern und Zuhörern würde das Jn-
eiuanderströmen der Gemeinschaftsgefühle, die
allein im chorischen Bewegungsspiel ausgedrückt
werden sollen, einengen. Die Erfahrungen haben
uns gelehrt, daß sich für unsere Aufführungen am
besten die Kampfspielplätze eignen. Und unser
Wunsch ist: Gebt die Stadien frei!
— „Wie werden die Vorbilder, die ja zweifel-
los das griechische Chortheater, die römische Arena
und auch in gewisser Beziehung das Shakespeare-
Theater sind, für das moderne Bewegungsspiel
fruchtbar?"
Diese Vorbilder zeigen uns weniger im For-
malen neue Wege, als vielmehr in den Voraus-
setzungen, aus denen sie erwachsen sind. Sie
sind im geschichtlichen Bewußtsein ihrer Völker
entstanden und verankert in der Wesensart ihrer
Temperamente, wenn man das so sagen darf.
— „Wie ist nun ein Bewcgungsspiel auf-
gebaut?"
Das kann natürlich nur von konkreten Bei-
spielen aus beantwortet werden. Dem im Sep-
tember dieses Jahres vom „Volksbund für das
Deutschtum im Ausland" im Deutschen Stadion,
Berlin-Grunewald, veranstalteten Volksdeutschen
Bewegungsfestspiel „Deutscher Wille werde Licht"
(dessen Text Ewald Sosnowski schrieb) lag dieses
zugrunde: es sollte die Vielgestaltigkeit und räum-
liche Zerrissenheit des deutschen Volkstums in der
Welt vor Augen geführt und der Wille kuudgetan
werden, die deutschen Brüder jenseits unserer
Reichsgrenze im Geiste zu vereinen, um so über
erzwungene und unnatürliche Grenzziehung hin-
weg ein einziges Reich deutscher Gemeinschaft er-
stehen zu lassen. Die geographischen Grenzen
Deutschlands wurden, kartographisch genau, von
oen Darsl'eNern gevuocr uuo ourn; verschiedene
Trachten der Stämme und Landschaften näher
charakterisiert. Die von den einzelnen Gruppen
gesprochenen Texte werden von den Vertretern
z. B. der abgetrennten Gebiete wie Elsaß-
Lothringen, Posen-Westpreußen, Memel, Ostober-
schlesien usw., die sich in chorischen Bewegungen
sammeln und lösen, aufgegriffen und weiter-
geführt. Herolde verkünden Sprüche — man
denke an die Sprüche Walthers von der Bogel-
Weide, wie überhaupt die Gepflogenheiten der
Minnesänger derart wieder in das Blickfeld der
heutigen Zeit gerückt werden können —, Laut-
sprecher sagen Lieder an, die gemeinsam gesungen
werden. Gaue und Städte unterbrechen mit Ant-
worten den Fluß der melodramatischen Auftritte.
In einigen 1ö Bildern läuft das Schicksal der
letzten einundeinhalb
Jahrzehnte deutschen
Leidens ab. Ansprachen
der Führer werden in
das Gefüge eingeschoben;
Scheinwerfer blenden be-
stimmte Felder und Vor-
gänge ab.
— „Welche anderen
Inhalte und Borwürfe
kämen noch in Frage?"
Vor allem die Gege-
benheiten der Geschichte,
die sich -— und das
scheint mir sehr wichtig
— auf volkstümliche und
vaterländische Gedichte
unserer Klassiker be-
ziehen. Dadurch wer-
den in den Erwachsenen
die versunkenen Erinne-
rungen wachgerufen. Es
soll jedenfalls das
Wachsen der deutschen
Kultur gezeigt werden. Um aber jeden historischen
Kitsch, diese Seuche auf den Gebieten der Kunst,
fernzuhalten, ist eine strenge Form notwendig, die
in einem wahrhaften Sinne monumental sein soll.
„Volk ohne Raum", das Schicksal der Auswande-
rungen in andere Länder, die weltgeschichtlichen
Krisen und Wendepunkte Deutschlands, der Kampf
um das Erbgut rind die Selbstbehauptung in den
Epochen der geistigen und materiellen Umzinge-
lung, das sind einige allgemeine Themen, in die
die Gestalten deutscher Kultur, also deutscher Ge-
schichte hineingestellt werden. Wir wollen das ge-
schichtliche Fühlen stark machen durch das bildhafte
Erleben in und aus der Gemeinschaft. Eine
Volkskunst kann eben nur aus dem Volke und
mit dem Volke selbst möglich sein.
— „Bis in welche Zeit reichen diese Be-
strebungen zurück?"
Im Jahre 1919 beganu ich zuerst mit den
Bewegungsspielen. Aber wir stießen selbstver-
ständlich auf erhebliche Widerstände rein Politischer
Natur. Der Weimarische Staat glaubte wegen
Völkerbund und Versailler Vertrag Bedenken
geltend machen zu müssen, die eine künstlerische,
das heißt freie Entfaltung aus der geschichtlichen
Wahrheit heraus unterbanden. Erst mit dem
neuen Deutschland wurde die Zeit reif für das
chorische Beweguugsspiel, das sich zu einer natio-
nalen Kunstform entwickeln wird, denn zwei
wesentliche Faktoren, auf denen sich diese Kunst
aufbanr, hat der Nationalsozialismus freigelegt:
den Sinn für die Bedeutung der Landschaft und
die Bereitschaft und Liebe zur Geschichte.
— „Gibt es auch in anderen Ländern eine
solche Wiedergeburt des chorischen Bewegungs-
spieles?"
Deutschland hat den Anfang gemacht. Wie
schon gesagt: im Jahre 1919. Und das ist kein
Zufall. Durch die Leidenszeit des Krieges und
durch die weiterhin über Deutschland herein-
brechenden Katastrophen der Inflation, der
Arbeitslosigkeit und des Hungers und nicht zuletzt
der kommunistischen Gefährdung wurde das
tragische Lebensgefühl geweckt, ohne das keine
nationale Verantwortung und keine nationale
Kunstform möglich ist. — Im Jahre 1931 wurden
in Amerika Versuche mit Bewegungsspielen unter-
nommen, doch scheinen sie über eine primitive
Fortsetzung aus Nr. 2
„Wie ist die Arbeitspraxis?"
— Sie wird, wie alles in Rußland, beherrscht
von einer sonderbaren Verschwommenheit der
Mentalität. Natürlich ist der revolutionäre Ar-
beiter der Hanptgcgenstand, aber nicht der ein-
zelne, wirkliche Arbeiter, sondern der Arbeiter als
Typus, der Arbeiter als Idealfigur, also mit
leuchtenden Augen, ohne Schweiß, ohne Schmutz,
ein kitschiges Abziehbild. Es wird eine
romantisch-idealistische Vorstellung von dem
„Adel der Arbeit" gepredigt, auch in der
Literatur propagiert, die in einem ent-
setzlichen Gegensatz zur täglichen Erfahrung des
einzelnen steht. In keinem Land der Welt ist die
Arbeit eine solche Quälerei wie in der Sowjet-
Flaggensymbolik nicht weit hinausgekommen zu
sein.
—- „Wie denken Sie über die Zukunft der
chorischen Bewegungskunst?"
Abgesehen davon, daß wir in Unterhandlungen
stehen, auf der 1936 in Berlin stattfindenden
Olympiade ein großes Spiel aufführen zu können,
bin ich der Meinung, daß die Disziplinierung der
Massen durch den Nationalsozialismus erst die
Möglichkeit restlos freimacht, einen wirklichen
Kunststil aus der Einheit des Volkes zu formen.
— „Wer sind denn nun die Spieler in diesen
Darbietungen?"
Es sind fast durchweg die Schüler und
Schülerinnen sämtlicher Schulen. So wirkten in
„Deutscher Wille werde Licht" über 6000 Knaben
und Mädchen mit. Die ersten Vorbereitungen
übernehmen meist die Lehrer. Die Zusammen-
fassung auf den Hauptproben gelingt dann oft
schon in einigen wenigen Einstudierungen. Die
Bewegungsspiele haben somit auch einen unschätz-
baren Pädagogischen Wert. Volksdeutsches Denken
aus der Landschaft heraus ist die Grundbedingung.
Trachten und Symbole sind dann nicht mehr leere
Formen Patriotischen Kitsches. 6. U. Mn
Union, weil nirgendwo solche lähmenden Schwie-
rigkeiten technischer, materieller und bürokratischer
Art dem Arbeitenden bösartig auflauern. Für
die systemlose Praxis des Unterrichts ein Beispiel:
— Eines schönen Tages werden die Schüler
ganz unvermittelt auf ein neues Thema gehetzt:
„Plastischer Schmuck an einem Bolkshaus". — Sie
werden in Gruppen (Brigaden) geteilt, um an
Hand der Architekturpläne das Tonmodell her-
zustellen, das nun plastisch mit Statuen und
Reliefs geschmückt werden soll. Da im modernen
„Bauhausstil" gebaut werden muß und trotzdem
Platz für Plastik gefunden werden soll, zeigt sich
übrigens hier auch der Widersinn in der offiziell
propagierten Ästhetik. Man übernimmt ebenso wie
in der Industrie westliche Muster, ohne selbständig
etwas zu schaffen, und glaubt aus Unverständnis
für das Wesen des Vorbildes, dieses mit Sowjet-
plastik bekleben zu können. Den Sowjetrussen
fehlt dabei völlig das Gefühl, daß sie eigentlich in
Westeuropa und Amerika stehlen, allerdings für
Geld stehlen.
— Ein Abgrund trennt die wirkliche Sowjet-
ideologie mit all ihrer Verschwommenheit und
ihrer unsauberen Art, Wesensfremdes wie unver-
daubares Zeug in einem Magen zusammen-
zumischen, von der klassischen reinen Linie des
Hegelschen Geschichtsdenkens, auf das man sich
dort wie selbstverständlich beruft. Die an sich
selbstverständliche politische Linie dringt also durch
die Praxis des Kunstunterrichts gar nicht hin-
durch.
— Der Unterricht ist überdeckt von nichtkünst-
lerischen Fächern, die ganz nnshstematisch, nicht
etwa einem Ausbildungsplan entsprechend, son-
dern ganz wild, die Praktische Arbeit nach dem
Modell zerreißen. Bisher waren 60 Ä> aller
Unterrichtsstunden an der Kunstakademie politi-
schen Fächern gewidmet. An der Spitze steht na-
türlich wie eine Art Religionsunterricht die Lehre
vom dialektischen Materialismus, dann folgt die
Einführung in das ökonomische System, Politische
und Wirtschaftsgeschichte der Sowjetrepubliken und
andere „marxistische" Fächer mehr. Sonderbarer-
weise gehört Deutsch zu den obligatorischen Unter-
richtsfächern in allen Sowjetlehrinstituten, weil
man für den Fall des Ausbruchs der kom-
munistischen Revolution in Deutschland die
Kenntnis der deutschen Sprache für er-
forderlich hielt. Aber niemand versteht in
Chorspiel: „Deutscher Wille werde Licht". Regie: E. Streubel
Lehrer an der Sowjet-Kunstakademie
Ein klarer Auftrag
Bon
Bruno Brehm
Ich traf auf seiner Bude den Maler in trüber
Laune; bei meinem Eintritt suchte er etwas zu
verstecken. Ich hatte es gesehen und fragte,
warum er vor mir seine Arbeit verräume. Der
Maler seufzte und sah mich traurig an: „Das ist
etwas schauerlich Schönes! In der Not frißt der
Teufel Fliegen und ich muß sämtliche Bahnhöfe
von Wien bis Tschernowitz malen."
Ich verstand nicht gleich. Der Maler nickte
trübsinnig: „Jawohl, vom Wiener Nordbahnhof
bis Tschernowitz, alle Bahnstationen. Das ist
ein Auftrag. Es ist ein reicher Mann. Daher
war er im Kriege immerzu irgendwo Bahnhof-
kommandant. Mein Lieber, der hat eine Samm-
lung von Kosakenlanzen und Achselklappen, von
Kappen und Säbeln, daß auch Ihnen die Haare
zu Berge stehen möchten! Jetzt, da man sich bei
uns ein wenig an den Krieg erinnert, will auch
er seine Erinnerungen gemalt sehen. Da habe
ich die Photographien der Bahnhöfe, dort ist das
große Buch, in das ich die Bilder hineinpinseln
muß. Es ist eine verdammte Pimpelei. Aber
was soll ich tun? Man braucht Geld, um ein
wenig leben zu können."
„Schauderhaft, höchst schauderhaft", seufzte nun
auch ich. „Alle Bahnhöfe gleichen doch einander
wie Bretzen! Woran erkennt man da den Unter-
schied?"
„An der Aufschrift!" sagte achselzuckend der
Maler.
„Herrlich! Da brauchen Sie ja nur eine
Station zu malen und können diese dann
zwanzigmal abpansen!"
„Geht nicht", sagte der Maler, „der Mann
kennt seine Bahnhöfe. Bei dem einen war der
Wein rot, bei dem andern noch grün, beim dritten
schon blattlos. Sie können sich gar nicht denken,
wie sehr ich diese Poesie des wilden Bahnhof-
weines verflucht habe. Und das alles hat sich
dieser Kerl gemerkt wie sich andere die Narzissen-
blüte im Gebirge oder die Seerosen in einer stillen
Bucht merken! Aber, Gott sei Dank, jetzt bin ich
schon beim Bahnhof von Leniberg! Das ist ein
Dom nnter den Bahnhöfen! Später kommt noch
ein zerschossener Bahnhof und ein brennender!
Auf diese beiden freue ich mich seit dem Nord-
bahnhof von Wien! Das sind meine Erholungen,
meine Abwechslungen."
Wie ich so während der Erzählung des Malers
in diesem Album blätterte, wurde ich schwer-
mütig: „Das sind Zeiten! Das sind Aufträge!"
„Manchmal hat man auch Glück", sagte der
Maler, „manchmal verkauft man auch ein Bild.
Unlängst hab ich sogar zwei verkauft. Durch
meine tschechische Bedienerin: Eine tüchtige Frau!
Die sieht, wie ich male und male, wie die Bilder
immer mehr und wie das Geld immer weniger
wird. Kommt sie also eines morgens zu mir
und sagt: Hören S'! Hab ich gute Geschäft für
Ihne! Können S' verkaufen zwei Bilder. Käufer
verstehn eh nix, sind Selchcrische, brav und reich,
Haufen Geld, wissen S', Geschäft geht, beim
Essen sparen Leut' nicht, wollen sich einrichten,
Selcherische, haben erst geheiratet, bisserl blöd, ver-
stehn S', aber sehr freundlich! Hab ich zu sie ge-
sagt: Muß denn immer Dummheit an die Wand
hängen? Warum nicht Originalbild von ordent-
liche Maler? Ich räum' auf bei ordentliche
Maler. Er verkauft Bild, ich bitt Sie gar schön,
was noch is für Enkel und Enkelkinder."
Der Maler verstand es, die Bedienerin gut
nachzuahmen; ich sah eine wohlwollende, beleibte
Tschechin vor mir stehen und Erbarmen mit ihrem
hilflosen Dienstherrn haben.
„Also ging ich", fuhr der Maler fort, „in
Begleitung meiner Bedienerin in das Haus des
jungvermählten Selchermeisters Arbeseder. Eine
rosige Frau empfing uns und rieb sich ein wenig
verlegen die Hände an der Schürze ab: sie wisse
noch nicht, ob sie die Bilder werde nehmen können,
es sei nur ein Versuch, die Frau Wowrisek da, die
Bedienerin, habe ihr halt so viel zugcredet, sie
müsse die beiden Bilder erst sehen.
Frau Wowrisek hatte mir geraten, zwei Land-
schaften mitzunehmeu (verstehn S', keine närrische
moderne Sachen, so bissel Wald und Wiesen, daß
sich die Selchcrische nicht schreckt gleich im An-
fang!) und ich packte nun ein wenig verlegen aus.
„Gut! Ausgezeichnet!" sagte Frau Arbeseder
beim Anblick des ersten Bildes, „das nehm ich!"
Es war eine Sommcrlandschaft: Felder, Wäl-
der, Wiesen, blauer Himmel mit Wolken. „Paßt
auch gut über mein Bett. Nun das andere
Bild!"
Frau Arbeseder runzelte die rosige Stirn:
„Geht nicht!" sagte sie nach einer bangen Panse,
„das geht wirklich net!"
„Gnä Frau!" rief meine und ihre Bedienerin,
„warum net? Ist doch ganz schöne Bilde!? Passet
gut über die Bett von die Herrn Gemahl!"
Aber die Frau Selchermeister blieb hartnäckig:
„Tut mir leid, tut mir leid, aus dem Geschäft
kann halt nix werden!"
„Da wollte ich wissen", fuhr der Maler fort,
„was Frau Arbeseder an meinem Bilde auszu-
setzen hatte."
„Mir gefallet 's eh", erwiderte Fran Arbeseder
verschämt, „aber mein Mann! mein Mann, ver-
stehn S', kann nämlich keine Kirchen sehen! Und
auf Jhnern Bild! da is a Kircherl drauf! Mein
Mann wird wild, wenn ich ihm a Kircherl übers
Bett häng. Er ist nämlich ein Freigeist!"
Meine Bedienerin, die wackere Frau Wowrisek,
gab mir einen Stoß in die Seite: „Das Kircherl,
net wahr, gnä Herr, das Kircherl werden wir
einfach zumalen. Gnä Frau, Sie wissen gar net,
wieviel solche Maler zumalen!"
Frau Arbeseder traute dieser Versprechung
nicht recht: „Wenn's aber dann durchscheint?
Mein Mann wird dann wissen, daß dort a
Kircherl gestanden ist! Na, na, lieber net!"
„Man wird gar nix erkennen, gnä Frau, nicht
mit Vergrößerungsglas", erwiderte Frau
Wowrisek. „Haben wir oft schon gmacht, wenn
Kundschaft verlangt."
„Aber der Himmel ist zu grau", wehrte Frau
Arbeseder ab. „Jetzt und jetzt könnt man glau-
ben, wird's regnen. Mein Mann will aber
immer schönes Wetter haben."
„Ein vermessener Selcher", konnte ich mich
nicht enthalten, den Maler zu unterbrechen.
„Jawohl, ein vermessener Selcher", fuhr der
Maler fort. „Aber was soll man tun? Ich gab
die Sache schon auf, aber Frau Wowrisek war
nicht so leicht abzuwimmeln. „Machen wir auch.
Können wir auch ändern! Gnä Frau, was wissen
Sie, was so eine Maler herumpatzt! Machen wir
blaue Himmel, daß genau zu Bettdecken paßt!
Herr Gemahl muß nicht mit Regenschirm
schlafen!" Und sich rasch umblickend, fragte Fran
Wowrisek, wo denn der Fleckerlkorb sei. Die
Selcherin deutete auf den Nähtisch, die Bedienerin
kramte in einem Korb herum und holte ein Streif-
chen tiefblauer Seide heraus. „So muß die Him-
mel sein", sagte Frau Wowrisek zu dem Maler,
„das ist Seide von die Bettdecke!"
Der Maler wollte einwenden, daß solcher Him-
mel nicht über niederösterreichischen Dörfern stehe,
aber die Bedienerin trat ihm unwillig auf den
Fuß.
„Das ist die rechte Färb'", sagte Frau
Arbeseder, „solch einen Himmel liebt auch mein
Mann. Wenn Sie also so einen Himmel malen,
nehm' ich auch das andere Bild."
„Das war ein klarer Auftrag", sagte der
Maler. „Den Kirchturm mußte ich also über-
malen, der blaue Himmel kam dazu, es wurde eine
seltsame, südamerikanische Landschaft. Glauben
Sie, es war lustiger als diese ewigen Bahnhöfe!
Eine Änderung zog eine andere nach sich, der blaue
Himmel forderte andere Farben, es war albern
und doch blieb ich gespannt, was draus werden
sollte. Es war nicht das schlechteste Bild, das ich
gemalt hatte. Es sind jetzt schlechte Zeiten! Und
wenn Herr Arbeseder verlangt hätte, ich soll ihm
obendrein noch einen Knebelbart ins Gesicht
malen, ich hätt' es getan! Denn ein klarer Auf-
trag, auch wenn er noch so dumm ist, hat immer
etwas für sich. Aber wir bekommen weder klare
noch unklare Aufträge! Auf den klaren aber war
Frau Wowrisek besonders stolz. Jetzt muß ich,
wenn ich male, die Bilder vor ihr verstecken, denn
sie spricht mir immer wieder drein. Dieser Han-
del ist ihr gewaltig in den Kopf gestiegen."
Kunst der Nation
Wandlungen, sondern immer solche der Gemein-
schaft; die Bildung der Masse zur Gemeinschaft
ist das große Ziel. Der Bühnenraum fehlt; er
muß fehlen, denn eine Trennung der Darsteller
von den Zuschauern und Zuhörern würde das Jn-
eiuanderströmen der Gemeinschaftsgefühle, die
allein im chorischen Bewegungsspiel ausgedrückt
werden sollen, einengen. Die Erfahrungen haben
uns gelehrt, daß sich für unsere Aufführungen am
besten die Kampfspielplätze eignen. Und unser
Wunsch ist: Gebt die Stadien frei!
— „Wie werden die Vorbilder, die ja zweifel-
los das griechische Chortheater, die römische Arena
und auch in gewisser Beziehung das Shakespeare-
Theater sind, für das moderne Bewegungsspiel
fruchtbar?"
Diese Vorbilder zeigen uns weniger im For-
malen neue Wege, als vielmehr in den Voraus-
setzungen, aus denen sie erwachsen sind. Sie
sind im geschichtlichen Bewußtsein ihrer Völker
entstanden und verankert in der Wesensart ihrer
Temperamente, wenn man das so sagen darf.
— „Wie ist nun ein Bewcgungsspiel auf-
gebaut?"
Das kann natürlich nur von konkreten Bei-
spielen aus beantwortet werden. Dem im Sep-
tember dieses Jahres vom „Volksbund für das
Deutschtum im Ausland" im Deutschen Stadion,
Berlin-Grunewald, veranstalteten Volksdeutschen
Bewegungsfestspiel „Deutscher Wille werde Licht"
(dessen Text Ewald Sosnowski schrieb) lag dieses
zugrunde: es sollte die Vielgestaltigkeit und räum-
liche Zerrissenheit des deutschen Volkstums in der
Welt vor Augen geführt und der Wille kuudgetan
werden, die deutschen Brüder jenseits unserer
Reichsgrenze im Geiste zu vereinen, um so über
erzwungene und unnatürliche Grenzziehung hin-
weg ein einziges Reich deutscher Gemeinschaft er-
stehen zu lassen. Die geographischen Grenzen
Deutschlands wurden, kartographisch genau, von
oen Darsl'eNern gevuocr uuo ourn; verschiedene
Trachten der Stämme und Landschaften näher
charakterisiert. Die von den einzelnen Gruppen
gesprochenen Texte werden von den Vertretern
z. B. der abgetrennten Gebiete wie Elsaß-
Lothringen, Posen-Westpreußen, Memel, Ostober-
schlesien usw., die sich in chorischen Bewegungen
sammeln und lösen, aufgegriffen und weiter-
geführt. Herolde verkünden Sprüche — man
denke an die Sprüche Walthers von der Bogel-
Weide, wie überhaupt die Gepflogenheiten der
Minnesänger derart wieder in das Blickfeld der
heutigen Zeit gerückt werden können —, Laut-
sprecher sagen Lieder an, die gemeinsam gesungen
werden. Gaue und Städte unterbrechen mit Ant-
worten den Fluß der melodramatischen Auftritte.
In einigen 1ö Bildern läuft das Schicksal der
letzten einundeinhalb
Jahrzehnte deutschen
Leidens ab. Ansprachen
der Führer werden in
das Gefüge eingeschoben;
Scheinwerfer blenden be-
stimmte Felder und Vor-
gänge ab.
— „Welche anderen
Inhalte und Borwürfe
kämen noch in Frage?"
Vor allem die Gege-
benheiten der Geschichte,
die sich -— und das
scheint mir sehr wichtig
— auf volkstümliche und
vaterländische Gedichte
unserer Klassiker be-
ziehen. Dadurch wer-
den in den Erwachsenen
die versunkenen Erinne-
rungen wachgerufen. Es
soll jedenfalls das
Wachsen der deutschen
Kultur gezeigt werden. Um aber jeden historischen
Kitsch, diese Seuche auf den Gebieten der Kunst,
fernzuhalten, ist eine strenge Form notwendig, die
in einem wahrhaften Sinne monumental sein soll.
„Volk ohne Raum", das Schicksal der Auswande-
rungen in andere Länder, die weltgeschichtlichen
Krisen und Wendepunkte Deutschlands, der Kampf
um das Erbgut rind die Selbstbehauptung in den
Epochen der geistigen und materiellen Umzinge-
lung, das sind einige allgemeine Themen, in die
die Gestalten deutscher Kultur, also deutscher Ge-
schichte hineingestellt werden. Wir wollen das ge-
schichtliche Fühlen stark machen durch das bildhafte
Erleben in und aus der Gemeinschaft. Eine
Volkskunst kann eben nur aus dem Volke und
mit dem Volke selbst möglich sein.
— „Bis in welche Zeit reichen diese Be-
strebungen zurück?"
Im Jahre 1919 beganu ich zuerst mit den
Bewegungsspielen. Aber wir stießen selbstver-
ständlich auf erhebliche Widerstände rein Politischer
Natur. Der Weimarische Staat glaubte wegen
Völkerbund und Versailler Vertrag Bedenken
geltend machen zu müssen, die eine künstlerische,
das heißt freie Entfaltung aus der geschichtlichen
Wahrheit heraus unterbanden. Erst mit dem
neuen Deutschland wurde die Zeit reif für das
chorische Beweguugsspiel, das sich zu einer natio-
nalen Kunstform entwickeln wird, denn zwei
wesentliche Faktoren, auf denen sich diese Kunst
aufbanr, hat der Nationalsozialismus freigelegt:
den Sinn für die Bedeutung der Landschaft und
die Bereitschaft und Liebe zur Geschichte.
— „Gibt es auch in anderen Ländern eine
solche Wiedergeburt des chorischen Bewegungs-
spieles?"
Deutschland hat den Anfang gemacht. Wie
schon gesagt: im Jahre 1919. Und das ist kein
Zufall. Durch die Leidenszeit des Krieges und
durch die weiterhin über Deutschland herein-
brechenden Katastrophen der Inflation, der
Arbeitslosigkeit und des Hungers und nicht zuletzt
der kommunistischen Gefährdung wurde das
tragische Lebensgefühl geweckt, ohne das keine
nationale Verantwortung und keine nationale
Kunstform möglich ist. — Im Jahre 1931 wurden
in Amerika Versuche mit Bewegungsspielen unter-
nommen, doch scheinen sie über eine primitive
Fortsetzung aus Nr. 2
„Wie ist die Arbeitspraxis?"
— Sie wird, wie alles in Rußland, beherrscht
von einer sonderbaren Verschwommenheit der
Mentalität. Natürlich ist der revolutionäre Ar-
beiter der Hanptgcgenstand, aber nicht der ein-
zelne, wirkliche Arbeiter, sondern der Arbeiter als
Typus, der Arbeiter als Idealfigur, also mit
leuchtenden Augen, ohne Schweiß, ohne Schmutz,
ein kitschiges Abziehbild. Es wird eine
romantisch-idealistische Vorstellung von dem
„Adel der Arbeit" gepredigt, auch in der
Literatur propagiert, die in einem ent-
setzlichen Gegensatz zur täglichen Erfahrung des
einzelnen steht. In keinem Land der Welt ist die
Arbeit eine solche Quälerei wie in der Sowjet-
Flaggensymbolik nicht weit hinausgekommen zu
sein.
—- „Wie denken Sie über die Zukunft der
chorischen Bewegungskunst?"
Abgesehen davon, daß wir in Unterhandlungen
stehen, auf der 1936 in Berlin stattfindenden
Olympiade ein großes Spiel aufführen zu können,
bin ich der Meinung, daß die Disziplinierung der
Massen durch den Nationalsozialismus erst die
Möglichkeit restlos freimacht, einen wirklichen
Kunststil aus der Einheit des Volkes zu formen.
— „Wer sind denn nun die Spieler in diesen
Darbietungen?"
Es sind fast durchweg die Schüler und
Schülerinnen sämtlicher Schulen. So wirkten in
„Deutscher Wille werde Licht" über 6000 Knaben
und Mädchen mit. Die ersten Vorbereitungen
übernehmen meist die Lehrer. Die Zusammen-
fassung auf den Hauptproben gelingt dann oft
schon in einigen wenigen Einstudierungen. Die
Bewegungsspiele haben somit auch einen unschätz-
baren Pädagogischen Wert. Volksdeutsches Denken
aus der Landschaft heraus ist die Grundbedingung.
Trachten und Symbole sind dann nicht mehr leere
Formen Patriotischen Kitsches. 6. U. Mn
Union, weil nirgendwo solche lähmenden Schwie-
rigkeiten technischer, materieller und bürokratischer
Art dem Arbeitenden bösartig auflauern. Für
die systemlose Praxis des Unterrichts ein Beispiel:
— Eines schönen Tages werden die Schüler
ganz unvermittelt auf ein neues Thema gehetzt:
„Plastischer Schmuck an einem Bolkshaus". — Sie
werden in Gruppen (Brigaden) geteilt, um an
Hand der Architekturpläne das Tonmodell her-
zustellen, das nun plastisch mit Statuen und
Reliefs geschmückt werden soll. Da im modernen
„Bauhausstil" gebaut werden muß und trotzdem
Platz für Plastik gefunden werden soll, zeigt sich
übrigens hier auch der Widersinn in der offiziell
propagierten Ästhetik. Man übernimmt ebenso wie
in der Industrie westliche Muster, ohne selbständig
etwas zu schaffen, und glaubt aus Unverständnis
für das Wesen des Vorbildes, dieses mit Sowjet-
plastik bekleben zu können. Den Sowjetrussen
fehlt dabei völlig das Gefühl, daß sie eigentlich in
Westeuropa und Amerika stehlen, allerdings für
Geld stehlen.
— Ein Abgrund trennt die wirkliche Sowjet-
ideologie mit all ihrer Verschwommenheit und
ihrer unsauberen Art, Wesensfremdes wie unver-
daubares Zeug in einem Magen zusammen-
zumischen, von der klassischen reinen Linie des
Hegelschen Geschichtsdenkens, auf das man sich
dort wie selbstverständlich beruft. Die an sich
selbstverständliche politische Linie dringt also durch
die Praxis des Kunstunterrichts gar nicht hin-
durch.
— Der Unterricht ist überdeckt von nichtkünst-
lerischen Fächern, die ganz nnshstematisch, nicht
etwa einem Ausbildungsplan entsprechend, son-
dern ganz wild, die Praktische Arbeit nach dem
Modell zerreißen. Bisher waren 60 Ä> aller
Unterrichtsstunden an der Kunstakademie politi-
schen Fächern gewidmet. An der Spitze steht na-
türlich wie eine Art Religionsunterricht die Lehre
vom dialektischen Materialismus, dann folgt die
Einführung in das ökonomische System, Politische
und Wirtschaftsgeschichte der Sowjetrepubliken und
andere „marxistische" Fächer mehr. Sonderbarer-
weise gehört Deutsch zu den obligatorischen Unter-
richtsfächern in allen Sowjetlehrinstituten, weil
man für den Fall des Ausbruchs der kom-
munistischen Revolution in Deutschland die
Kenntnis der deutschen Sprache für er-
forderlich hielt. Aber niemand versteht in
Chorspiel: „Deutscher Wille werde Licht". Regie: E. Streubel
Lehrer an der Sowjet-Kunstakademie
Ein klarer Auftrag
Bon
Bruno Brehm
Ich traf auf seiner Bude den Maler in trüber
Laune; bei meinem Eintritt suchte er etwas zu
verstecken. Ich hatte es gesehen und fragte,
warum er vor mir seine Arbeit verräume. Der
Maler seufzte und sah mich traurig an: „Das ist
etwas schauerlich Schönes! In der Not frißt der
Teufel Fliegen und ich muß sämtliche Bahnhöfe
von Wien bis Tschernowitz malen."
Ich verstand nicht gleich. Der Maler nickte
trübsinnig: „Jawohl, vom Wiener Nordbahnhof
bis Tschernowitz, alle Bahnstationen. Das ist
ein Auftrag. Es ist ein reicher Mann. Daher
war er im Kriege immerzu irgendwo Bahnhof-
kommandant. Mein Lieber, der hat eine Samm-
lung von Kosakenlanzen und Achselklappen, von
Kappen und Säbeln, daß auch Ihnen die Haare
zu Berge stehen möchten! Jetzt, da man sich bei
uns ein wenig an den Krieg erinnert, will auch
er seine Erinnerungen gemalt sehen. Da habe
ich die Photographien der Bahnhöfe, dort ist das
große Buch, in das ich die Bilder hineinpinseln
muß. Es ist eine verdammte Pimpelei. Aber
was soll ich tun? Man braucht Geld, um ein
wenig leben zu können."
„Schauderhaft, höchst schauderhaft", seufzte nun
auch ich. „Alle Bahnhöfe gleichen doch einander
wie Bretzen! Woran erkennt man da den Unter-
schied?"
„An der Aufschrift!" sagte achselzuckend der
Maler.
„Herrlich! Da brauchen Sie ja nur eine
Station zu malen und können diese dann
zwanzigmal abpansen!"
„Geht nicht", sagte der Maler, „der Mann
kennt seine Bahnhöfe. Bei dem einen war der
Wein rot, bei dem andern noch grün, beim dritten
schon blattlos. Sie können sich gar nicht denken,
wie sehr ich diese Poesie des wilden Bahnhof-
weines verflucht habe. Und das alles hat sich
dieser Kerl gemerkt wie sich andere die Narzissen-
blüte im Gebirge oder die Seerosen in einer stillen
Bucht merken! Aber, Gott sei Dank, jetzt bin ich
schon beim Bahnhof von Leniberg! Das ist ein
Dom nnter den Bahnhöfen! Später kommt noch
ein zerschossener Bahnhof und ein brennender!
Auf diese beiden freue ich mich seit dem Nord-
bahnhof von Wien! Das sind meine Erholungen,
meine Abwechslungen."
Wie ich so während der Erzählung des Malers
in diesem Album blätterte, wurde ich schwer-
mütig: „Das sind Zeiten! Das sind Aufträge!"
„Manchmal hat man auch Glück", sagte der
Maler, „manchmal verkauft man auch ein Bild.
Unlängst hab ich sogar zwei verkauft. Durch
meine tschechische Bedienerin: Eine tüchtige Frau!
Die sieht, wie ich male und male, wie die Bilder
immer mehr und wie das Geld immer weniger
wird. Kommt sie also eines morgens zu mir
und sagt: Hören S'! Hab ich gute Geschäft für
Ihne! Können S' verkaufen zwei Bilder. Käufer
verstehn eh nix, sind Selchcrische, brav und reich,
Haufen Geld, wissen S', Geschäft geht, beim
Essen sparen Leut' nicht, wollen sich einrichten,
Selcherische, haben erst geheiratet, bisserl blöd, ver-
stehn S', aber sehr freundlich! Hab ich zu sie ge-
sagt: Muß denn immer Dummheit an die Wand
hängen? Warum nicht Originalbild von ordent-
liche Maler? Ich räum' auf bei ordentliche
Maler. Er verkauft Bild, ich bitt Sie gar schön,
was noch is für Enkel und Enkelkinder."
Der Maler verstand es, die Bedienerin gut
nachzuahmen; ich sah eine wohlwollende, beleibte
Tschechin vor mir stehen und Erbarmen mit ihrem
hilflosen Dienstherrn haben.
„Also ging ich", fuhr der Maler fort, „in
Begleitung meiner Bedienerin in das Haus des
jungvermählten Selchermeisters Arbeseder. Eine
rosige Frau empfing uns und rieb sich ein wenig
verlegen die Hände an der Schürze ab: sie wisse
noch nicht, ob sie die Bilder werde nehmen können,
es sei nur ein Versuch, die Frau Wowrisek da, die
Bedienerin, habe ihr halt so viel zugcredet, sie
müsse die beiden Bilder erst sehen.
Frau Wowrisek hatte mir geraten, zwei Land-
schaften mitzunehmeu (verstehn S', keine närrische
moderne Sachen, so bissel Wald und Wiesen, daß
sich die Selchcrische nicht schreckt gleich im An-
fang!) und ich packte nun ein wenig verlegen aus.
„Gut! Ausgezeichnet!" sagte Frau Arbeseder
beim Anblick des ersten Bildes, „das nehm ich!"
Es war eine Sommcrlandschaft: Felder, Wäl-
der, Wiesen, blauer Himmel mit Wolken. „Paßt
auch gut über mein Bett. Nun das andere
Bild!"
Frau Arbeseder runzelte die rosige Stirn:
„Geht nicht!" sagte sie nach einer bangen Panse,
„das geht wirklich net!"
„Gnä Frau!" rief meine und ihre Bedienerin,
„warum net? Ist doch ganz schöne Bilde!? Passet
gut über die Bett von die Herrn Gemahl!"
Aber die Frau Selchermeister blieb hartnäckig:
„Tut mir leid, tut mir leid, aus dem Geschäft
kann halt nix werden!"
„Da wollte ich wissen", fuhr der Maler fort,
„was Frau Arbeseder an meinem Bilde auszu-
setzen hatte."
„Mir gefallet 's eh", erwiderte Fran Arbeseder
verschämt, „aber mein Mann! mein Mann, ver-
stehn S', kann nämlich keine Kirchen sehen! Und
auf Jhnern Bild! da is a Kircherl drauf! Mein
Mann wird wild, wenn ich ihm a Kircherl übers
Bett häng. Er ist nämlich ein Freigeist!"
Meine Bedienerin, die wackere Frau Wowrisek,
gab mir einen Stoß in die Seite: „Das Kircherl,
net wahr, gnä Herr, das Kircherl werden wir
einfach zumalen. Gnä Frau, Sie wissen gar net,
wieviel solche Maler zumalen!"
Frau Arbeseder traute dieser Versprechung
nicht recht: „Wenn's aber dann durchscheint?
Mein Mann wird dann wissen, daß dort a
Kircherl gestanden ist! Na, na, lieber net!"
„Man wird gar nix erkennen, gnä Frau, nicht
mit Vergrößerungsglas", erwiderte Frau
Wowrisek. „Haben wir oft schon gmacht, wenn
Kundschaft verlangt."
„Aber der Himmel ist zu grau", wehrte Frau
Arbeseder ab. „Jetzt und jetzt könnt man glau-
ben, wird's regnen. Mein Mann will aber
immer schönes Wetter haben."
„Ein vermessener Selcher", konnte ich mich
nicht enthalten, den Maler zu unterbrechen.
„Jawohl, ein vermessener Selcher", fuhr der
Maler fort. „Aber was soll man tun? Ich gab
die Sache schon auf, aber Frau Wowrisek war
nicht so leicht abzuwimmeln. „Machen wir auch.
Können wir auch ändern! Gnä Frau, was wissen
Sie, was so eine Maler herumpatzt! Machen wir
blaue Himmel, daß genau zu Bettdecken paßt!
Herr Gemahl muß nicht mit Regenschirm
schlafen!" Und sich rasch umblickend, fragte Fran
Wowrisek, wo denn der Fleckerlkorb sei. Die
Selcherin deutete auf den Nähtisch, die Bedienerin
kramte in einem Korb herum und holte ein Streif-
chen tiefblauer Seide heraus. „So muß die Him-
mel sein", sagte Frau Wowrisek zu dem Maler,
„das ist Seide von die Bettdecke!"
Der Maler wollte einwenden, daß solcher Him-
mel nicht über niederösterreichischen Dörfern stehe,
aber die Bedienerin trat ihm unwillig auf den
Fuß.
„Das ist die rechte Färb'", sagte Frau
Arbeseder, „solch einen Himmel liebt auch mein
Mann. Wenn Sie also so einen Himmel malen,
nehm' ich auch das andere Bild."
„Das war ein klarer Auftrag", sagte der
Maler. „Den Kirchturm mußte ich also über-
malen, der blaue Himmel kam dazu, es wurde eine
seltsame, südamerikanische Landschaft. Glauben
Sie, es war lustiger als diese ewigen Bahnhöfe!
Eine Änderung zog eine andere nach sich, der blaue
Himmel forderte andere Farben, es war albern
und doch blieb ich gespannt, was draus werden
sollte. Es war nicht das schlechteste Bild, das ich
gemalt hatte. Es sind jetzt schlechte Zeiten! Und
wenn Herr Arbeseder verlangt hätte, ich soll ihm
obendrein noch einen Knebelbart ins Gesicht
malen, ich hätt' es getan! Denn ein klarer Auf-
trag, auch wenn er noch so dumm ist, hat immer
etwas für sich. Aber wir bekommen weder klare
noch unklare Aufträge! Auf den klaren aber war
Frau Wowrisek besonders stolz. Jetzt muß ich,
wenn ich male, die Bilder vor ihr verstecken, denn
sie spricht mir immer wieder drein. Dieser Han-
del ist ihr gewaltig in den Kopf gestiegen."