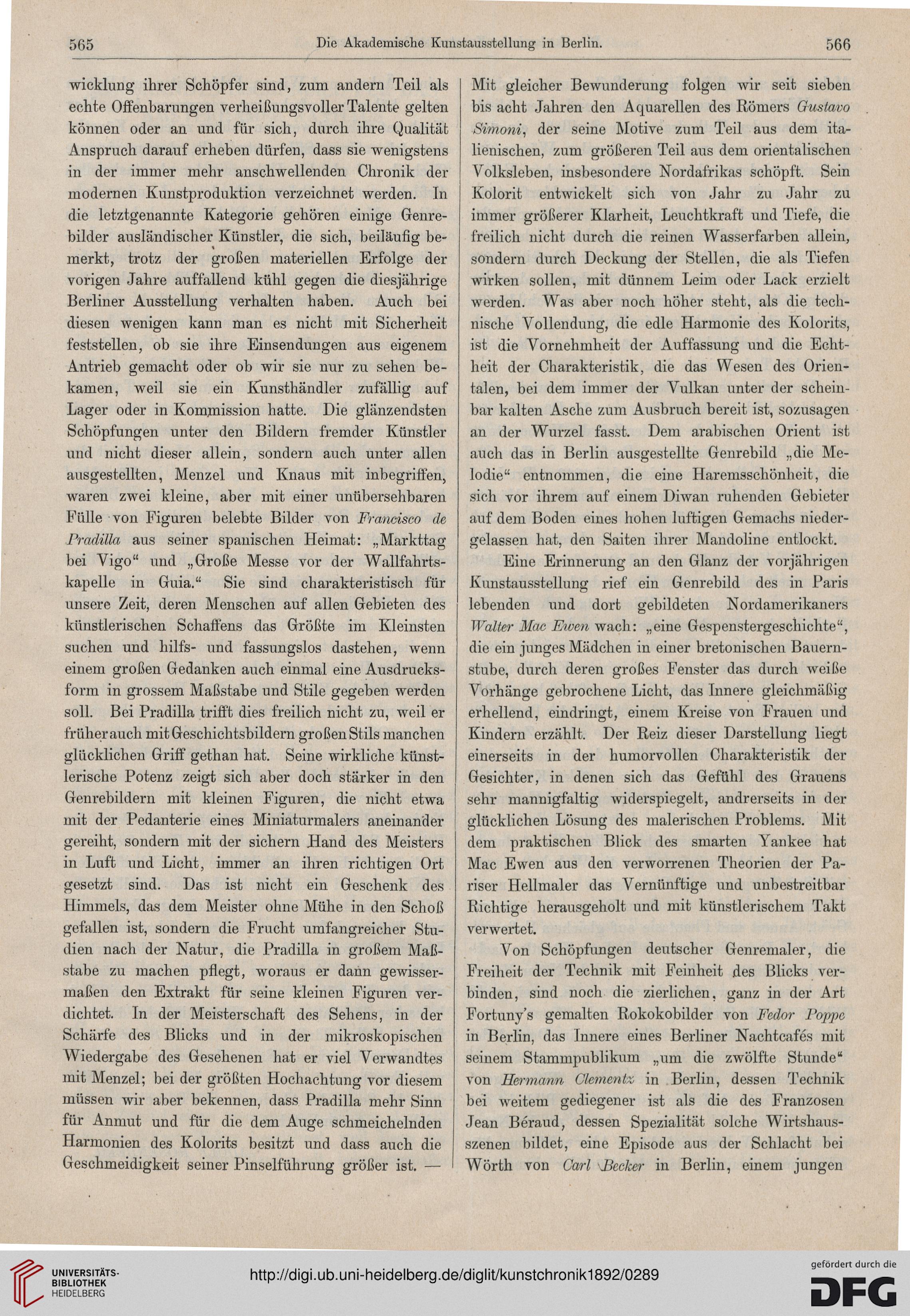565
Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.
566
wicklung ihrer Schöpfer sind, zum andern Teil als
echte Offenbarungen verheißungsvoller Talente gelten
können oder an und für sich, durch ihre Qualität
Anspruch darauf erheben dürfen, dass sie wenigstens
in der immer mehr anschwellenden Chronik der
modernen Kunstproduktion verzeichnet werden. In
die letztgenannte Kategorie gehören einige Genre-
bilder ausländischer Künstler, die sich, beiläufig be-
merkt, trotz der großen materiellen Erfolge der
vorigen Jahre auffallend kühl gegen die diesjährige
Berliner Ausstellung verhalten haben. Auch bei
diesen wenigen kann man es nicht mit Sicherheit
feststellen, ob sie ihre Einsendungen aus eigenem
Antrieb gemacht oder ob wir sie nur zu sehen be-
kamen, weil sie ein Kunsthändler zufällig auf
Lager oder in Kommission hatte. Die glänzendsten
Schöpfungen unter den Bildern fremder Künstler
und nicht dieser allein, sondern auch unter allen
ausgestellten, Menzel und Knaus mit inbegriffen,
waren zwei kleine, aber mit einer unübersehbaren
Fülle von Figuren belebte Bilder von Francisco de
Pradilla aus seiner spanischen Heimat: „Markttag
bei Vigo" und „Große Messe vor der Wallfahrts-
kapelle in Guia." Sie sind charakteristisch für
unsere Zeit, deren Menschen auf allen Gebieten des
künstlerischen Schaffens das Größte im Kleinsten
suchen und hilfs- und fassungslos dastehen, wenn
einem großen Gedanken auch einmal eine Ausdrucks-
form in grossem Maßstabe und Stile gegeben werden
soll. Bei Pradilla trifft dies freilich nicht zu, weil er
früherauch mit Geschichtsbildern großen Stils manchen
glücklichen Griff gethan hat. Seine wirkliche künst-
lerische Potenz zeigt sich aber doch stärker in den I
Genrebildern mit kleinen Figuren, die nicht etwa |
mit der Pedanterie eines Miniaturmalers aneinander
gereiht, sondern mit der sichern Hand des Meisters
in Luft und Licht, immer an ihren richtigen Ort
gesetzt sind. Das ist nicht ein Geschenk des
Himmels, das dem Meister ohne Mühe in den Schoß
gefallen ist, sondern die Frucht umfangreicher Stu-
dien nach der Natur, die Pradilla in großem Maß-
stabe zu machen pflegt, woraus er dann gewisser-
maßen den Extrakt für seine kleinen Figuren ver-
dichtet. In der Meisterschaft des Sehens, in der
Schärfe des Blicks und in der mikroskopischen
Wiedergabe des Gesehenen hat er viel Verwandtes
mit Menzel; bei der größten Hochachtung vor diesem
müssen wir aber bekennen, dass Pradilla mehr Sinn
für Anmut und für die dem Auge schmeichelnden
Harmonien des Kolorits besitzt und dass auch die
Geschmeidigkeit seiner Pinselführung größer ist. —
Mit gleicher Bewunderung folgen wir seit sieben
bis acht Jahren den Aquarellen des Römers Gustavo
Simoni, der seine Motive zum Teil aus dem ita-
lienischen, zum größeren Teil aus dem orientalischen
Volksleben, insbesondere Nordafrikas schöpft. Sein
Kolorit entwickelt sich von Jahr zu Jahr zu
immer größerer Klarheit, Leuchtkraft und Tiefe, die
freilich nicht durch die reinen Wasserfarben allein,
sondern durch Deckung der Stellen, die als Tiefen
wirken sollen, mit dünnem Leim oder Lack erzielt
werden. Was aber noch höher steht, als die tech-
nische Vollendung, die edle Harmonie des Kolorits,
ist die Vornehmheit der Auffassung und die Echt-
heit der Charakteristik, die das Wesen des Orien-
talen, bei dem immer der Vulkan unter der schein-
bar kalten Asche zum Ausbruch bereit ist, sozusagen
an der Wurzel fasst. Dem arabischen Orient ist
auch das in Berlin ausgestellte Genrebild „die Me-
lodie" entnommen, die eine Haremsschönheit, die
sich vor ihrem auf einem Diwan ruhenden Gebieter
auf dem Boden eines hohen luftigen Gemachs nieder-
gelassen hat, den Saiten ihrer Mandoline entlockt.
Eine Erinnerung an den Glanz der vorjährigen
Kunstausstellung rief ein Genrebild des in Paris
lebenden und dort gebildeten Nordamerikaners
Walter Mac Ewen wach: „eine Gespenstergeschichte",
die ein junges Mädchen in einer bretonischen Bauern-
stube, durch deren großes Fenster das durch weiße
Vorhänge gebrochene Licht, das Innere gleichmäßig
erhellend, eindringt, einem Kreise von Frauen und
Kindern erzählt. Der Reiz dieser Darstellung liegt
einerseits in der humorvollen Charakteristik der
Gesichter, in denen sich das Gefühl des Grauens
sehr mannigfaltig widerspiegelt, andrerseits in der
glücklichen Lösung des malerischen Problems. Mit
dem praktischen Blick des smarten Yankee hat
Mac Ewen aus den verworrenen Theorien der Pa-
riser Hellmaler das Vernünftige und unbestreitbar
Richtige herausgeholt und mit künstlerischem Takt
verwertet.
Von Schöpfungen deutscher Genremaler, die
Freiheit der Technik mit Feinheit des Blicks ver-
binden, sind noch die zierlichen, ganz in der Art
Fortuny's gemalten Rokokobilder von Fedor Poppe
in Berlin, das Innere eines Berliner Nachtcafes mit
seinem Stammpublikum „um die zwölfte Stunde"
von Hermann Clements in Berlin, dessen Technik
bei weitem gediegener ist als die des Franzosen
Jean Beraud, dessen Spezialität solche Wirtshaus-
szenen bildet, eine Episode aus der Schlacht bei
Wörth von Carl Becker in Berlin, einem jungen
Die Akademische Kunstausstellung in Berlin.
566
wicklung ihrer Schöpfer sind, zum andern Teil als
echte Offenbarungen verheißungsvoller Talente gelten
können oder an und für sich, durch ihre Qualität
Anspruch darauf erheben dürfen, dass sie wenigstens
in der immer mehr anschwellenden Chronik der
modernen Kunstproduktion verzeichnet werden. In
die letztgenannte Kategorie gehören einige Genre-
bilder ausländischer Künstler, die sich, beiläufig be-
merkt, trotz der großen materiellen Erfolge der
vorigen Jahre auffallend kühl gegen die diesjährige
Berliner Ausstellung verhalten haben. Auch bei
diesen wenigen kann man es nicht mit Sicherheit
feststellen, ob sie ihre Einsendungen aus eigenem
Antrieb gemacht oder ob wir sie nur zu sehen be-
kamen, weil sie ein Kunsthändler zufällig auf
Lager oder in Kommission hatte. Die glänzendsten
Schöpfungen unter den Bildern fremder Künstler
und nicht dieser allein, sondern auch unter allen
ausgestellten, Menzel und Knaus mit inbegriffen,
waren zwei kleine, aber mit einer unübersehbaren
Fülle von Figuren belebte Bilder von Francisco de
Pradilla aus seiner spanischen Heimat: „Markttag
bei Vigo" und „Große Messe vor der Wallfahrts-
kapelle in Guia." Sie sind charakteristisch für
unsere Zeit, deren Menschen auf allen Gebieten des
künstlerischen Schaffens das Größte im Kleinsten
suchen und hilfs- und fassungslos dastehen, wenn
einem großen Gedanken auch einmal eine Ausdrucks-
form in grossem Maßstabe und Stile gegeben werden
soll. Bei Pradilla trifft dies freilich nicht zu, weil er
früherauch mit Geschichtsbildern großen Stils manchen
glücklichen Griff gethan hat. Seine wirkliche künst-
lerische Potenz zeigt sich aber doch stärker in den I
Genrebildern mit kleinen Figuren, die nicht etwa |
mit der Pedanterie eines Miniaturmalers aneinander
gereiht, sondern mit der sichern Hand des Meisters
in Luft und Licht, immer an ihren richtigen Ort
gesetzt sind. Das ist nicht ein Geschenk des
Himmels, das dem Meister ohne Mühe in den Schoß
gefallen ist, sondern die Frucht umfangreicher Stu-
dien nach der Natur, die Pradilla in großem Maß-
stabe zu machen pflegt, woraus er dann gewisser-
maßen den Extrakt für seine kleinen Figuren ver-
dichtet. In der Meisterschaft des Sehens, in der
Schärfe des Blicks und in der mikroskopischen
Wiedergabe des Gesehenen hat er viel Verwandtes
mit Menzel; bei der größten Hochachtung vor diesem
müssen wir aber bekennen, dass Pradilla mehr Sinn
für Anmut und für die dem Auge schmeichelnden
Harmonien des Kolorits besitzt und dass auch die
Geschmeidigkeit seiner Pinselführung größer ist. —
Mit gleicher Bewunderung folgen wir seit sieben
bis acht Jahren den Aquarellen des Römers Gustavo
Simoni, der seine Motive zum Teil aus dem ita-
lienischen, zum größeren Teil aus dem orientalischen
Volksleben, insbesondere Nordafrikas schöpft. Sein
Kolorit entwickelt sich von Jahr zu Jahr zu
immer größerer Klarheit, Leuchtkraft und Tiefe, die
freilich nicht durch die reinen Wasserfarben allein,
sondern durch Deckung der Stellen, die als Tiefen
wirken sollen, mit dünnem Leim oder Lack erzielt
werden. Was aber noch höher steht, als die tech-
nische Vollendung, die edle Harmonie des Kolorits,
ist die Vornehmheit der Auffassung und die Echt-
heit der Charakteristik, die das Wesen des Orien-
talen, bei dem immer der Vulkan unter der schein-
bar kalten Asche zum Ausbruch bereit ist, sozusagen
an der Wurzel fasst. Dem arabischen Orient ist
auch das in Berlin ausgestellte Genrebild „die Me-
lodie" entnommen, die eine Haremsschönheit, die
sich vor ihrem auf einem Diwan ruhenden Gebieter
auf dem Boden eines hohen luftigen Gemachs nieder-
gelassen hat, den Saiten ihrer Mandoline entlockt.
Eine Erinnerung an den Glanz der vorjährigen
Kunstausstellung rief ein Genrebild des in Paris
lebenden und dort gebildeten Nordamerikaners
Walter Mac Ewen wach: „eine Gespenstergeschichte",
die ein junges Mädchen in einer bretonischen Bauern-
stube, durch deren großes Fenster das durch weiße
Vorhänge gebrochene Licht, das Innere gleichmäßig
erhellend, eindringt, einem Kreise von Frauen und
Kindern erzählt. Der Reiz dieser Darstellung liegt
einerseits in der humorvollen Charakteristik der
Gesichter, in denen sich das Gefühl des Grauens
sehr mannigfaltig widerspiegelt, andrerseits in der
glücklichen Lösung des malerischen Problems. Mit
dem praktischen Blick des smarten Yankee hat
Mac Ewen aus den verworrenen Theorien der Pa-
riser Hellmaler das Vernünftige und unbestreitbar
Richtige herausgeholt und mit künstlerischem Takt
verwertet.
Von Schöpfungen deutscher Genremaler, die
Freiheit der Technik mit Feinheit des Blicks ver-
binden, sind noch die zierlichen, ganz in der Art
Fortuny's gemalten Rokokobilder von Fedor Poppe
in Berlin, das Innere eines Berliner Nachtcafes mit
seinem Stammpublikum „um die zwölfte Stunde"
von Hermann Clements in Berlin, dessen Technik
bei weitem gediegener ist als die des Franzosen
Jean Beraud, dessen Spezialität solche Wirtshaus-
szenen bildet, eine Episode aus der Schlacht bei
Wörth von Carl Becker in Berlin, einem jungen