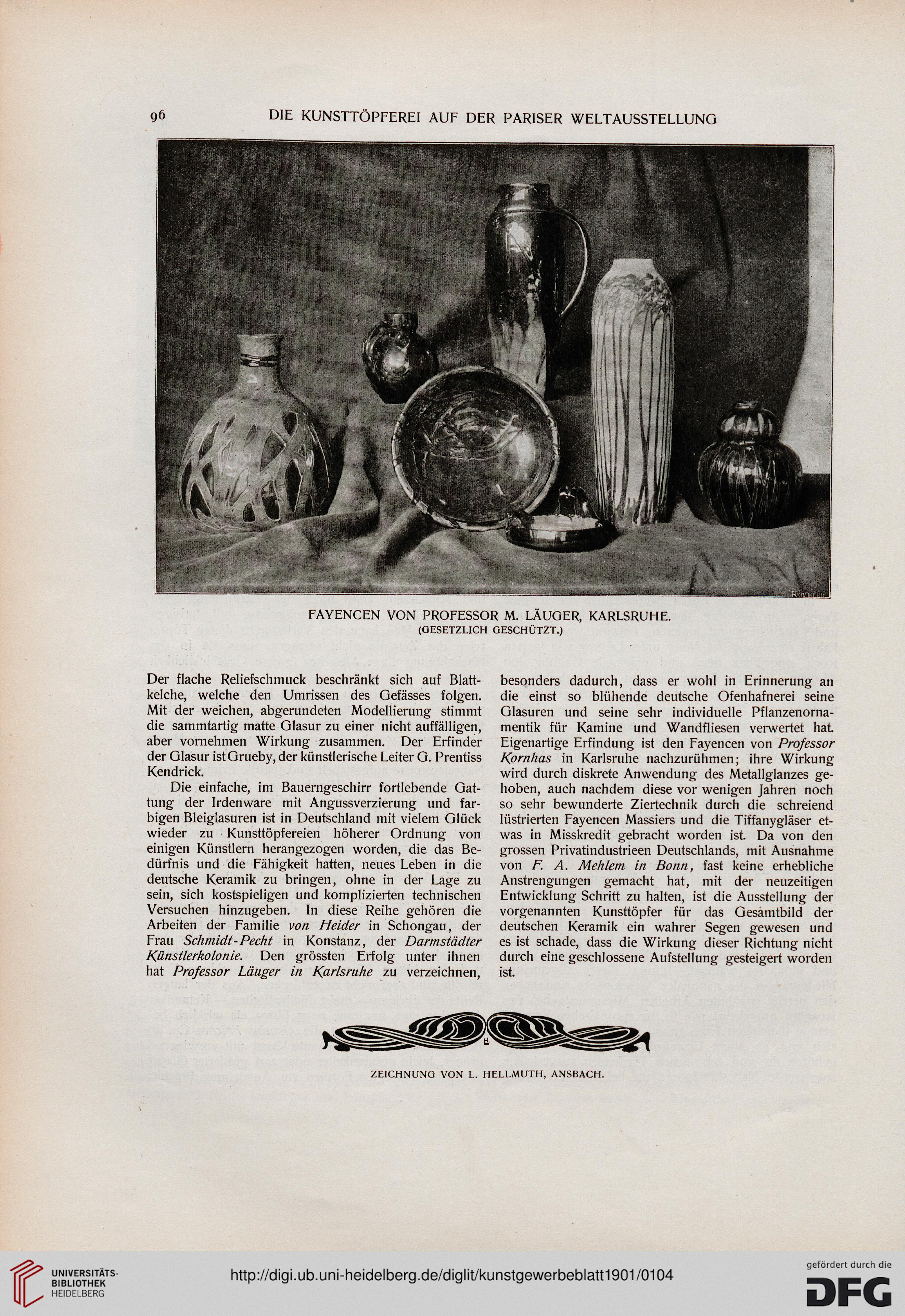96
DIE KUNSTTÖPFEREI AUF DER PARISER WELTAUSSTELLUNG
FAYENCEN VON PROFESSOR M. LAUOER, KARLSRUHE.
(GESETZLICH GESCHÜTZT.)
Der flache Reliefschmuck beschränkt sich auf Blatt-
kelche, welche den Umrissen des Gefässes folgen.
Mit der weichen, abgerundeten Modellierung stimmt
die sammtartig matte Glasur zu einer nicht auffälligen,
aber vornehmen Wirkung zusammen. Der Erfinder
der Glasur istGrueby, der künstlerische Leiter G. Prentiss
Kendrick.
Die einfache, im Bauerngeschirr fortlebende Gat-
tung der Irdenware mit Angussverzierung und far-
bigen Bleiglasuren ist in Deutschland mit vielem Glück
wieder zu Kunsttöpfereien höherer Ordnung von
einigen Künstlern herangezogen worden, die das Be-
dürfnis und die Fähigkeit hatten, neues Leben in die
deutsche Keramik zu bringen, ohne in der Lage zu
sein, sich kostspieligen und komplizierten technischen
Versuchen hinzugeben. In diese Reihe gehören die
Arbeiten der Familie von Heider in Schongau, der
Frau Schmidt-Pecht in Konstanz, der Darmstädter
KJlnstlerkolonle. Den grössten Erfolg unter ihnen
hat Professor Länger in Karlsruhe zu verzeichnen,
besonders dadurch, dass er wohl in Erinnerung an
die einst so blühende deutsche Ofenhafnerei seine
Glasuren und seine sehr individuelle Pflanzenorna-
mentik für Kamine und Wandfliesen verwertet hat.
Eigenartige Erfindung ist den Fayencen von Professor
Kprnhas in Karlsruhe nachzurühmen; ihre Wirkung
wird durch diskrete Anwendung des Metallglanzes ge-
hoben, auch nachdem diese vor wenigen Jahren noch
so sehr bewunderte Ziertechnik durch die schreiend
Iüstrierten Fayencen Massiers und die Tiffanygläser et-
was in Misskredit gebracht worden ist. Da von den
grossen Privatindustrieen Deutschlands, mit Ausnahme
von F. A. Mehlem In Bonn, fast keine erhebliche
Anstrengungen gemacht hat, mit der neuzeitigen
Entwicklung Schritt zu halten, ist die Ausstellung der
vorgenannten Kunsttöpfer für das Gesamtbild der
deutschen Keramik ein wahrer Segen gewesen und
es ist schade, dass die Wirkung dieser Richtung nicht
durch eine geschlossene Aufstellung gesteigert worden
ist.
ZEICHNUNO VON L. HELLMUTH, ANSBACH.
DIE KUNSTTÖPFEREI AUF DER PARISER WELTAUSSTELLUNG
FAYENCEN VON PROFESSOR M. LAUOER, KARLSRUHE.
(GESETZLICH GESCHÜTZT.)
Der flache Reliefschmuck beschränkt sich auf Blatt-
kelche, welche den Umrissen des Gefässes folgen.
Mit der weichen, abgerundeten Modellierung stimmt
die sammtartig matte Glasur zu einer nicht auffälligen,
aber vornehmen Wirkung zusammen. Der Erfinder
der Glasur istGrueby, der künstlerische Leiter G. Prentiss
Kendrick.
Die einfache, im Bauerngeschirr fortlebende Gat-
tung der Irdenware mit Angussverzierung und far-
bigen Bleiglasuren ist in Deutschland mit vielem Glück
wieder zu Kunsttöpfereien höherer Ordnung von
einigen Künstlern herangezogen worden, die das Be-
dürfnis und die Fähigkeit hatten, neues Leben in die
deutsche Keramik zu bringen, ohne in der Lage zu
sein, sich kostspieligen und komplizierten technischen
Versuchen hinzugeben. In diese Reihe gehören die
Arbeiten der Familie von Heider in Schongau, der
Frau Schmidt-Pecht in Konstanz, der Darmstädter
KJlnstlerkolonle. Den grössten Erfolg unter ihnen
hat Professor Länger in Karlsruhe zu verzeichnen,
besonders dadurch, dass er wohl in Erinnerung an
die einst so blühende deutsche Ofenhafnerei seine
Glasuren und seine sehr individuelle Pflanzenorna-
mentik für Kamine und Wandfliesen verwertet hat.
Eigenartige Erfindung ist den Fayencen von Professor
Kprnhas in Karlsruhe nachzurühmen; ihre Wirkung
wird durch diskrete Anwendung des Metallglanzes ge-
hoben, auch nachdem diese vor wenigen Jahren noch
so sehr bewunderte Ziertechnik durch die schreiend
Iüstrierten Fayencen Massiers und die Tiffanygläser et-
was in Misskredit gebracht worden ist. Da von den
grossen Privatindustrieen Deutschlands, mit Ausnahme
von F. A. Mehlem In Bonn, fast keine erhebliche
Anstrengungen gemacht hat, mit der neuzeitigen
Entwicklung Schritt zu halten, ist die Ausstellung der
vorgenannten Kunsttöpfer für das Gesamtbild der
deutschen Keramik ein wahrer Segen gewesen und
es ist schade, dass die Wirkung dieser Richtung nicht
durch eine geschlossene Aufstellung gesteigert worden
ist.
ZEICHNUNO VON L. HELLMUTH, ANSBACH.