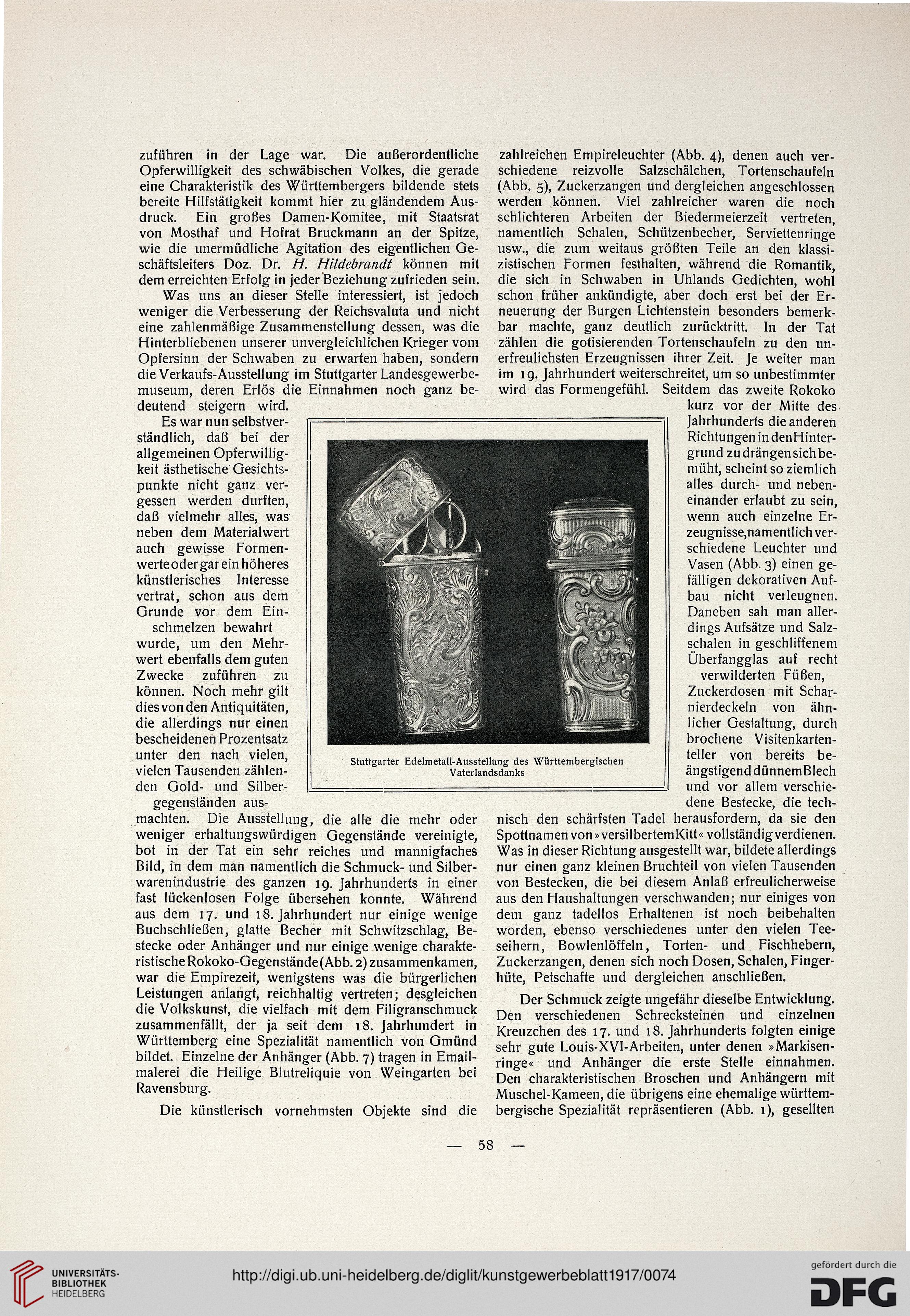zuführen in der Lage war. Die außerordentliche
Opferwilligkeit des schwäbischen Volkes, die gerade
eine Charakteristik des Württembergers bildende stets
bereite Hilfstätigkeit kommt hier zu gländendem Aus-
druck. Ein großes Damen-Komitee, mit Staatsrat
von Mosthaf und Hofrat Bruckmann an der Spitze,
wie die unermüdliche Agitation des eigentlichen Ge-
schäftsleiters Doz. Dr. H. Hildebrandt können mit
dem erreichten Erfolg in jeder Beziehung zufrieden sein.
Was uns an dieser Stelle interessiert, ist jedoch
weniger die Verbesserung der Reichsvaluta und nicht
eine zahlenmäßige Zusammenstellung dessen, was die
Hinterbliebenen unserer unvergleichlichen Krieger vom
Opfersinn der Schwaben zu erwarten haben, sondern
die Verkaufs-Ausstellung im Stuttgarter Landesgewerbe-
museum, deren Erlös die Einnahmen noch ganz be-
deutend steigern wird.
Es war nun selbstver-
ständlich, daß bei der
allgemeinen Opferwillig-
keit ästhetische Gesichts-
punkte nicht ganz ver-
gessen werden durften,
daß vielmehr alles, was
neben dem Materialwert
auch gewisse Formen-
werte oder gar ein höheres
künstlerisches Interesse
vertrat, schon aus dem
Grunde vor dem Ein-
schmelzen bewahrt
wurde, um den Mehr-
wert ebenfalls dem guten
Zwecke zuführen zu
können. Noch mehr gilt
dies von den Antiquitäten,
die allerdings nur einen
bescheidenen Prozentsatz
unter den nach vielen,
vielen Tausenden zählen-
den Gold- und Silber-
gegenständen aus-
machten. Die Ausstellung, die alle die mehr oder
weniger erhaltungswürdigen Gegenstände vereinigte,
bot in der Tat ein sehr reiches und mannigfaches
Bild, in dem man namentlich die Schmuck- und Silber-
warenindustrie des ganzen 19. Jahrhunderts in einer
fast lückenlosen Folge übersehen konnte. Während
aus dem 17. und 18. Jahrhundert nur einige wenige
Buchschließen, glatte Becher mit Schwitzschlag, Be-
stecke oder Anhänger und nur einige wenige charakte-
ristische Rokoko-Gegenstände(Abb. 2) zusammenkamen,
war die Empirezeit, wenigstens was die bürgerlichen
Leistungen anlangt, reichhaltig vertreten; desgleichen
die Volkskunst, die vielfach mit dem Filigranschmuck
zusammenfällt, der ja seit dem 18. Jahrhundert in
Württemberg eine Spezialität namentlich von Gmünd
bildet. Einzelne der Anhänger (Abb. 7) tragen in Email-
malerei die Heilige Blutreliquie von Weingarten bei
Ravensburg.
Die künstlerisch vornehmsten Objekte sind die
B'
K9fl
BHfli
B "'imj,l-£*,,,'"^^3JB
m
K||p|
Hfe
^ft- V^v^JEs&M^B.
Ifc
iv
HsS]
Stuttgarter Edelmetall-Ausstellung des Württembergischen
Vaterlandsdanks
zahlreichen Empireleuchter (Abb. 4), denen auch ver-
schiedene reizvolle Salzschälchen, Tortenschaufeln
(Abb. 5), Zuckerzangen und dergleichen angeschlossen
werden können. Viel zahlreicher waren die noch
schlichteren Arbeiten der Biedermeierzeit vertreten,
namentlich Schalen, Schützenbecher, Serviettenringe
usw., die zum weitaus größten Teile an den klassi-
zistischen Formen festhalten, während die Romantik,
die sich in Schwaben in Uhlands Gedichten, wohl
schon früher ankündigte, aber doch erst bei der Er-
neuerung der Burgen Lichtenstein besonders bemerk-
bar machte, ganz deutlich zurücktritt. In der Tat
zählen die gotisierenden Tortenschaufeln zu den un-
erfreulichsten Erzeugnissen ihrer Zeit. Je weiter man
im ig. Jahrhundert weiterschreitet, um so unbestimmter
wird das Formengefühl. Seitdem das zweite Rokoko
kurz vor der Mitte des
Jahrhunderts die anderen
Richtungen in denHinter-
grund zu drängen sich be-
müht, scheint so ziemlich
alles durch- und neben-
einander erlaubt zu sein,
wenn auch einzelne Er-
zeugnisse,namentlich ver-
schiedene Leuchter und
Vasen (Abb. 3) einen ge-
fälligen dekorativen Auf-
bau nicht verleugnen.
Daneben sah man aller-
dings Aufsätze und Salz-
schalen in geschliffenem
Überfangglas auf recht
verwilderten Füßen,
Zuckerdosen mit Schar-
nierdeckeln von ähn-
licher Geslaltung, durch
brochene Visitenkarten-
teller von bereits be-
ängstigend dünnem Blech
und vor allem verschie-
dene Bestecke, die tech-
nisch den schärfsten Tadel herausfordern, da sie den
Spottnamen von »versilbertem Kitt« vollständig verdienen.
Was in dieser Richtung ausgestellt war, bildete allerdings
nur einen ganz kleinen Bruchteil von vielen Tausenden
von Bestecken, die bei diesem Anlaß erfreulicherweise
aus den Haushaltungen verschwanden; nur einiges von
dem ganz tadellos Erhaltenen ist noch beibehalten
worden, ebenso verschiedenes unter den vielen Tee-
seihern, Bowlenlöffeln, Torten- und Fischhebern,
Zuckerzangen, denen sich noch Dosen, Schalen, Finger-
hüte, Petschafte und dergleichen anschließen.
Der Schmuck zeigte ungefähr dieselbe Entwicklung.
Den verschiedenen Schrecksteinen und einzelnen
Kreuzchen des 17. und 18. Jahrhunderts folgten einige
sehr gute Louis-XVI-Arbeiten, unter denen »Markisen-
ringe« und Anhänger die erste Stelle einnahmen.
Den charakteristischen Broschen und Anhängern mit
Muschel-Kameen, die übrigens eine ehemalige württem-
bergische Spezialität repräsentieren (Abb. 1), gesellten
— 58 —
Opferwilligkeit des schwäbischen Volkes, die gerade
eine Charakteristik des Württembergers bildende stets
bereite Hilfstätigkeit kommt hier zu gländendem Aus-
druck. Ein großes Damen-Komitee, mit Staatsrat
von Mosthaf und Hofrat Bruckmann an der Spitze,
wie die unermüdliche Agitation des eigentlichen Ge-
schäftsleiters Doz. Dr. H. Hildebrandt können mit
dem erreichten Erfolg in jeder Beziehung zufrieden sein.
Was uns an dieser Stelle interessiert, ist jedoch
weniger die Verbesserung der Reichsvaluta und nicht
eine zahlenmäßige Zusammenstellung dessen, was die
Hinterbliebenen unserer unvergleichlichen Krieger vom
Opfersinn der Schwaben zu erwarten haben, sondern
die Verkaufs-Ausstellung im Stuttgarter Landesgewerbe-
museum, deren Erlös die Einnahmen noch ganz be-
deutend steigern wird.
Es war nun selbstver-
ständlich, daß bei der
allgemeinen Opferwillig-
keit ästhetische Gesichts-
punkte nicht ganz ver-
gessen werden durften,
daß vielmehr alles, was
neben dem Materialwert
auch gewisse Formen-
werte oder gar ein höheres
künstlerisches Interesse
vertrat, schon aus dem
Grunde vor dem Ein-
schmelzen bewahrt
wurde, um den Mehr-
wert ebenfalls dem guten
Zwecke zuführen zu
können. Noch mehr gilt
dies von den Antiquitäten,
die allerdings nur einen
bescheidenen Prozentsatz
unter den nach vielen,
vielen Tausenden zählen-
den Gold- und Silber-
gegenständen aus-
machten. Die Ausstellung, die alle die mehr oder
weniger erhaltungswürdigen Gegenstände vereinigte,
bot in der Tat ein sehr reiches und mannigfaches
Bild, in dem man namentlich die Schmuck- und Silber-
warenindustrie des ganzen 19. Jahrhunderts in einer
fast lückenlosen Folge übersehen konnte. Während
aus dem 17. und 18. Jahrhundert nur einige wenige
Buchschließen, glatte Becher mit Schwitzschlag, Be-
stecke oder Anhänger und nur einige wenige charakte-
ristische Rokoko-Gegenstände(Abb. 2) zusammenkamen,
war die Empirezeit, wenigstens was die bürgerlichen
Leistungen anlangt, reichhaltig vertreten; desgleichen
die Volkskunst, die vielfach mit dem Filigranschmuck
zusammenfällt, der ja seit dem 18. Jahrhundert in
Württemberg eine Spezialität namentlich von Gmünd
bildet. Einzelne der Anhänger (Abb. 7) tragen in Email-
malerei die Heilige Blutreliquie von Weingarten bei
Ravensburg.
Die künstlerisch vornehmsten Objekte sind die
B'
K9fl
BHfli
B "'imj,l-£*,,,'"^^3JB
m
K||p|
Hfe
^ft- V^v^JEs&M^B.
Ifc
iv
HsS]
Stuttgarter Edelmetall-Ausstellung des Württembergischen
Vaterlandsdanks
zahlreichen Empireleuchter (Abb. 4), denen auch ver-
schiedene reizvolle Salzschälchen, Tortenschaufeln
(Abb. 5), Zuckerzangen und dergleichen angeschlossen
werden können. Viel zahlreicher waren die noch
schlichteren Arbeiten der Biedermeierzeit vertreten,
namentlich Schalen, Schützenbecher, Serviettenringe
usw., die zum weitaus größten Teile an den klassi-
zistischen Formen festhalten, während die Romantik,
die sich in Schwaben in Uhlands Gedichten, wohl
schon früher ankündigte, aber doch erst bei der Er-
neuerung der Burgen Lichtenstein besonders bemerk-
bar machte, ganz deutlich zurücktritt. In der Tat
zählen die gotisierenden Tortenschaufeln zu den un-
erfreulichsten Erzeugnissen ihrer Zeit. Je weiter man
im ig. Jahrhundert weiterschreitet, um so unbestimmter
wird das Formengefühl. Seitdem das zweite Rokoko
kurz vor der Mitte des
Jahrhunderts die anderen
Richtungen in denHinter-
grund zu drängen sich be-
müht, scheint so ziemlich
alles durch- und neben-
einander erlaubt zu sein,
wenn auch einzelne Er-
zeugnisse,namentlich ver-
schiedene Leuchter und
Vasen (Abb. 3) einen ge-
fälligen dekorativen Auf-
bau nicht verleugnen.
Daneben sah man aller-
dings Aufsätze und Salz-
schalen in geschliffenem
Überfangglas auf recht
verwilderten Füßen,
Zuckerdosen mit Schar-
nierdeckeln von ähn-
licher Geslaltung, durch
brochene Visitenkarten-
teller von bereits be-
ängstigend dünnem Blech
und vor allem verschie-
dene Bestecke, die tech-
nisch den schärfsten Tadel herausfordern, da sie den
Spottnamen von »versilbertem Kitt« vollständig verdienen.
Was in dieser Richtung ausgestellt war, bildete allerdings
nur einen ganz kleinen Bruchteil von vielen Tausenden
von Bestecken, die bei diesem Anlaß erfreulicherweise
aus den Haushaltungen verschwanden; nur einiges von
dem ganz tadellos Erhaltenen ist noch beibehalten
worden, ebenso verschiedenes unter den vielen Tee-
seihern, Bowlenlöffeln, Torten- und Fischhebern,
Zuckerzangen, denen sich noch Dosen, Schalen, Finger-
hüte, Petschafte und dergleichen anschließen.
Der Schmuck zeigte ungefähr dieselbe Entwicklung.
Den verschiedenen Schrecksteinen und einzelnen
Kreuzchen des 17. und 18. Jahrhunderts folgten einige
sehr gute Louis-XVI-Arbeiten, unter denen »Markisen-
ringe« und Anhänger die erste Stelle einnahmen.
Den charakteristischen Broschen und Anhängern mit
Muschel-Kameen, die übrigens eine ehemalige württem-
bergische Spezialität repräsentieren (Abb. 1), gesellten
— 58 —