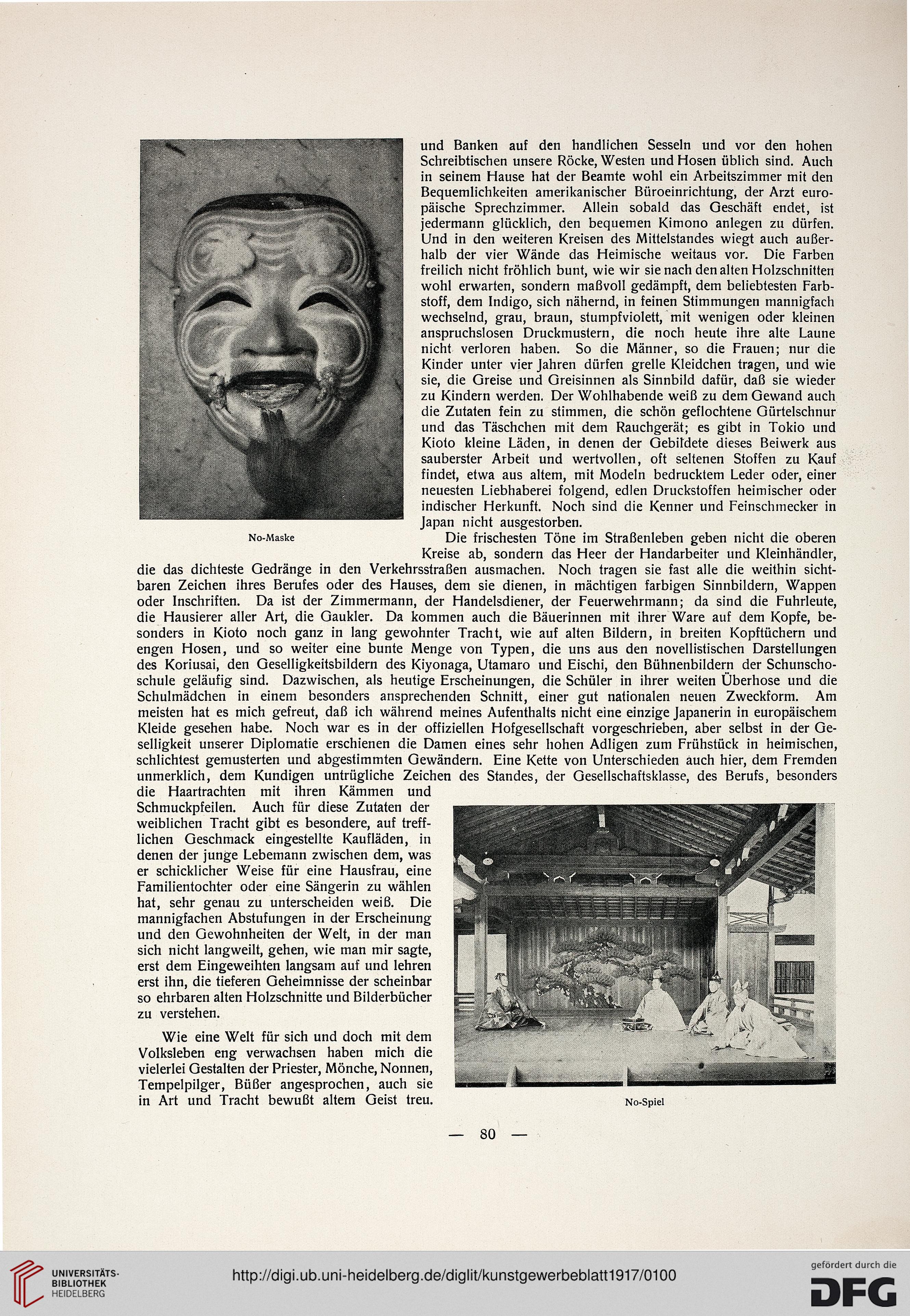No-Maske
und Banken auf den handlichen Sesseln und vor den hohen
Schreibtischen unsere Röcke, Westen und Hosen üblich sind. Auch
in seinem Hause hat der Beamte wohl ein Arbeitszimmer mit den
Bequemlichkeiten amerikanischer Büroeinrichtung, der Arzt euro-
päische Sprechzimmer. Allein sobald das Geschäft endet, ist
jedermann glücklich, den bequemen Kimono anlegen zu dürfen.
Und in den weiteren Kreisen des Mittelstandes wiegt auch außer-
halb der vier Wände das Heimische weitaus vor. Die Farben
freilich nicht fröhlich bunt, wie wir sie nach den alten Holzschnitten
wohl erwarten, sondern maßvoll gedämpft, dem beliebtesten Farb-
stoff, dem Indigo, sich nähernd, in feinen Stimmungen mannigfach
wechselnd, grau, braun, stumpfviolett, mit wenigen oder kleinen
anspruchslosen Druckmustern, die noch heute ihre alte Laune
nicht verloren haben. So die Männer, so die Frauen; nur die
Kinder unter vier Jahren dürfen grelle Kleidchen tragen, und wie
sie, die Greise und Greisinnen als Sinnbild dafür, daß sie wieder
zu Kindern werden. Der Wohlhabende weiß zu dem Gewand auch
die Zutaten fein zu stimmen, die schön geflochtene Gürtelschnur
und das Täschchen mit dem Rauchgerät; es gibt in Tokio und
Kioto kleine Läden, in denen der Gebildete dieses Beiwerk aus
sauberster Arbeit und wertvollen, oft seltenen Stoffen zu Kauf
findet, etwa aus altem, mit Modeln bedrucktem Leder oder, einer
neuesten Liebhaberei folgend, edlen Druckstoffen heimischer oder
indischer Herkunft. Noch sind die Kenner und Feinschmecker in
Japan nicht ausgestorben.
Die frischesten Töne im Straßenleben geben nicht die oberen
Kreise ab, sondern das Heer der Handarbeiter und Kleinhändler,
die das dichteste Gedränge in den Verkehrsstraßen ausmachen. Noch tragen sie fast alle die weithin sicht-
baren Zeichen ihres Berufes oder des Hauses, dem sie dienen, in mächtigen farbigen Sinnbildern, Wappen
oder Inschriften. Da ist der Zimmermann, der Handelsdiener, der Feuerwehrmann; da sind die Fuhrleute,
die Hausierer aller Art, die Gaukler. Da kommen auch die Bäuerinnen mit ihrer Ware auf dem Kopfe, be-
sonders in Kioto noch ganz in lang gewohnter Tracht, wie auf alten Bildern, in breiten Kopftüchern und
engen Hosen, und so weiter eine bunte Menge von Typen, die uns aus den novellistischen Darstellungen
des Koriusai, den Geselligkeitsbildern des Kiyonaga, Utamaro und Eischi, den Bühnenbildern der Schunscho-
schule geläufig sind. Dazwischen, als heutige Erscheinungen, die Schüler in ihrer weiten Überhose und die
Schulmädchen in einem besonders ansprechenden Schnitt, einer gut nationalen neuen Zweckform. Am
meisten hat es mich gefreut, daß ich während meines Aufenthalts nicht eine einzige Japanerin in europäischem
Kleide gesehen habe. Noch war es in der offiziellen Hofgesellschaft vorgeschrieben, aber selbst in der Ge-
selligkeit unserer Diplomatie erschienen die Damen eines sehr hohen Adligen zum Frühstück in heimischen,
schlichtest gemusterten und abgestimmten Gewändern. Eine Kette von Unterschieden auch hier, dem Fremden
unmerklich, dem Kundigen untrügliche Zeichen des Standes, der Gesellschaftsklasse, des Berufs, besonders
die Haartrachten mit ihren Kämmen und
Schmuckpfeilen. Auch für diese Zutaten der
weiblichen Tracht gibt es besondere, auf treff-
lichen Geschmack eingestellte Kaufläden, in
denen der junge Lebemann zwischen dem, was
er schicklicher Weise für eine Hausfrau, eine
Familientochter oder eine Sängerin zu wählen
hat, sehr genau zu unterscheiden weiß. Die
mannigfachen Abstufungen in der Erscheinung
und den Gewohnheiten der Welt, in der man
sich nicht langweilt, gehen, wie man mir sagte,
erst dem Eingeweihten langsam auf und lehren
erst ihn, die tieferen Geheimnisse der scheinbar
so ehrbaren alten Holzschnitte und Bilderbücher
zu verstehen.
Wie eine Welt für sich und doch mit dem
Volksleben eng verwachsen haben mich die
vielerlei Gestalten der Priester, Mönche, Nonnen,
Tempelpilger, Büßer angesprochen, auch sie
in Art und Tracht bewußt altem Geist treu. No-spiei
— 80 —
und Banken auf den handlichen Sesseln und vor den hohen
Schreibtischen unsere Röcke, Westen und Hosen üblich sind. Auch
in seinem Hause hat der Beamte wohl ein Arbeitszimmer mit den
Bequemlichkeiten amerikanischer Büroeinrichtung, der Arzt euro-
päische Sprechzimmer. Allein sobald das Geschäft endet, ist
jedermann glücklich, den bequemen Kimono anlegen zu dürfen.
Und in den weiteren Kreisen des Mittelstandes wiegt auch außer-
halb der vier Wände das Heimische weitaus vor. Die Farben
freilich nicht fröhlich bunt, wie wir sie nach den alten Holzschnitten
wohl erwarten, sondern maßvoll gedämpft, dem beliebtesten Farb-
stoff, dem Indigo, sich nähernd, in feinen Stimmungen mannigfach
wechselnd, grau, braun, stumpfviolett, mit wenigen oder kleinen
anspruchslosen Druckmustern, die noch heute ihre alte Laune
nicht verloren haben. So die Männer, so die Frauen; nur die
Kinder unter vier Jahren dürfen grelle Kleidchen tragen, und wie
sie, die Greise und Greisinnen als Sinnbild dafür, daß sie wieder
zu Kindern werden. Der Wohlhabende weiß zu dem Gewand auch
die Zutaten fein zu stimmen, die schön geflochtene Gürtelschnur
und das Täschchen mit dem Rauchgerät; es gibt in Tokio und
Kioto kleine Läden, in denen der Gebildete dieses Beiwerk aus
sauberster Arbeit und wertvollen, oft seltenen Stoffen zu Kauf
findet, etwa aus altem, mit Modeln bedrucktem Leder oder, einer
neuesten Liebhaberei folgend, edlen Druckstoffen heimischer oder
indischer Herkunft. Noch sind die Kenner und Feinschmecker in
Japan nicht ausgestorben.
Die frischesten Töne im Straßenleben geben nicht die oberen
Kreise ab, sondern das Heer der Handarbeiter und Kleinhändler,
die das dichteste Gedränge in den Verkehrsstraßen ausmachen. Noch tragen sie fast alle die weithin sicht-
baren Zeichen ihres Berufes oder des Hauses, dem sie dienen, in mächtigen farbigen Sinnbildern, Wappen
oder Inschriften. Da ist der Zimmermann, der Handelsdiener, der Feuerwehrmann; da sind die Fuhrleute,
die Hausierer aller Art, die Gaukler. Da kommen auch die Bäuerinnen mit ihrer Ware auf dem Kopfe, be-
sonders in Kioto noch ganz in lang gewohnter Tracht, wie auf alten Bildern, in breiten Kopftüchern und
engen Hosen, und so weiter eine bunte Menge von Typen, die uns aus den novellistischen Darstellungen
des Koriusai, den Geselligkeitsbildern des Kiyonaga, Utamaro und Eischi, den Bühnenbildern der Schunscho-
schule geläufig sind. Dazwischen, als heutige Erscheinungen, die Schüler in ihrer weiten Überhose und die
Schulmädchen in einem besonders ansprechenden Schnitt, einer gut nationalen neuen Zweckform. Am
meisten hat es mich gefreut, daß ich während meines Aufenthalts nicht eine einzige Japanerin in europäischem
Kleide gesehen habe. Noch war es in der offiziellen Hofgesellschaft vorgeschrieben, aber selbst in der Ge-
selligkeit unserer Diplomatie erschienen die Damen eines sehr hohen Adligen zum Frühstück in heimischen,
schlichtest gemusterten und abgestimmten Gewändern. Eine Kette von Unterschieden auch hier, dem Fremden
unmerklich, dem Kundigen untrügliche Zeichen des Standes, der Gesellschaftsklasse, des Berufs, besonders
die Haartrachten mit ihren Kämmen und
Schmuckpfeilen. Auch für diese Zutaten der
weiblichen Tracht gibt es besondere, auf treff-
lichen Geschmack eingestellte Kaufläden, in
denen der junge Lebemann zwischen dem, was
er schicklicher Weise für eine Hausfrau, eine
Familientochter oder eine Sängerin zu wählen
hat, sehr genau zu unterscheiden weiß. Die
mannigfachen Abstufungen in der Erscheinung
und den Gewohnheiten der Welt, in der man
sich nicht langweilt, gehen, wie man mir sagte,
erst dem Eingeweihten langsam auf und lehren
erst ihn, die tieferen Geheimnisse der scheinbar
so ehrbaren alten Holzschnitte und Bilderbücher
zu verstehen.
Wie eine Welt für sich und doch mit dem
Volksleben eng verwachsen haben mich die
vielerlei Gestalten der Priester, Mönche, Nonnen,
Tempelpilger, Büßer angesprochen, auch sie
in Art und Tracht bewußt altem Geist treu. No-spiei
— 80 —