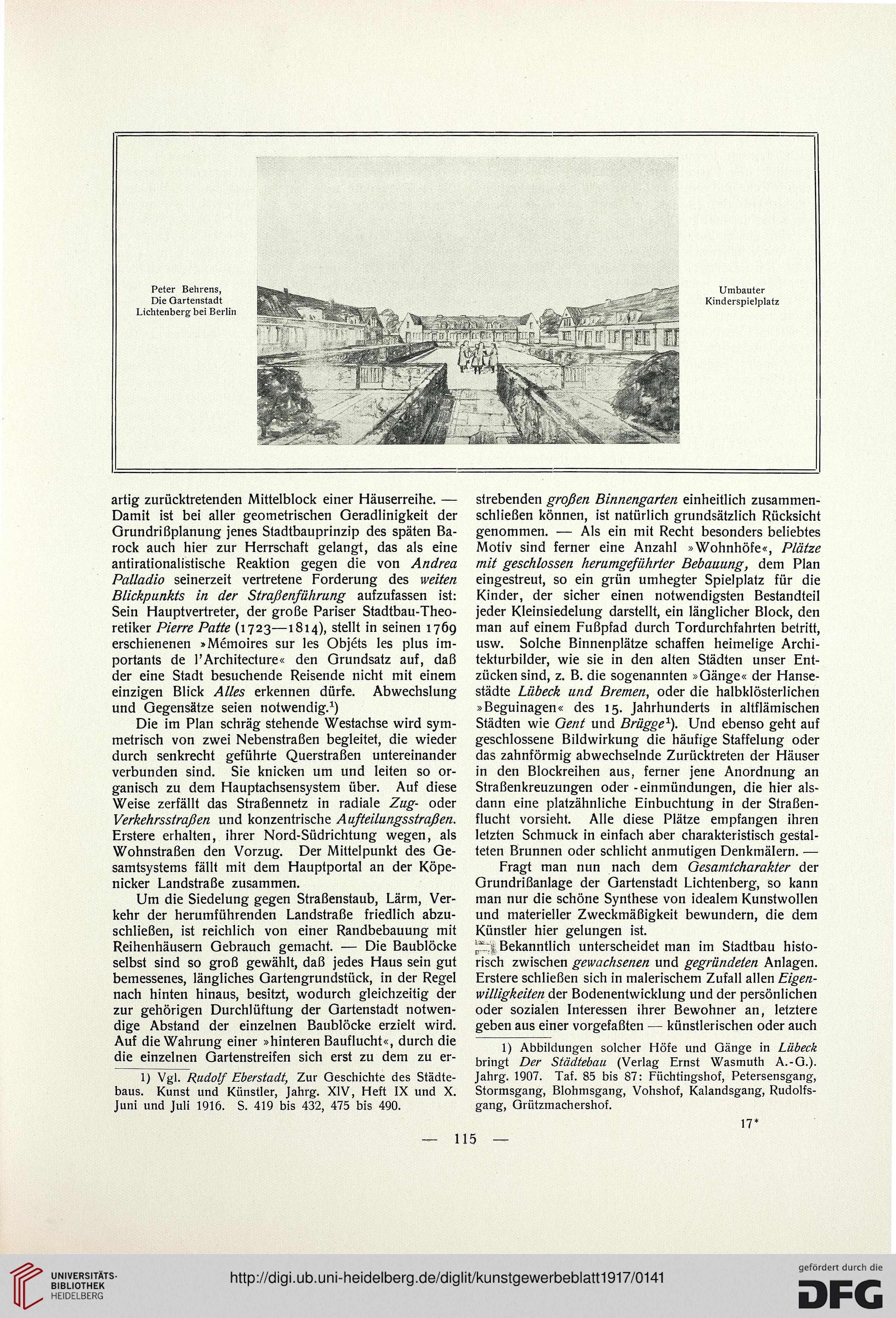Peter Behrens,
Die Gartenstadt
Lichtenberg bei Berlin
Umbauter
Kinderspielplatz
artig zurücktretenden Mittelblock einer Häuserreihe. —
Damit ist bei aller geometrischen Geradlinigkeit der
Grundrißplanung jenes Stadtbauprinzip des späten Ba-
rock auch hier zur Herrschaft gelangt, das als eine
antirationalistische Reaktion gegen die von Andrea
Palladio seinerzeit vertretene Forderung des weiten
Blickpunkts in der Straßenführung aufzufassen ist:
Sein Hauptvertreter, der große Pariser Stadtbau-Theo-
retiker Pierre Patte (1723—1814), stellt in seinen 1769
erschienenen »Memoires sur les Objets les plus im-
portants de l'Architecture« den Grundsatz auf, daß
der eine Stadt besuchende Reisende nicht mit einem
einzigen Blick Alles erkennen dürfe. Abwechslung
und Gegensätze seien notwendig.1)
Die im Plan schräg stehende Westachse wird sym-
metrisch von zwei Nebenstraßen begleitet, die wieder
durch senkrecht geführte Querstraßen untereinander
verbunden sind. Sie knicken um und leiten so or-
ganisch zu dem Hauptachsensystem über. Auf diese
Weise zerfällt das Straßennetz in radiale Zug- oder
Verkehrsstraßen und konzentrische Aufteilungsstraßen.
Erstere erhalten, ihrer Nord-Südrichtung wegen, als
Wohnstraßen den Vorzug. Der Mittelpunkt des Ge-
samtsystems fällt mit dem Hauptportal an der Köpe-
nicker Landstraße zusammen.
Um die Siedelung gegen Straßenstaub, Lärm, Ver-
kehr der herumführenden Landstraße friedlich abzu-
schließen, ist reichlich von einer Randbebauung mit
Reihenhäusern Gebrauch gemacht. — Die Baublöcke
selbst sind so groß gewählt, daß jedes Haus sein gut
bemessenes, längliches Gartengrundstück, in der Regel
nach hinten hinaus, besitzt, wodurch gleichzeitig der
zur gehörigen Durchlüftung der Gartenstadt notwen-
dige Abstand der einzelnen Baublöcke erzielt wird.
Auf die Wahrung einer »hinteren Bauflucht«, durch die
die einzelnen Gartenstreifen sich erst zu dem zu er-
1) Vgl. Rudolf Eberstadt, Zur Geschichte des Städte-
baus. Kunst und Künstler, Jahrg. XIV, Heft IX und X.
Juni und Juli 1916. S. 419 bis 432, 475 bis 490.
1
strebenden großen Binnengarten einheitlich zusammen-
schließen können, ist natürlich grundsätzlich Rücksicht
genommen. — Als ein mit Recht besonders beliebtes
Motiv sind ferner eine Anzahl »Wohnhöfe«, Plätze
mit geschlossen herumgeführter Bebauung, dem Plan
eingestreut, so ein grün umhegter Spielplatz für die
Kinder, der sicher einen notwendigsten Bestandteil
jeder Kleinsiedelung darstellt, ein länglicher Block, den
man auf einem Fußpfad durch Tordurchfahrten betritt,
usw. Solche Binnenplätze schaffen heimelige Archi-
tekturbilder, wie sie in den alten Städten unser Ent-
zücken sind, z. B. die sogenannten »Gänge« der Hanse-
städte Lübeck und Bremen, oder die halbklösterlichen
»Beguinagen« des 15. Jahrhunderts in altflämischen
Städten wie Gent und Brügge1). Und ebenso geht auf
geschlossene Bildwirkung die häufige Staffelung oder
das zahnförmig abwechselnde Zurücktreten der Häuser
in den Blockreihen aus, ferner jene Anordnung an
Straßenkreuzungen oder -einmündungen, die hier als-
dann eine platzähnliche Einbuchtung in der Straßen-
flucht vorsieht. Alle diese Plätze empfangen ihren
letzten Schmuck in einfach aber charakteristisch gestal-
teten Brunnen oder schlicht anmutigen Denkmälern. —
Fragt man nun nach dem Gesamtcharakter der
Grundrißanlage der Gartenstadt Lichtenberg, so kann
man nur die schöne Synthese von idealem Kunstwollen
und materieller Zweckmäßigkeit bewundern, die dem
Künstler hier gelungen ist.
^1 Bekanntlich unterscheidet man im Stadtbau histo-
risch zwischen gewachsenen und gegründeten Anlagen.
Erstere schließen sich in malerischem Zufall allen Eigen-
willigkeiten der Bodenentwicklung und der persönlichen
oder sozialen Interessen ihrer Bewohner an, letztere
geben aus einer vorgefaßten — künstlerischen oder auch
1) Abbildungen solcher Höfe und Gänge in Lübeck
bringt Der Städtebau (Verlag Ernst Wasmuth A.-G.).
Jahrg. 1907. Taf. 85 bis 87: Füchtingshof, Petersensgang,
Stormsgang, Blohmsgang, Vohshof, Kalandsgang, Rudolfs-
gang, Grützmachershof.
17*
15 —
Die Gartenstadt
Lichtenberg bei Berlin
Umbauter
Kinderspielplatz
artig zurücktretenden Mittelblock einer Häuserreihe. —
Damit ist bei aller geometrischen Geradlinigkeit der
Grundrißplanung jenes Stadtbauprinzip des späten Ba-
rock auch hier zur Herrschaft gelangt, das als eine
antirationalistische Reaktion gegen die von Andrea
Palladio seinerzeit vertretene Forderung des weiten
Blickpunkts in der Straßenführung aufzufassen ist:
Sein Hauptvertreter, der große Pariser Stadtbau-Theo-
retiker Pierre Patte (1723—1814), stellt in seinen 1769
erschienenen »Memoires sur les Objets les plus im-
portants de l'Architecture« den Grundsatz auf, daß
der eine Stadt besuchende Reisende nicht mit einem
einzigen Blick Alles erkennen dürfe. Abwechslung
und Gegensätze seien notwendig.1)
Die im Plan schräg stehende Westachse wird sym-
metrisch von zwei Nebenstraßen begleitet, die wieder
durch senkrecht geführte Querstraßen untereinander
verbunden sind. Sie knicken um und leiten so or-
ganisch zu dem Hauptachsensystem über. Auf diese
Weise zerfällt das Straßennetz in radiale Zug- oder
Verkehrsstraßen und konzentrische Aufteilungsstraßen.
Erstere erhalten, ihrer Nord-Südrichtung wegen, als
Wohnstraßen den Vorzug. Der Mittelpunkt des Ge-
samtsystems fällt mit dem Hauptportal an der Köpe-
nicker Landstraße zusammen.
Um die Siedelung gegen Straßenstaub, Lärm, Ver-
kehr der herumführenden Landstraße friedlich abzu-
schließen, ist reichlich von einer Randbebauung mit
Reihenhäusern Gebrauch gemacht. — Die Baublöcke
selbst sind so groß gewählt, daß jedes Haus sein gut
bemessenes, längliches Gartengrundstück, in der Regel
nach hinten hinaus, besitzt, wodurch gleichzeitig der
zur gehörigen Durchlüftung der Gartenstadt notwen-
dige Abstand der einzelnen Baublöcke erzielt wird.
Auf die Wahrung einer »hinteren Bauflucht«, durch die
die einzelnen Gartenstreifen sich erst zu dem zu er-
1) Vgl. Rudolf Eberstadt, Zur Geschichte des Städte-
baus. Kunst und Künstler, Jahrg. XIV, Heft IX und X.
Juni und Juli 1916. S. 419 bis 432, 475 bis 490.
1
strebenden großen Binnengarten einheitlich zusammen-
schließen können, ist natürlich grundsätzlich Rücksicht
genommen. — Als ein mit Recht besonders beliebtes
Motiv sind ferner eine Anzahl »Wohnhöfe«, Plätze
mit geschlossen herumgeführter Bebauung, dem Plan
eingestreut, so ein grün umhegter Spielplatz für die
Kinder, der sicher einen notwendigsten Bestandteil
jeder Kleinsiedelung darstellt, ein länglicher Block, den
man auf einem Fußpfad durch Tordurchfahrten betritt,
usw. Solche Binnenplätze schaffen heimelige Archi-
tekturbilder, wie sie in den alten Städten unser Ent-
zücken sind, z. B. die sogenannten »Gänge« der Hanse-
städte Lübeck und Bremen, oder die halbklösterlichen
»Beguinagen« des 15. Jahrhunderts in altflämischen
Städten wie Gent und Brügge1). Und ebenso geht auf
geschlossene Bildwirkung die häufige Staffelung oder
das zahnförmig abwechselnde Zurücktreten der Häuser
in den Blockreihen aus, ferner jene Anordnung an
Straßenkreuzungen oder -einmündungen, die hier als-
dann eine platzähnliche Einbuchtung in der Straßen-
flucht vorsieht. Alle diese Plätze empfangen ihren
letzten Schmuck in einfach aber charakteristisch gestal-
teten Brunnen oder schlicht anmutigen Denkmälern. —
Fragt man nun nach dem Gesamtcharakter der
Grundrißanlage der Gartenstadt Lichtenberg, so kann
man nur die schöne Synthese von idealem Kunstwollen
und materieller Zweckmäßigkeit bewundern, die dem
Künstler hier gelungen ist.
^1 Bekanntlich unterscheidet man im Stadtbau histo-
risch zwischen gewachsenen und gegründeten Anlagen.
Erstere schließen sich in malerischem Zufall allen Eigen-
willigkeiten der Bodenentwicklung und der persönlichen
oder sozialen Interessen ihrer Bewohner an, letztere
geben aus einer vorgefaßten — künstlerischen oder auch
1) Abbildungen solcher Höfe und Gänge in Lübeck
bringt Der Städtebau (Verlag Ernst Wasmuth A.-G.).
Jahrg. 1907. Taf. 85 bis 87: Füchtingshof, Petersensgang,
Stormsgang, Blohmsgang, Vohshof, Kalandsgang, Rudolfs-
gang, Grützmachershof.
17*
15 —