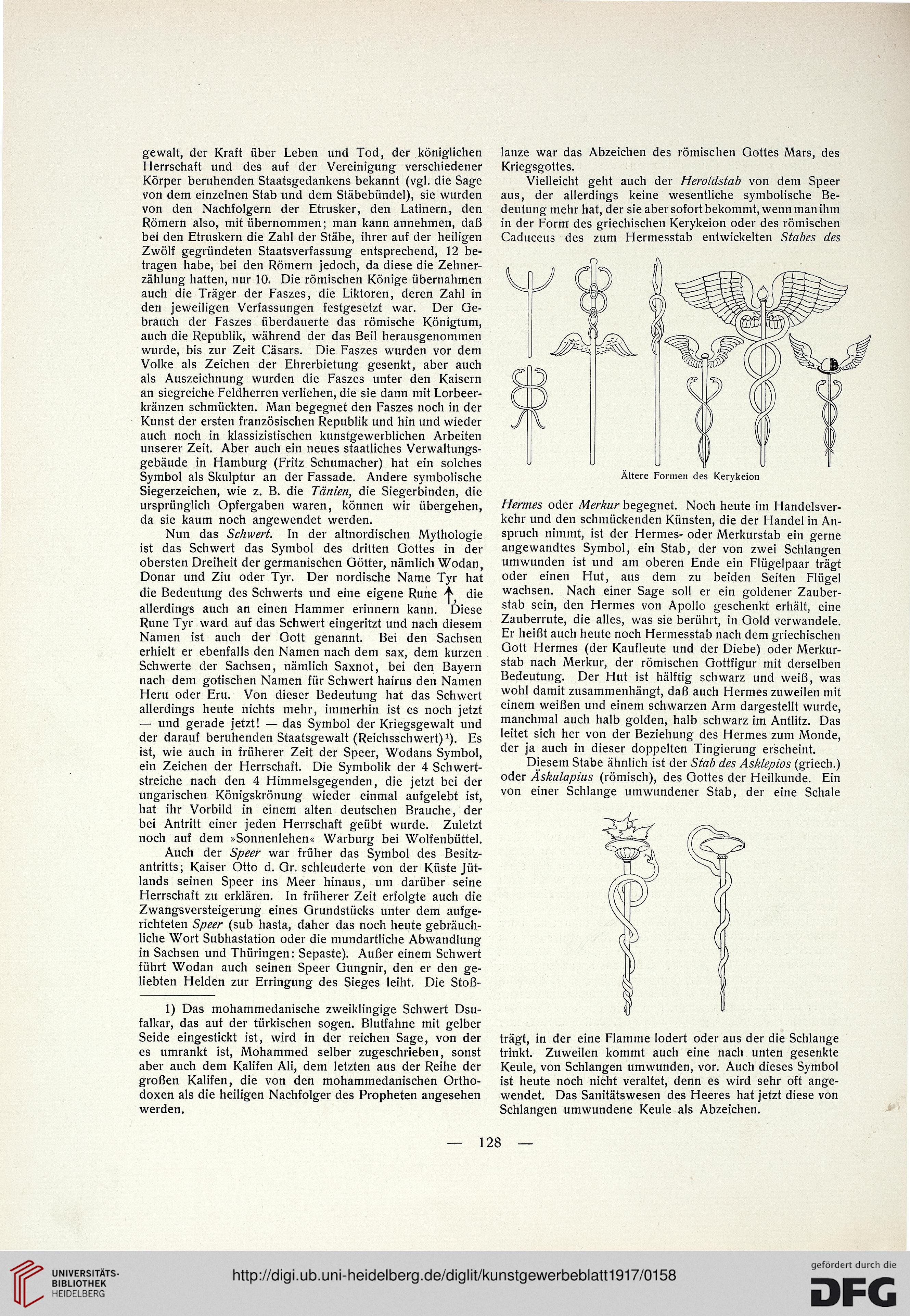gewalt, der Kraft über Leben und Tod, der königlichen
Herrschaft und des auf der Vereinigung verschiedener
Körper beruhenden Staatsgedankens bekannt (vgl. die Sage
von dem einzelnen Stab und dem Stäbebündel), sie wurden
von den Nachfolgern der Etrusker, den Latinern, den
Römern also, mitübernommen; man kann annehmen, daß
bei den Etruskern die Zahl der Stäbe, ihrer auf der heiligen
Zwölf gegründeten Staatsverfassung entsprechend, 12 be-
tragen habe, bei den Römern jedoch, da diese die Zehner-
zählung hatten, nur 10. Die römischen Könige übernahmen
auch die Träger der Faszes, die Liktoren, deren Zahl in
den jeweiligen Verfassungen festgesetzt war. Der Ge-
brauch der Faszes überdauerte das römische Königtum,
auch die Republik, während der das Beil herausgenommen
wurde, bis zur Zeit Cäsars. Die Faszes wurden vor dem
Volke als Zeichen der Ehrerbietung gesenkt, aber auch
als Auszeichnung wurden die Faszes unter den Kaisern
an siegreiche Feldherren verliehen, die sie dann mit Lorbeer-
kränzen schmückten. Man begegnet den Faszes noch in der
Kunst der ersten französischen Republik und hin und wieder
auch noch in klassizistischen kunstgewerblichen Arbeiten
unserer Zeit. Aber auch ein neues staatliches Verwaltungs-
gebäude in Hamburg (Fritz Schumacher) hat ein solches
Symbol als Skulptur an der Fassade. Andere symbolische
Siegerzeichen, wie z. B. die Tanten, die Siegerbinden, die
ursprünglich Opfergaben waren, können wir übergehen,
da sie kaum noch angewendet werden.
Nun das Schwert. In der altnordischen Mythologie
ist das Schwert das Symbol des dritten Gottes in der
obersten Dreiheit der germanischen Götter, nämlich Wodan,
Donar und Ziu oder Tyr. Der nordische Name Tyr hat
die Bedeutung des Schwerts und eine eigene Rune 4- die
allerdings auch an einen Hammer erinnern kann. Diese
Rune Tyr ward auf das Schwert eingeritzt und nach diesem
Namen ist auch der Gott genannt. Bei den Sachsen
erhielt er ebenfalls den Namen nach dem sax, dem kurzen
Schwerte der Sachsen, nämlich Saxnot, bei den Bayern
nach dem gotischen Namen für Schwert hairus den Namen
Heru oder Eru. Von dieser Bedeutung hat das Schwert
allerdings heute nichts mehr, immerhin ist es noch jetzt
— und gerade jetzt! — das Symbol der Kriegsgewalt und
der darauf beruhenden Staatsgewalt (Reichsschwert)1). Es
ist, wie auch in früherer Zeit der Speer, Wodans Symbol,
ein Zeichen der Herrschaft. Die Symbolik der 4 Schwert-
streiche nach den 4 Himmelsgegenden, die jetzt bei der
ungarischen Königskrönung wieder einmal aufgelebt ist,
hat ihr Vorbild in einem alten deutschen Brauche, der
bei Antritt einer jeden Herrschaft geübt wurde. Zuletzt
noch auf dem »Sonnenlehen« Warburg bei Wolfenbüttel.
Auch der Speer war früher das Symbol des Besitz-
antritts; Kaiser Otto d. Gr. schleuderte von der Küste Jüt-
lands seinen Speer ins Meer hinaus, um darüber seine
Herrschaft zu erklären. In früherer Zeit erfolgte auch die
Zwangsversteigerung eines Grundstücks unter dem aufge-
richteten Speer (sub hasta, daher das noch heute gebräuch-
liche Wort Subhastation oder die mundartliche Abwandlung
in Sachsen und Thüringen: Sepaste). Außer einem Schwert
führt Wodan auch seinen Speer Gungnir, den er den ge-
liebten Helden zur Erringung des Sieges leiht. Die Stoß-
1) Das mohammedanische zweiklingige Schwert Dsu-
falkar, das auf der türkischen sogen. Blutfahne mit gelber
Seide eingestickt ist, wird in der reichen Sage, von der
es umrankt ist, Mohammed selber zugeschrieben, sonst
aber auch dem Kalifen Ali, dem letzten aus der Reihe der
großen Kalifen, die von den mohammedanischen Ortho-
doxen als die heiligen Nachfolger des Propheten angesehen
werden.
lanze war das Abzeichen des römischen Gottes Mars, des
Kriegsgottes.
Vielleicht geht auch der Heroldstab von dem Speer
aus, der allerdings keine wesentliche symbolische Be-
deutung mehr hat, der sie aber sofort bekommt, wenn man ihm
in der Form des griechischen Kerykeion oder des römischen
Caduceus des zum Hermesstab entwickelten Stabes des
Ältere Formen des Kerykeion
Hermes oder Merkur begegnet. Noch heute im Handelsver-
kehr und den schmückenden Künsten, die der Handel in An-
spruch nimmt, ist der Hermes- oder Merkurstab ein gerne
angewandtes Symbol, ein Stab, der von zwei Schlangen
umwunden ist und am oberen Ende ein Flügelpaar trägt
oder einen Hut, aus dem zu beiden Seiten Flügel
wachsen. Nach einer Sage soll er ein goldener Zauber-
stab sein, den Hermes von Apollo geschenkt erhält, eine
Zauberrute, die alles, was sie berührt, in Gold verwandele.
Er heißt auch heute noch Hermesstab nach dem griechischen
Gott Hermes (der Kaufleute und der Diebe) oder Merkur-
stab nach Merkur, der römischen Gottfigur mit derselben
Bedeutung. Der Hut ist hälftig schwarz und weiß, was
wohl damit zusammenhängt, daß auch Hermes zuweilen mit
einem weißen und einem schwarzen Arm dargestellt wurde,
manchmal auch halb golden, halb schwarz im Antlitz. Das
leitet sich her von der Beziehung des Hermes zum Monde,
der ja auch in dieser doppelten Tingierung erscheint.
Diesem Stabe ähnlich ist der Stab des Asklepios (griech.)
oder Äskulapius (römisch), des Gottes der Heilkunde. Ein
von einer Schlange umwundener Stab, der eine Schale
trägt, in der eine Flamme lodert oder aus der die Schlange
trinkt. Zuweilen kommt auch eine nach unten gesenkte
Keule, von Schlangen umwunden, vor. Auch dieses Symbol
ist heute noch nicht veraltet, denn es wird sehr oft ange-
wendet. Das Sanitätswesen des Heeres hat jetzt diese von
Schlangen umwundene Keule als Abzeichen.
— 128
Herrschaft und des auf der Vereinigung verschiedener
Körper beruhenden Staatsgedankens bekannt (vgl. die Sage
von dem einzelnen Stab und dem Stäbebündel), sie wurden
von den Nachfolgern der Etrusker, den Latinern, den
Römern also, mitübernommen; man kann annehmen, daß
bei den Etruskern die Zahl der Stäbe, ihrer auf der heiligen
Zwölf gegründeten Staatsverfassung entsprechend, 12 be-
tragen habe, bei den Römern jedoch, da diese die Zehner-
zählung hatten, nur 10. Die römischen Könige übernahmen
auch die Träger der Faszes, die Liktoren, deren Zahl in
den jeweiligen Verfassungen festgesetzt war. Der Ge-
brauch der Faszes überdauerte das römische Königtum,
auch die Republik, während der das Beil herausgenommen
wurde, bis zur Zeit Cäsars. Die Faszes wurden vor dem
Volke als Zeichen der Ehrerbietung gesenkt, aber auch
als Auszeichnung wurden die Faszes unter den Kaisern
an siegreiche Feldherren verliehen, die sie dann mit Lorbeer-
kränzen schmückten. Man begegnet den Faszes noch in der
Kunst der ersten französischen Republik und hin und wieder
auch noch in klassizistischen kunstgewerblichen Arbeiten
unserer Zeit. Aber auch ein neues staatliches Verwaltungs-
gebäude in Hamburg (Fritz Schumacher) hat ein solches
Symbol als Skulptur an der Fassade. Andere symbolische
Siegerzeichen, wie z. B. die Tanten, die Siegerbinden, die
ursprünglich Opfergaben waren, können wir übergehen,
da sie kaum noch angewendet werden.
Nun das Schwert. In der altnordischen Mythologie
ist das Schwert das Symbol des dritten Gottes in der
obersten Dreiheit der germanischen Götter, nämlich Wodan,
Donar und Ziu oder Tyr. Der nordische Name Tyr hat
die Bedeutung des Schwerts und eine eigene Rune 4- die
allerdings auch an einen Hammer erinnern kann. Diese
Rune Tyr ward auf das Schwert eingeritzt und nach diesem
Namen ist auch der Gott genannt. Bei den Sachsen
erhielt er ebenfalls den Namen nach dem sax, dem kurzen
Schwerte der Sachsen, nämlich Saxnot, bei den Bayern
nach dem gotischen Namen für Schwert hairus den Namen
Heru oder Eru. Von dieser Bedeutung hat das Schwert
allerdings heute nichts mehr, immerhin ist es noch jetzt
— und gerade jetzt! — das Symbol der Kriegsgewalt und
der darauf beruhenden Staatsgewalt (Reichsschwert)1). Es
ist, wie auch in früherer Zeit der Speer, Wodans Symbol,
ein Zeichen der Herrschaft. Die Symbolik der 4 Schwert-
streiche nach den 4 Himmelsgegenden, die jetzt bei der
ungarischen Königskrönung wieder einmal aufgelebt ist,
hat ihr Vorbild in einem alten deutschen Brauche, der
bei Antritt einer jeden Herrschaft geübt wurde. Zuletzt
noch auf dem »Sonnenlehen« Warburg bei Wolfenbüttel.
Auch der Speer war früher das Symbol des Besitz-
antritts; Kaiser Otto d. Gr. schleuderte von der Küste Jüt-
lands seinen Speer ins Meer hinaus, um darüber seine
Herrschaft zu erklären. In früherer Zeit erfolgte auch die
Zwangsversteigerung eines Grundstücks unter dem aufge-
richteten Speer (sub hasta, daher das noch heute gebräuch-
liche Wort Subhastation oder die mundartliche Abwandlung
in Sachsen und Thüringen: Sepaste). Außer einem Schwert
führt Wodan auch seinen Speer Gungnir, den er den ge-
liebten Helden zur Erringung des Sieges leiht. Die Stoß-
1) Das mohammedanische zweiklingige Schwert Dsu-
falkar, das auf der türkischen sogen. Blutfahne mit gelber
Seide eingestickt ist, wird in der reichen Sage, von der
es umrankt ist, Mohammed selber zugeschrieben, sonst
aber auch dem Kalifen Ali, dem letzten aus der Reihe der
großen Kalifen, die von den mohammedanischen Ortho-
doxen als die heiligen Nachfolger des Propheten angesehen
werden.
lanze war das Abzeichen des römischen Gottes Mars, des
Kriegsgottes.
Vielleicht geht auch der Heroldstab von dem Speer
aus, der allerdings keine wesentliche symbolische Be-
deutung mehr hat, der sie aber sofort bekommt, wenn man ihm
in der Form des griechischen Kerykeion oder des römischen
Caduceus des zum Hermesstab entwickelten Stabes des
Ältere Formen des Kerykeion
Hermes oder Merkur begegnet. Noch heute im Handelsver-
kehr und den schmückenden Künsten, die der Handel in An-
spruch nimmt, ist der Hermes- oder Merkurstab ein gerne
angewandtes Symbol, ein Stab, der von zwei Schlangen
umwunden ist und am oberen Ende ein Flügelpaar trägt
oder einen Hut, aus dem zu beiden Seiten Flügel
wachsen. Nach einer Sage soll er ein goldener Zauber-
stab sein, den Hermes von Apollo geschenkt erhält, eine
Zauberrute, die alles, was sie berührt, in Gold verwandele.
Er heißt auch heute noch Hermesstab nach dem griechischen
Gott Hermes (der Kaufleute und der Diebe) oder Merkur-
stab nach Merkur, der römischen Gottfigur mit derselben
Bedeutung. Der Hut ist hälftig schwarz und weiß, was
wohl damit zusammenhängt, daß auch Hermes zuweilen mit
einem weißen und einem schwarzen Arm dargestellt wurde,
manchmal auch halb golden, halb schwarz im Antlitz. Das
leitet sich her von der Beziehung des Hermes zum Monde,
der ja auch in dieser doppelten Tingierung erscheint.
Diesem Stabe ähnlich ist der Stab des Asklepios (griech.)
oder Äskulapius (römisch), des Gottes der Heilkunde. Ein
von einer Schlange umwundener Stab, der eine Schale
trägt, in der eine Flamme lodert oder aus der die Schlange
trinkt. Zuweilen kommt auch eine nach unten gesenkte
Keule, von Schlangen umwunden, vor. Auch dieses Symbol
ist heute noch nicht veraltet, denn es wird sehr oft ange-
wendet. Das Sanitätswesen des Heeres hat jetzt diese von
Schlangen umwundene Keule als Abzeichen.
— 128