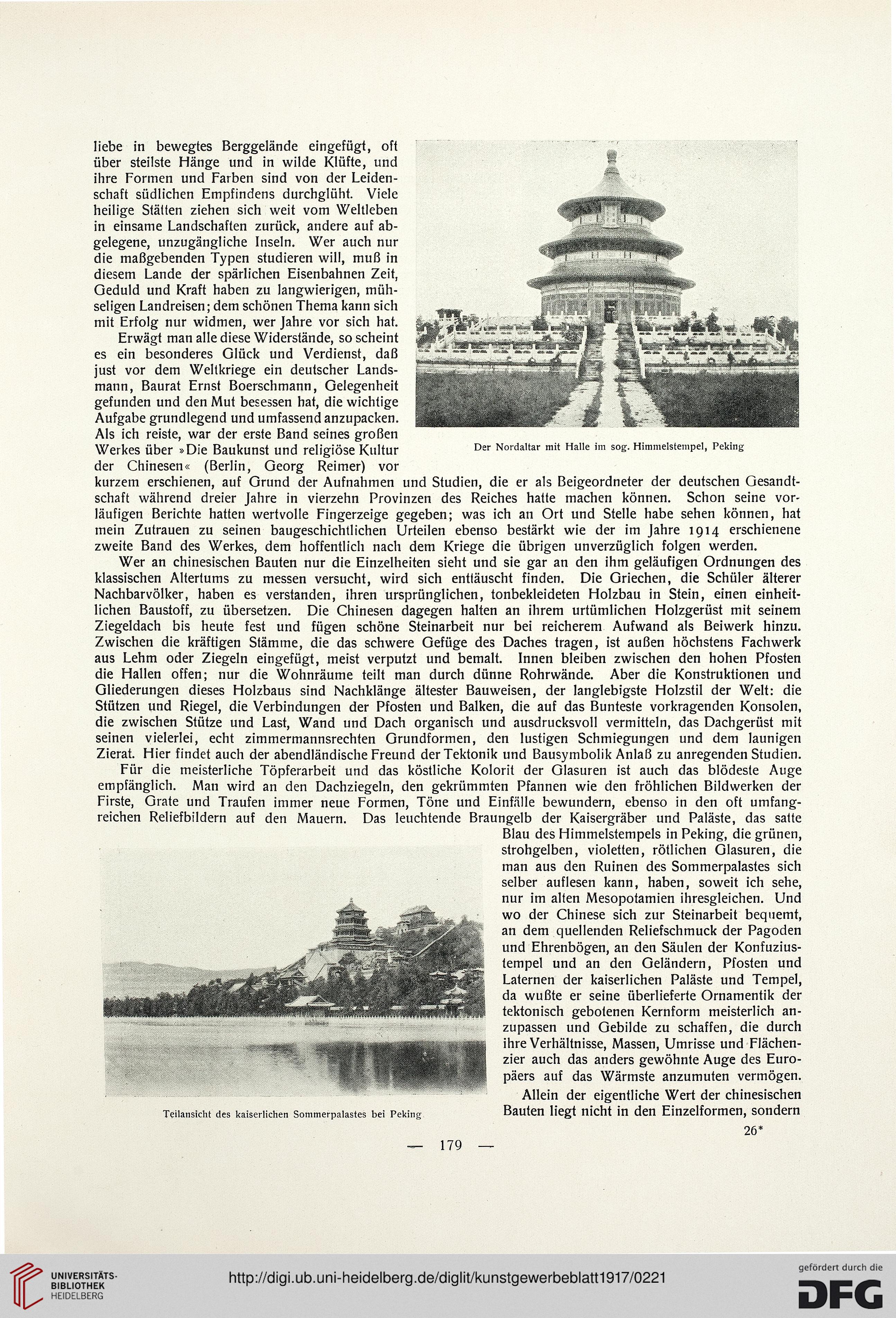Der Nordaltar mit Halle im sog. Himmelstempel, Peking
liebe in bewegtes Berggelände eingefügt, oft
über steilste Hänge und in wilde Klüfte, und
ihre Formen und Farben sind von der Leiden-
schaft südlichen Empfindens durchglüht. Viele
heilige Stätten ziehen sich weit vom Weltleben
in einsame Landschaften zurück, andere auf ab-
gelegene, unzugängliche Inseln. Wer auch nur
die maßgebenden Typen studieren will, muß in
diesem Lande der spärlichen Eisenbahnen Zeit,
Geduld und Kraft haben zu langwierigen, müh-
seligen Landreisen; dem schönen Thema kann sich
mit Erfolg nur widmen, wer Jahre vor sich hat.
Erwägt man alle diese Widerstände, so scheint
es ein besonderes Glück und Verdienst, daß
just vor dem Weltkriege ein deutscher Lands-
mann, Baurat Ernst Boerschmann, Gelegenheit
gefunden und den Mut besessen hat, die wichtige
Aufgabe grundlegend und umfassend anzupacken.
Als ich reiste, war der erste Band seines großen
Werkes über »Die Baukunst und religiöse Kultur
der Chinesen« (Berlin, Georg Reimer) vor
kurzem erschienen, auf Grund der Aufnahmen und Studien, die er als Beigeordneter der deutschen Gesandt-
schaft während dreier Jahre in vierzehn Provinzen des Reiches hatte machen können. Schon seine vor-
läufigen Berichte hatten wertvolle Fingerzeige gegeben; was ich an Ort und Stelle habe sehen können, hat
mein Zutrauen zu seinen baugeschichtlichen Urteilen ebenso bestärkt wie der im Jahre 1914 erschienene
zweite Band des Werkes, dem hoffentlich nach dem Kriege die übrigen unverzüglich folgen werden.
Wer an chinesischen Bauten nur die Einzelheiten sieht und sie gar an den ihm geläufigen Ordnungen des
klassischen Altertums zu messen versucht, wird sich enttäuscht finden. Die Griechen, die Schüler älterer
Nachbarvölker, haben es verstanden, ihren ursprünglichen, tonbekleideten Holzbau in Stein, einen einheit-
lichen Baustoff, zu übersetzen. Die Chinesen dagegen halten an ihrem urtümlichen Holzgerüst mit seinem
Ziegeldach bis heute fest und fügen schöne Steinarbeit nur bei reicherem Aufwand als Beiwerk hinzu.
Zwischen die kräftigen Stämme, die das schwere Gefüge des Daches tragen, ist außen höchstens Fachwerk
aus Lehm oder Ziegeln eingefügt, meist verputzt und bemalt. Innen bleiben zwischen den hohen Pfosten
die Hallen offen; nur die Wohnräume teilt man durch dünne Rohrwände. Aber die Konstruktionen und
Gliederungen dieses Holzbaus sind Nachklänge ältester Bauweisen, der langlebigste Holzstil der Welt: die
Stützen und Riegel, die Verbindungen der Pfosten und Balken, die auf das Bunteste vorkragenden Konsolen,
die zwischen Stütze und Last, Wand und Dach organisch und ausdrucksvoll vermitteln, das Dachgerüst mit
seinen vielerlei, echt zimmermannsrechten Grundformen, den lustigen Schmiegungen und dem launigen
Zierat. Hier findet auch der abendländische Freund der Tektonik und Bausymbolik Anlaß zu anregenden Studien.
Für die meisterliche Töpferarbeit und das köstliche Kolorit der Glasuren ist auch das blödeste Auge
empfänglich. Man wird an den Dachziegeln, den gekrümmten Pfannen wie den fröhlichen Bildwerken der
Firste, Grate und Traufen immer neue Formen, Töne und Einfälle bewundern, ebenso in den oft umfang-
reichen Reliefbildern auf den Mauern. Das leuchtende Braungelb der Kaisergräber und Paläste, das satte
Blau des Himmelstempels in Peking, die grünen,
strohgelben, violetten, rötlichen Glasuren, die
man aus den Ruinen des Sommerpalastes sich
selber auflesen kann, haben, soweit ich sehe,
nur im alten Mesopotamien ihresgleichen. Und
wo der Chinese sich zur Steinarbeit bequemt,
an dem quellenden Reliefschmuck der Pagoden
und Ehrenbögen, an den Säulen der Konfuzius-
tempel und an den Geländern, Pfosten und
Laternen der kaiserlichen Paläste und Tempel,
da wußte er seine überlieferte Ornamentik der
tektonisch gebotenen Kernform meisterlich an-
zupassen und Gebilde zu schaffen, die durch
ihre Verhältnisse, Massen, Umrisse und Flächen-
zier auch das anders gewöhnte Auge des Euro-
päers auf das Wärmste anzumuten vermögen.
Allein der eigentliche Wert der chinesischen
Bauten liegt nicht in den Einzelformen, sondern
26*
Teilansicht des kaiserlichen Sommerpalastes bei Peking
— 179
liebe in bewegtes Berggelände eingefügt, oft
über steilste Hänge und in wilde Klüfte, und
ihre Formen und Farben sind von der Leiden-
schaft südlichen Empfindens durchglüht. Viele
heilige Stätten ziehen sich weit vom Weltleben
in einsame Landschaften zurück, andere auf ab-
gelegene, unzugängliche Inseln. Wer auch nur
die maßgebenden Typen studieren will, muß in
diesem Lande der spärlichen Eisenbahnen Zeit,
Geduld und Kraft haben zu langwierigen, müh-
seligen Landreisen; dem schönen Thema kann sich
mit Erfolg nur widmen, wer Jahre vor sich hat.
Erwägt man alle diese Widerstände, so scheint
es ein besonderes Glück und Verdienst, daß
just vor dem Weltkriege ein deutscher Lands-
mann, Baurat Ernst Boerschmann, Gelegenheit
gefunden und den Mut besessen hat, die wichtige
Aufgabe grundlegend und umfassend anzupacken.
Als ich reiste, war der erste Band seines großen
Werkes über »Die Baukunst und religiöse Kultur
der Chinesen« (Berlin, Georg Reimer) vor
kurzem erschienen, auf Grund der Aufnahmen und Studien, die er als Beigeordneter der deutschen Gesandt-
schaft während dreier Jahre in vierzehn Provinzen des Reiches hatte machen können. Schon seine vor-
läufigen Berichte hatten wertvolle Fingerzeige gegeben; was ich an Ort und Stelle habe sehen können, hat
mein Zutrauen zu seinen baugeschichtlichen Urteilen ebenso bestärkt wie der im Jahre 1914 erschienene
zweite Band des Werkes, dem hoffentlich nach dem Kriege die übrigen unverzüglich folgen werden.
Wer an chinesischen Bauten nur die Einzelheiten sieht und sie gar an den ihm geläufigen Ordnungen des
klassischen Altertums zu messen versucht, wird sich enttäuscht finden. Die Griechen, die Schüler älterer
Nachbarvölker, haben es verstanden, ihren ursprünglichen, tonbekleideten Holzbau in Stein, einen einheit-
lichen Baustoff, zu übersetzen. Die Chinesen dagegen halten an ihrem urtümlichen Holzgerüst mit seinem
Ziegeldach bis heute fest und fügen schöne Steinarbeit nur bei reicherem Aufwand als Beiwerk hinzu.
Zwischen die kräftigen Stämme, die das schwere Gefüge des Daches tragen, ist außen höchstens Fachwerk
aus Lehm oder Ziegeln eingefügt, meist verputzt und bemalt. Innen bleiben zwischen den hohen Pfosten
die Hallen offen; nur die Wohnräume teilt man durch dünne Rohrwände. Aber die Konstruktionen und
Gliederungen dieses Holzbaus sind Nachklänge ältester Bauweisen, der langlebigste Holzstil der Welt: die
Stützen und Riegel, die Verbindungen der Pfosten und Balken, die auf das Bunteste vorkragenden Konsolen,
die zwischen Stütze und Last, Wand und Dach organisch und ausdrucksvoll vermitteln, das Dachgerüst mit
seinen vielerlei, echt zimmermannsrechten Grundformen, den lustigen Schmiegungen und dem launigen
Zierat. Hier findet auch der abendländische Freund der Tektonik und Bausymbolik Anlaß zu anregenden Studien.
Für die meisterliche Töpferarbeit und das köstliche Kolorit der Glasuren ist auch das blödeste Auge
empfänglich. Man wird an den Dachziegeln, den gekrümmten Pfannen wie den fröhlichen Bildwerken der
Firste, Grate und Traufen immer neue Formen, Töne und Einfälle bewundern, ebenso in den oft umfang-
reichen Reliefbildern auf den Mauern. Das leuchtende Braungelb der Kaisergräber und Paläste, das satte
Blau des Himmelstempels in Peking, die grünen,
strohgelben, violetten, rötlichen Glasuren, die
man aus den Ruinen des Sommerpalastes sich
selber auflesen kann, haben, soweit ich sehe,
nur im alten Mesopotamien ihresgleichen. Und
wo der Chinese sich zur Steinarbeit bequemt,
an dem quellenden Reliefschmuck der Pagoden
und Ehrenbögen, an den Säulen der Konfuzius-
tempel und an den Geländern, Pfosten und
Laternen der kaiserlichen Paläste und Tempel,
da wußte er seine überlieferte Ornamentik der
tektonisch gebotenen Kernform meisterlich an-
zupassen und Gebilde zu schaffen, die durch
ihre Verhältnisse, Massen, Umrisse und Flächen-
zier auch das anders gewöhnte Auge des Euro-
päers auf das Wärmste anzumuten vermögen.
Allein der eigentliche Wert der chinesischen
Bauten liegt nicht in den Einzelformen, sondern
26*
Teilansicht des kaiserlichen Sommerpalastes bei Peking
— 179