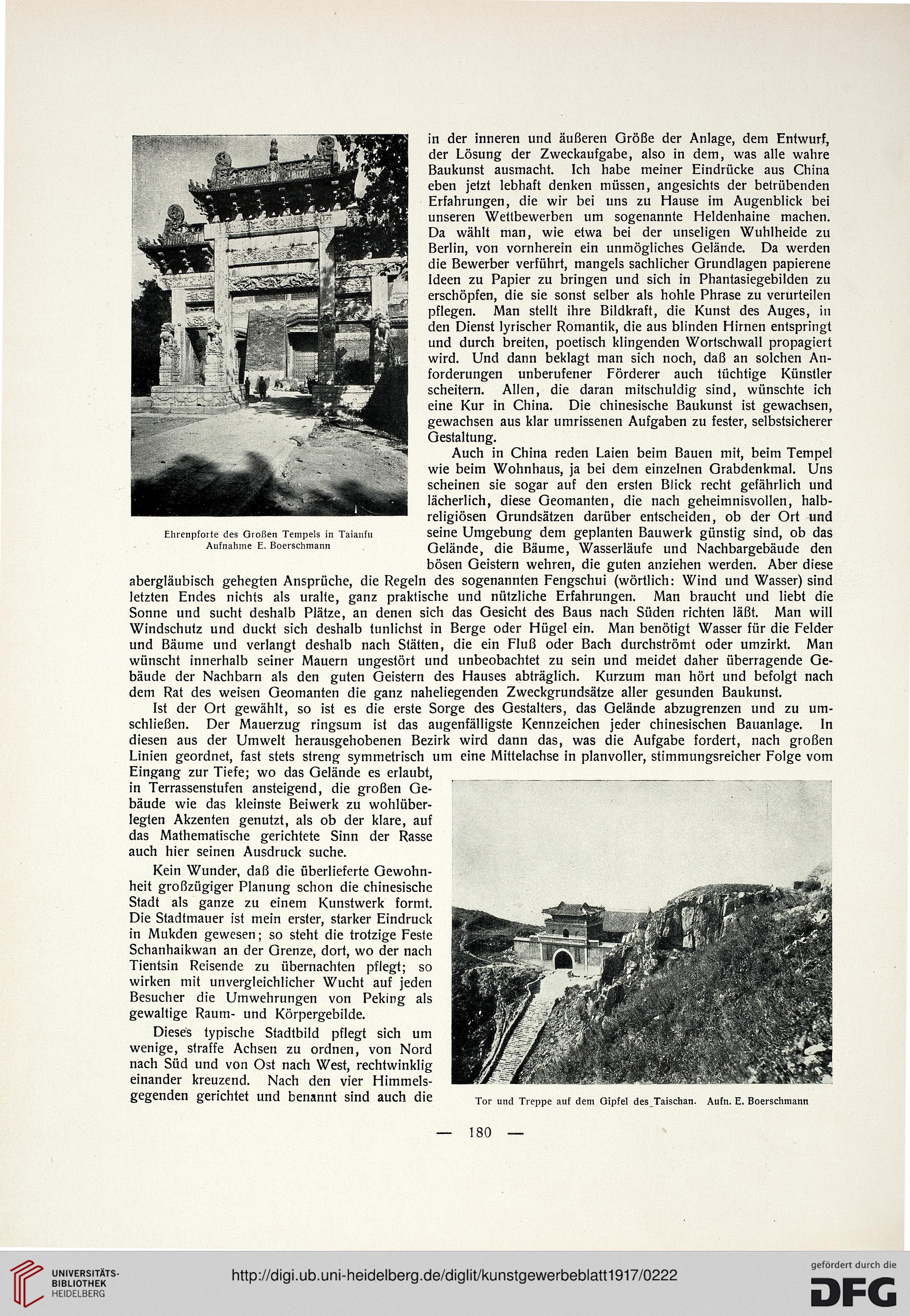Ehrenpforte des Großen Tempels in Taianfn
Aufnahme E. Boerschmann
in der inneren und äußeren Größe der Anlage, dem Entwurf,
der Lösung der Zweckaufgabe, also in dem, was alle wahre
Baukunst ausmacht. Ich habe meiner Eindrücke aus China
eben jetzt lebhaft denken müssen, angesichts der betrübenden
Erfahrungen, die wir bei uns zu Hause im Augenblick bei
unseren Wettbewerben um sogenannte Heldenhaine machen.
Da wählt man, wie etwa bei der unseligen Wuhlheide zu
Berlin, von vornherein ein unmögliches Gelände. Da werden
die Bewerber verführt, mangels sachlicher Grundlagen papierene
Ideen zu Papier zu bringen und sich in Phantasiegebilden zu
erschöpfen, die sie sonst selber als hohle Phrase zu verurteilen
pflegen. Man stellt ihre Bildkraft, die Kunst des Auges, in
den Dienst lyrischer Romantik, die aus blinden Hirnen entspringt
und durch breiten, poetisch klingenden Wortschwall propagiert
wird. Und dann beklagt man sich noch, daß an solchen An-
forderungen unberufener Förderer auch tüchtige Künstler
scheitern. Allen, die daran mitschuldig sind, wünschte ich
eine Kur in China. Die chinesische Baukunst ist gewachsen,
gewachsen aus klar umrissenen Aufgaben zu fester, selbstsicherer
Gestaltung.
Auch in China reden Laien beim Bauen mit, beim Tempel
wie beim Wohnhaus, ja bei dem einzelnen Grabdenkmal. Uns
scheinen sie sogar auf den ersten Blick recht gefährlich und
lächerlich, diese Geomanten, die nach geheimnisvollen, halb-
religiösen Grundsätzen darüber entscheiden, ob der Ort und
seine Umgebung dem geplanten Bauwerk günstig sind, ob das
Gelände, die Bäume, Wasserläufe und Nachbargebäude den
bösen Geistern wehren, die guten anziehen werden. Aber diese
abergläubisch gehegten Ansprüche, die Regeln des sogenannten Fengschui (wörtlich: Wind und Wasser) sind
letzten Endes nichts als uralte, ganz praktische und nützliche Erfahrungen. Man braucht und liebt die
Sonne und sucht deshalb Plätze, an denen sich das Gesicht des Baus nach Süden richten läßt. Man will
Windschutz und duckt sich deshalb tunlichst in Berge oder Hügel ein. Man benötigt Wasser für die Felder
und Bäume und verlangt deshalb nach Stätten, die ein Fluß oder Bach durchströmt oder umzirkt. Man
wünscht innerhalb seiner Mauern ungestört und unbeobachtet zu sein und meidet daher überragende Ge-
bäude der Nachbarn als den guten Geistern des Hauses abträglich. Kurzum man hört und befolgt nach
dem Rat des weisen Geomanten die ganz naheliegenden Zweckgrundsätze aller gesunden Baukunst.
Ist der Ort gewählt, so ist es die erste Sorge des Gestalters, das Gelände abzugrenzen und zu um-
schließen. Der Mauerzug ringsum ist das augenfälligste Kennzeichen jeder chinesischen Bauanlage. In
diesen aus der Umwelt herausgehobenen Bezirk wird dann das, was die Aufgabe fordert, nach großen
Linien geordnet, fast stets streng symmetrisch um eine Mittelachse in planvoller, stimmungsreicher Folge vom
Eingang zur Tiefe; wo das Gelände es erlaubt, ________________________„___
in Terrassenstufen ansteigend, die großen Ge-
bäude wie das kleinste Beiwerk zu wohlüber-
legten Akzenten genutzt, als ob der klare, auf
das Mathematische gerichtete Sinn der Rasse
auch hier seinen Ausdruck suche.
Kein Wunder, daß die überlieferte Gewohn-
heit großzügiger Planung schon die chinesische
Stadt als ganze zu einem Kunstwerk formt.
Die Stadtmauer ist mein erster, starker Eindruck
in Mukden gewesen; so steht die trotzige Feste
Schanhaikwan an der Grenze, dort, wo der nach
Tientsin Reisende zu übernachten pflegt; so
wirken mit unvergleichlicher Wucht auf jeden
Besucher die Umwehrungen von Peking als
gewaltige Raum- und Körpergebilde.
Dieses typische Stadtbild pflegt sich um
wenige, straffe Achsen zu ordnen, von Nord
nach Süd und von Ost nach West, rechtwinklig
einander kreuzend. Nach den vier Himmels-
gegenden gerichtet und benannt sind auch die Tor und Treppe auf dem Giptel des Taischan. Aufn. E, Boerschmann
180 —
Aufnahme E. Boerschmann
in der inneren und äußeren Größe der Anlage, dem Entwurf,
der Lösung der Zweckaufgabe, also in dem, was alle wahre
Baukunst ausmacht. Ich habe meiner Eindrücke aus China
eben jetzt lebhaft denken müssen, angesichts der betrübenden
Erfahrungen, die wir bei uns zu Hause im Augenblick bei
unseren Wettbewerben um sogenannte Heldenhaine machen.
Da wählt man, wie etwa bei der unseligen Wuhlheide zu
Berlin, von vornherein ein unmögliches Gelände. Da werden
die Bewerber verführt, mangels sachlicher Grundlagen papierene
Ideen zu Papier zu bringen und sich in Phantasiegebilden zu
erschöpfen, die sie sonst selber als hohle Phrase zu verurteilen
pflegen. Man stellt ihre Bildkraft, die Kunst des Auges, in
den Dienst lyrischer Romantik, die aus blinden Hirnen entspringt
und durch breiten, poetisch klingenden Wortschwall propagiert
wird. Und dann beklagt man sich noch, daß an solchen An-
forderungen unberufener Förderer auch tüchtige Künstler
scheitern. Allen, die daran mitschuldig sind, wünschte ich
eine Kur in China. Die chinesische Baukunst ist gewachsen,
gewachsen aus klar umrissenen Aufgaben zu fester, selbstsicherer
Gestaltung.
Auch in China reden Laien beim Bauen mit, beim Tempel
wie beim Wohnhaus, ja bei dem einzelnen Grabdenkmal. Uns
scheinen sie sogar auf den ersten Blick recht gefährlich und
lächerlich, diese Geomanten, die nach geheimnisvollen, halb-
religiösen Grundsätzen darüber entscheiden, ob der Ort und
seine Umgebung dem geplanten Bauwerk günstig sind, ob das
Gelände, die Bäume, Wasserläufe und Nachbargebäude den
bösen Geistern wehren, die guten anziehen werden. Aber diese
abergläubisch gehegten Ansprüche, die Regeln des sogenannten Fengschui (wörtlich: Wind und Wasser) sind
letzten Endes nichts als uralte, ganz praktische und nützliche Erfahrungen. Man braucht und liebt die
Sonne und sucht deshalb Plätze, an denen sich das Gesicht des Baus nach Süden richten läßt. Man will
Windschutz und duckt sich deshalb tunlichst in Berge oder Hügel ein. Man benötigt Wasser für die Felder
und Bäume und verlangt deshalb nach Stätten, die ein Fluß oder Bach durchströmt oder umzirkt. Man
wünscht innerhalb seiner Mauern ungestört und unbeobachtet zu sein und meidet daher überragende Ge-
bäude der Nachbarn als den guten Geistern des Hauses abträglich. Kurzum man hört und befolgt nach
dem Rat des weisen Geomanten die ganz naheliegenden Zweckgrundsätze aller gesunden Baukunst.
Ist der Ort gewählt, so ist es die erste Sorge des Gestalters, das Gelände abzugrenzen und zu um-
schließen. Der Mauerzug ringsum ist das augenfälligste Kennzeichen jeder chinesischen Bauanlage. In
diesen aus der Umwelt herausgehobenen Bezirk wird dann das, was die Aufgabe fordert, nach großen
Linien geordnet, fast stets streng symmetrisch um eine Mittelachse in planvoller, stimmungsreicher Folge vom
Eingang zur Tiefe; wo das Gelände es erlaubt, ________________________„___
in Terrassenstufen ansteigend, die großen Ge-
bäude wie das kleinste Beiwerk zu wohlüber-
legten Akzenten genutzt, als ob der klare, auf
das Mathematische gerichtete Sinn der Rasse
auch hier seinen Ausdruck suche.
Kein Wunder, daß die überlieferte Gewohn-
heit großzügiger Planung schon die chinesische
Stadt als ganze zu einem Kunstwerk formt.
Die Stadtmauer ist mein erster, starker Eindruck
in Mukden gewesen; so steht die trotzige Feste
Schanhaikwan an der Grenze, dort, wo der nach
Tientsin Reisende zu übernachten pflegt; so
wirken mit unvergleichlicher Wucht auf jeden
Besucher die Umwehrungen von Peking als
gewaltige Raum- und Körpergebilde.
Dieses typische Stadtbild pflegt sich um
wenige, straffe Achsen zu ordnen, von Nord
nach Süd und von Ost nach West, rechtwinklig
einander kreuzend. Nach den vier Himmels-
gegenden gerichtet und benannt sind auch die Tor und Treppe auf dem Giptel des Taischan. Aufn. E, Boerschmann
180 —