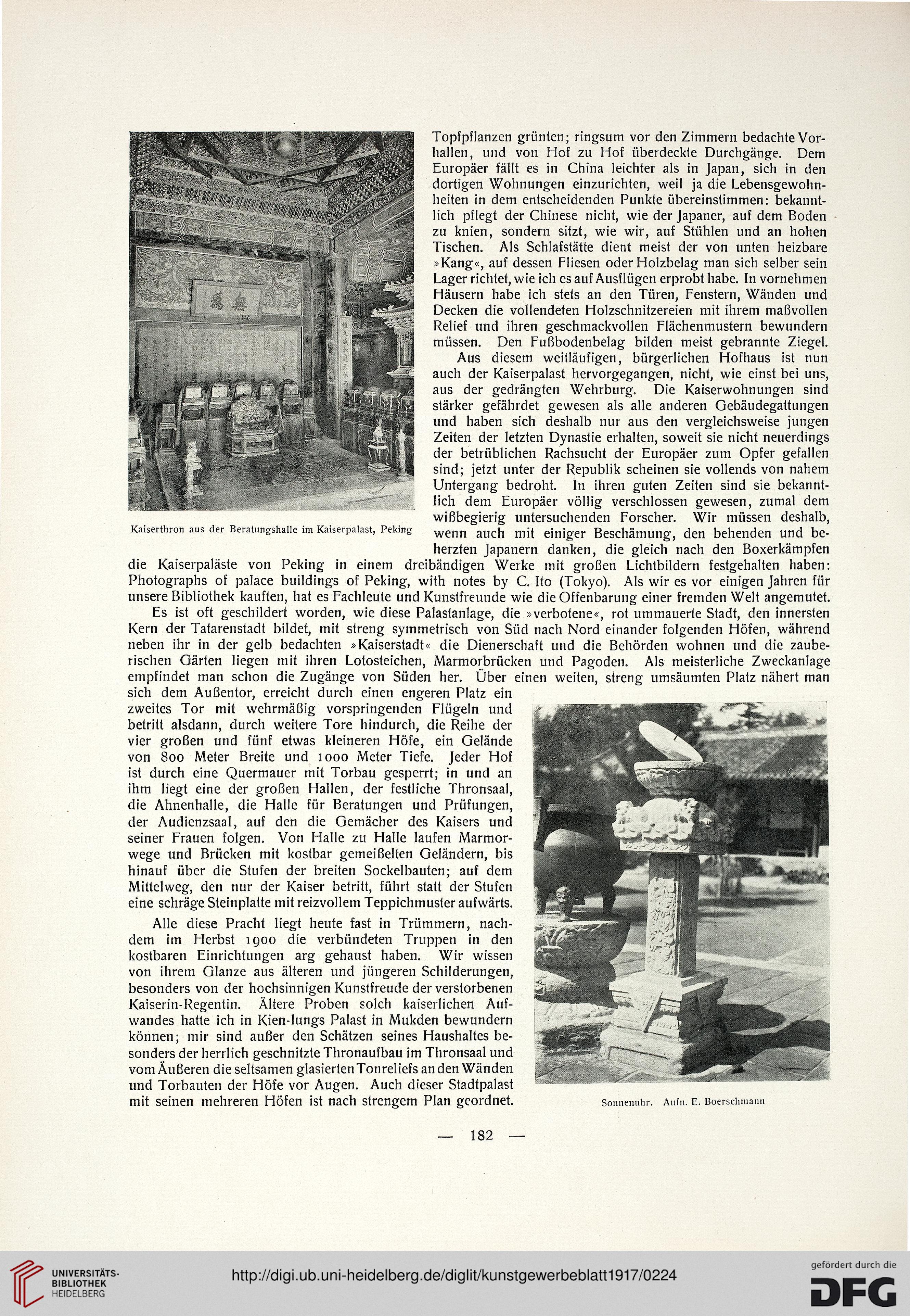Kaiserthron aus der Beratungshalle im Kaiserpalast, Peking
Topfpflanzen grünten; ringsum vor den Zimmern bedachte Vor-
hallen, und von Hof zu Hof überdeckte Durchgänge. Dem
Europäer fällt es in China leichter als in Japan, sich in den
dortigen Wohnungen einzurichten, weil ja die Lebensgewohn-
heiten in dem entscheidenden Punkte übereinstimmen: bekannt-
lich pflegt der Chinese nicht, wie der Japaner, auf dem Boden
zu knien, sondern sitzt, wie wir, auf Stühlen und an hohen
Tischen. Als Schlafstätte dient meist der von unten heizbare
»Kang«, auf dessen Fliesen oder Holzbelag man sich selber sein
Lager richtet, wie ich es auf Ausflügen erprobt habe. In vornehmen
Häusern habe ich stets an den Türen, Fenstern, Wänden und
Decken die vollendeten Holzschnitzereien mit ihrem maßvollen
Relief und ihren geschmackvollen Flächenmustern bewundern
müssen. Den Fußbodenbelag bilden meist gebrannte Ziegel.
Aus diesem weitläufigen, bürgerlichen Hof haus ist nun
auch der Kaiserpalast hervorgegangen, nicht, wie einst bei uns,
aus der gedrängten Wehrburg. Die Kaiserwohnungen sind
stärker gefährdet gewesen als alle anderen Gebäudegattungen
und haben sich deshalb nur aus den vergleichsweise jungen
Zeiten der letzten Dynastie erhalten, soweit sie nicht neuerdings
der betrüblichen Rachsucht der Europäer zum Opfer gefallen
sind; jetzt unter der Republik scheinen sie vollends von nahem
Untergang bedroht. In ihren guten Zeiten sind sie bekannt-
lich dem Europäer völlig verschlossen gewesen, zumal dem
wißbegierig untersuchenden Forscher. Wir müssen deshalb,
wenn auch mit einiger Beschämung, den behenden und be-
herzten Japanern danken, die gleich nach den Boxerkämpfen
die Kaiserpaläste von Peking in einem dreibändigen Werke mit großen Lichtbildern festgehalten haben:
Photographs of palace buildings of Peking, with notes by C. Ito (Tokyo). Als wir es vor einigen Jahren für
unsere Bibliothek kauften, hat es Fachleute und Kunstfreunde wie die Offenbarung einer fremden Welt angemutet.
Es ist oft geschildert worden, wie diese Palastanlage, die »verbotene«, rot ummauerte Stadt, den innersten
Kern der Tatarenstadt bildet, mit streng symmetrisch von Süd nach Nord einander folgenden Höfen, während
neben ihr in der gelb bedachten »Kaiserstadt« die Dienerschaft und die Behörden wohnen und die zaube-
rischen Gärten liegen mit ihren Lotosteichen, Marmorbrücken und Pagoden. Als meisterliche Zweckanlage
empfindet man schon die Zugänge von Süden her. Über einen weiten, streng umsäumten Platz nähert man
sich dem Außentor, erreicht durch einen engeren Platz ein
zweites Tor mit wehrmäßig vorspringenden Flügeln und
betritt alsdann, durch weitere Tore hindurch, die Reihe der
vier großen und fünf etwas kleineren Höfe, ein Gelände
von 800 Meter Breite und 1000 Meter Tiefe. Jeder Hof
ist durch eine Quermauer mit Torbau gesperrt; in und an
ihm liegt eine der großen Hallen, der festliche Thronsaal,
die Ahnenhalle, die Halle für Beratungen und Prüfungen,
der Audienzsaal, auf den die Gemächer des Kaisers und
seiner Frauen folgen. Von Halle zu Halle laufen Marmor-
wege und Brücken mit kostbar gemeißelten Geländern, bis
hinauf über die Stufen der breiten Sockelbauten; auf dem
Mittelweg, den nur der Kaiser betritt, führt statt der Stufen
eine schräge Steinplatte mit reizvollem Teppichmuster aufwärts.
Alle diese Pracht liegt heute fast in Trümmern, nach-
dem im Herbst 1900 die verbündeten Truppen in den
kostbaren Einrichtungen arg gehaust haben. Wir wissen
von ihrem Glänze aus älteren und jüngeren Schilderungen,
besonders von der hochsinnigen Kunstfreude der verstorbenen
Kaiserin-Regentin. Ältere Proben solch kaiserlichen Auf-
wandes hatte ich in Kien-lungs Palast in Mukden bewundern
können; mir sind außer den Schätzen seines Haushaltes be-
sonders der herrlich geschnitzte Thronaufbau im Thronsaal und
vom Äußeren die seltsamen glasierten Tonreliefs an den Wänden
und Torbauten der Höfe vor Augen. Auch dieser Stadtpalast
mit seinen mehreren Höfen ist nach strengem Plan geordnet. Sonnenuhr. Aufn. e. Boerscbmann
— 182 —
Topfpflanzen grünten; ringsum vor den Zimmern bedachte Vor-
hallen, und von Hof zu Hof überdeckte Durchgänge. Dem
Europäer fällt es in China leichter als in Japan, sich in den
dortigen Wohnungen einzurichten, weil ja die Lebensgewohn-
heiten in dem entscheidenden Punkte übereinstimmen: bekannt-
lich pflegt der Chinese nicht, wie der Japaner, auf dem Boden
zu knien, sondern sitzt, wie wir, auf Stühlen und an hohen
Tischen. Als Schlafstätte dient meist der von unten heizbare
»Kang«, auf dessen Fliesen oder Holzbelag man sich selber sein
Lager richtet, wie ich es auf Ausflügen erprobt habe. In vornehmen
Häusern habe ich stets an den Türen, Fenstern, Wänden und
Decken die vollendeten Holzschnitzereien mit ihrem maßvollen
Relief und ihren geschmackvollen Flächenmustern bewundern
müssen. Den Fußbodenbelag bilden meist gebrannte Ziegel.
Aus diesem weitläufigen, bürgerlichen Hof haus ist nun
auch der Kaiserpalast hervorgegangen, nicht, wie einst bei uns,
aus der gedrängten Wehrburg. Die Kaiserwohnungen sind
stärker gefährdet gewesen als alle anderen Gebäudegattungen
und haben sich deshalb nur aus den vergleichsweise jungen
Zeiten der letzten Dynastie erhalten, soweit sie nicht neuerdings
der betrüblichen Rachsucht der Europäer zum Opfer gefallen
sind; jetzt unter der Republik scheinen sie vollends von nahem
Untergang bedroht. In ihren guten Zeiten sind sie bekannt-
lich dem Europäer völlig verschlossen gewesen, zumal dem
wißbegierig untersuchenden Forscher. Wir müssen deshalb,
wenn auch mit einiger Beschämung, den behenden und be-
herzten Japanern danken, die gleich nach den Boxerkämpfen
die Kaiserpaläste von Peking in einem dreibändigen Werke mit großen Lichtbildern festgehalten haben:
Photographs of palace buildings of Peking, with notes by C. Ito (Tokyo). Als wir es vor einigen Jahren für
unsere Bibliothek kauften, hat es Fachleute und Kunstfreunde wie die Offenbarung einer fremden Welt angemutet.
Es ist oft geschildert worden, wie diese Palastanlage, die »verbotene«, rot ummauerte Stadt, den innersten
Kern der Tatarenstadt bildet, mit streng symmetrisch von Süd nach Nord einander folgenden Höfen, während
neben ihr in der gelb bedachten »Kaiserstadt« die Dienerschaft und die Behörden wohnen und die zaube-
rischen Gärten liegen mit ihren Lotosteichen, Marmorbrücken und Pagoden. Als meisterliche Zweckanlage
empfindet man schon die Zugänge von Süden her. Über einen weiten, streng umsäumten Platz nähert man
sich dem Außentor, erreicht durch einen engeren Platz ein
zweites Tor mit wehrmäßig vorspringenden Flügeln und
betritt alsdann, durch weitere Tore hindurch, die Reihe der
vier großen und fünf etwas kleineren Höfe, ein Gelände
von 800 Meter Breite und 1000 Meter Tiefe. Jeder Hof
ist durch eine Quermauer mit Torbau gesperrt; in und an
ihm liegt eine der großen Hallen, der festliche Thronsaal,
die Ahnenhalle, die Halle für Beratungen und Prüfungen,
der Audienzsaal, auf den die Gemächer des Kaisers und
seiner Frauen folgen. Von Halle zu Halle laufen Marmor-
wege und Brücken mit kostbar gemeißelten Geländern, bis
hinauf über die Stufen der breiten Sockelbauten; auf dem
Mittelweg, den nur der Kaiser betritt, führt statt der Stufen
eine schräge Steinplatte mit reizvollem Teppichmuster aufwärts.
Alle diese Pracht liegt heute fast in Trümmern, nach-
dem im Herbst 1900 die verbündeten Truppen in den
kostbaren Einrichtungen arg gehaust haben. Wir wissen
von ihrem Glänze aus älteren und jüngeren Schilderungen,
besonders von der hochsinnigen Kunstfreude der verstorbenen
Kaiserin-Regentin. Ältere Proben solch kaiserlichen Auf-
wandes hatte ich in Kien-lungs Palast in Mukden bewundern
können; mir sind außer den Schätzen seines Haushaltes be-
sonders der herrlich geschnitzte Thronaufbau im Thronsaal und
vom Äußeren die seltsamen glasierten Tonreliefs an den Wänden
und Torbauten der Höfe vor Augen. Auch dieser Stadtpalast
mit seinen mehreren Höfen ist nach strengem Plan geordnet. Sonnenuhr. Aufn. e. Boerscbmann
— 182 —