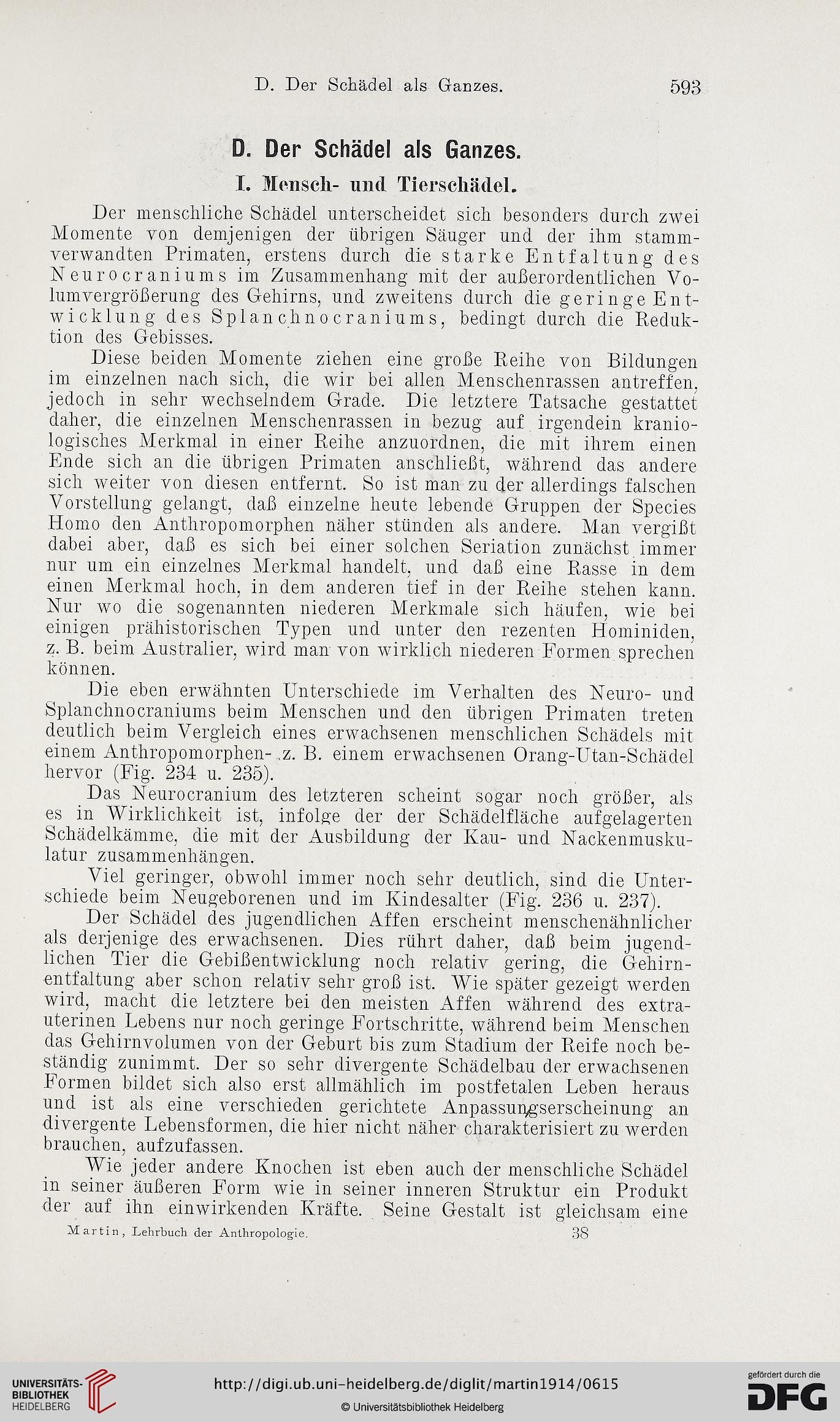D. Der Schädel als Ganzes.
593
D. Der Schade! a!s Ganzes.
I. Mensch- und TicrseMdel.
Der menschliche Schädel unterscheidet sich besonders durch zwei
Momente von demjenigen der übrigen Säuger und der ihm stamm-
verwandten Primaten, erstens durch die starke Entfaltung des
Neurocraniums im Zusammenhang mit der außerordentlichen Vo-
lumvergrößerung des Gehirns, und zweitens durch die geringe Ent-
wicklung des Splanchnocraniums, bedingt durch die Reduk-
tion des Gebisses.
Diese beiden Momente ziehen eine große Reihe von Bildungen
im einzelnen nach sich, die wir bei allen Menschenrassen antreffen,
jedoch in sehr wechselndem Grade. Die letztere Tatsache gestattet
daher, die einzelnen Menschenrassen in bezug auf irgendein kranio-
logisches Merkmal in einer Reihe anzuordnen, die mit ihrem einen
Ende sich an die übrigen Primaten anschließt, während das andere
sich weiter von diesen entfernt. So ist man zu der allerdings falschen
Vorstellung gelangt, daß einzelne heute lebende Gruppen der Species
Homo den Anthropomorphen näher stünden als andere. Man vergißt
dabei aber, daß es sich bei einer solchen Seriation zunächst immer
nur um ein einzelnes Merkmal handelt, und daß eine Rasse in dem
einen Merkmal hoch, in dem anderen tief in der Reihe stehen kann.
Nur wo die sogenannten niederen Merkmale sich häufen, wie bei
einigen prähistorischen Typen und unter den rezenten Hominiden,
z. B. beim Australier, wird man von wirklich niederen Formen sprechen
können.
Die eben erwähnten Unterschiede im Verhalten des Neuro- und
Splanchnocraniums beim Menschen und den übrigen Primaten treten
deutlich beim Vergleich eines erwachsenen menschlichen Schädels mit
einem Anthropomorphen- z. B. einem erwachsenen Orang-Utan-Schädel
hervor (Fig. 234 u. 235).
Das Neurocranium des letzteren scheint sogar noch größer, als
es in Wirklichkeit ist, infolge der der Schädelfläche auf gelagerten
Schädelkämme, die mit der Ausbildung der Kau- und Nackenmusku-
latur Zusammenhängen.
Viel geringer, obwohl immer noch sehr deutlich, sind die Unter-
schiede beim Neugeborenen und im Kindesalter (Fig. 236 u. 237).
Der Schädel des jugendlichen Affen erscheint menschenähnlicher
als derjenige des erwachsenen. Dies rührt daher, daß beim jugend-
lichen Tier die Gebißentwicklung' noch relativ gering, die Gehirn-
nntfaltung aber schon relativ sehr groß ist. Wie später gezeigt werden
wird, macht die letztere bei den meisten Affen während des extra-
uterinen Lebens nur noch geringe Fortschritte, während beim Menschen
das Gehirnvolumen von der Geburt bis zum Stadium der Reife noch be-
ständig zunimmt. Der so sehr divergente Schädelbau der erwachsenen
Formen bildet sich also erst allmählich im postfetalen Leben heraus
und ist als eine verschieden gerichtete Anpassungserscheinung an
divergente Lebensformen, die hier nicht näher charakterisiert zu werden
brauchen, aufzufassen.
Wie jeder andere Knochen ist eben auch der menschliche Schädel
in seiner äußeren Form wie in seiner inneren Struktur ein Produkt
der auf ihn einwirkenden Kräfte. Seine Gestalt ist gleichsam eine
593
D. Der Schade! a!s Ganzes.
I. Mensch- und TicrseMdel.
Der menschliche Schädel unterscheidet sich besonders durch zwei
Momente von demjenigen der übrigen Säuger und der ihm stamm-
verwandten Primaten, erstens durch die starke Entfaltung des
Neurocraniums im Zusammenhang mit der außerordentlichen Vo-
lumvergrößerung des Gehirns, und zweitens durch die geringe Ent-
wicklung des Splanchnocraniums, bedingt durch die Reduk-
tion des Gebisses.
Diese beiden Momente ziehen eine große Reihe von Bildungen
im einzelnen nach sich, die wir bei allen Menschenrassen antreffen,
jedoch in sehr wechselndem Grade. Die letztere Tatsache gestattet
daher, die einzelnen Menschenrassen in bezug auf irgendein kranio-
logisches Merkmal in einer Reihe anzuordnen, die mit ihrem einen
Ende sich an die übrigen Primaten anschließt, während das andere
sich weiter von diesen entfernt. So ist man zu der allerdings falschen
Vorstellung gelangt, daß einzelne heute lebende Gruppen der Species
Homo den Anthropomorphen näher stünden als andere. Man vergißt
dabei aber, daß es sich bei einer solchen Seriation zunächst immer
nur um ein einzelnes Merkmal handelt, und daß eine Rasse in dem
einen Merkmal hoch, in dem anderen tief in der Reihe stehen kann.
Nur wo die sogenannten niederen Merkmale sich häufen, wie bei
einigen prähistorischen Typen und unter den rezenten Hominiden,
z. B. beim Australier, wird man von wirklich niederen Formen sprechen
können.
Die eben erwähnten Unterschiede im Verhalten des Neuro- und
Splanchnocraniums beim Menschen und den übrigen Primaten treten
deutlich beim Vergleich eines erwachsenen menschlichen Schädels mit
einem Anthropomorphen- z. B. einem erwachsenen Orang-Utan-Schädel
hervor (Fig. 234 u. 235).
Das Neurocranium des letzteren scheint sogar noch größer, als
es in Wirklichkeit ist, infolge der der Schädelfläche auf gelagerten
Schädelkämme, die mit der Ausbildung der Kau- und Nackenmusku-
latur Zusammenhängen.
Viel geringer, obwohl immer noch sehr deutlich, sind die Unter-
schiede beim Neugeborenen und im Kindesalter (Fig. 236 u. 237).
Der Schädel des jugendlichen Affen erscheint menschenähnlicher
als derjenige des erwachsenen. Dies rührt daher, daß beim jugend-
lichen Tier die Gebißentwicklung' noch relativ gering, die Gehirn-
nntfaltung aber schon relativ sehr groß ist. Wie später gezeigt werden
wird, macht die letztere bei den meisten Affen während des extra-
uterinen Lebens nur noch geringe Fortschritte, während beim Menschen
das Gehirnvolumen von der Geburt bis zum Stadium der Reife noch be-
ständig zunimmt. Der so sehr divergente Schädelbau der erwachsenen
Formen bildet sich also erst allmählich im postfetalen Leben heraus
und ist als eine verschieden gerichtete Anpassungserscheinung an
divergente Lebensformen, die hier nicht näher charakterisiert zu werden
brauchen, aufzufassen.
Wie jeder andere Knochen ist eben auch der menschliche Schädel
in seiner äußeren Form wie in seiner inneren Struktur ein Produkt
der auf ihn einwirkenden Kräfte. Seine Gestalt ist gleichsam eine