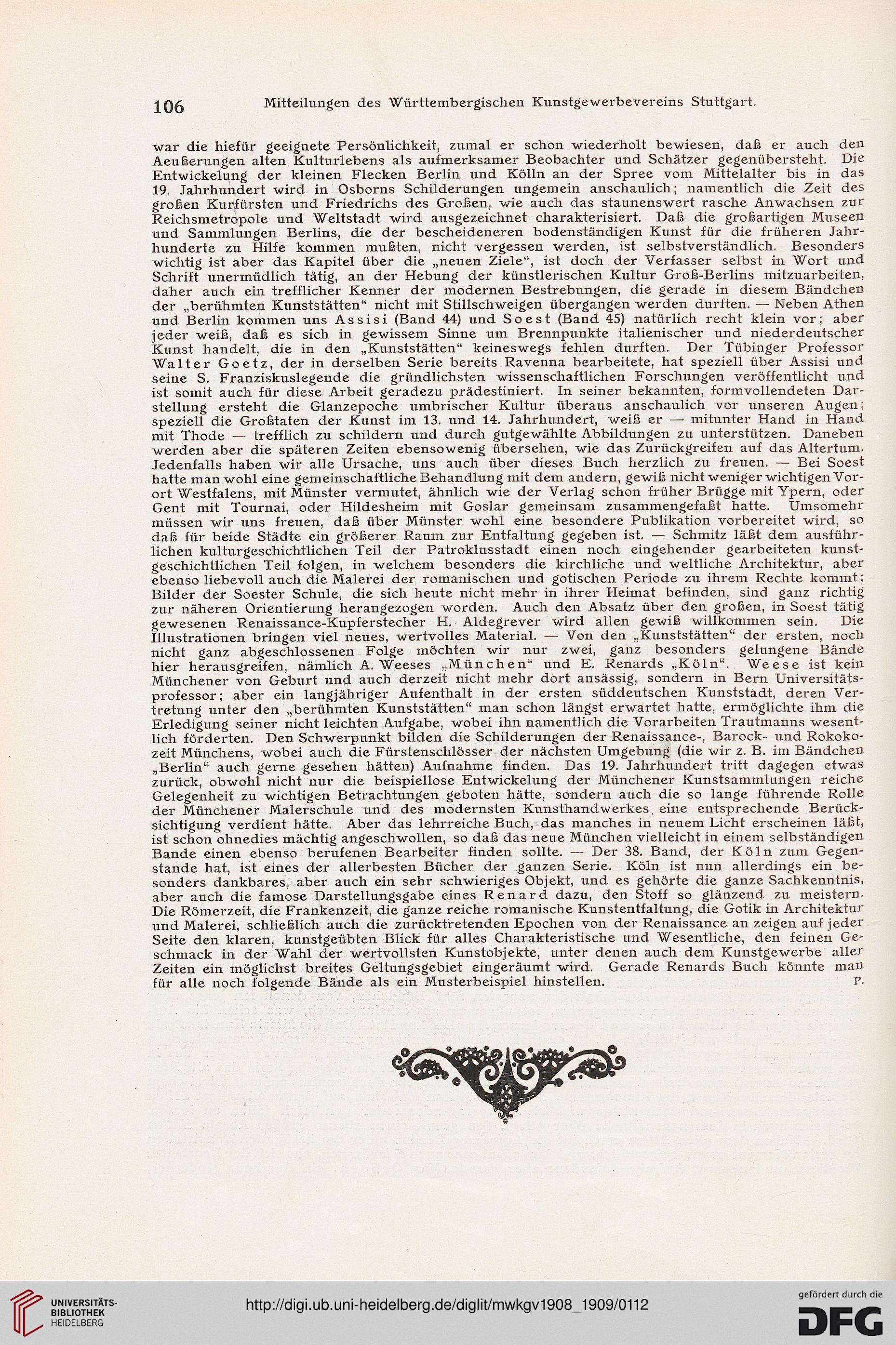106 Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins Stuttgart.
war die hiefür geeignete Persönlichkeit, zumal er schon wiederholt bewiesen, daß er auch den
Aeußerungen alten Kulturlebens als aufmerksamer Beobachter und Schätzer gegenübersteht. Die
Entwickelung der kleinen Flecken Berlin und Kölln an der Spree vom Mittelalter bis in das
19. Jahrhundert wird in Osborns Schilderungen ungemein anschaulich; namentlich die Zeit des
großen Kurfürsten und Friedrichs des Großen, wie auch das staunenswert rasche Anwachsen zur
Reichsmetropole und Weltstadt wird ausgezeichnet charakterisiert. Daß die großartigen Museen
und Sammlungen Berlins, die der bescheideneren bodenständigen Kunst für die früheren Jahr-
hunderte zu Hilfe kommen mußten, nicht vergessen werden, ist selbstverständlich. Besonders
wichtig ist aber das Kapitel über die „neuen Ziele", ist doch der Verfasser selbst in Wort und
Schrift unermüdlich tätig, an der Hebung der künstlerischen Kultur Groß-Berlins mitzuarbeiten,
daher auch ein trefflicher Kenner der modernen Bestrebungen, die gerade in diesem Bändchen
der „berühmten Kunststätten" nicht mit Stillschweigen übergangen werden durften. — Neben Athen
und Berlin kommen uns Assisi (Band 44) und Soest (Band 45) natürlich recht klein vor; aber
jeder weiß, daß es sich in gewissem Sinne um Brennpunkte italienischer und niederdeutscher
Kunst handelt, die in den „Kunststätten" keineswegs fehlen durften. Der Tübinger Professor
Walter Goetz, der in derselben Serie bereits Ravenna bearbeitete, hat speziell über Assisi und
seine S. Franziskuslegende die gründlichsten wissenschaftlichen Forschungen veröffentlicht und
ist somit auch für diese Arbeit geradezu prädestiniert. In seiner bekannten, formvollendeten Dar-
stellung ersteht die Glanzepoche umbrischer Kultur überaus anschaulich vor unseren Augen;
speziell die Großtaten der Kunst im 13. und 14. Jahrhundert, weiß er — mitunter Hand in Hand
mit Thode — trefflich zu schildern und durch gutgewählte Abbildungen zu unterstützen. Daneben
werden aber die späteren Zeiten ebensowenig übersehen, wie das Zurückgreifen auf das Altertum.
Jedenfalls haben wir alle Ursache, uns auch über dieses Buch herzlich zu freuen. — Bei Soest
hatte man wohl eine gemeinschaftliche Behandlung mit dem andern, gewiß nicht weniger wichtigen Vor-
ort Westfalens, mit Münster vermutet, ähnlich wie der Verlag schon früher Brügge mit Ypern, oder
Gent mit Tournai, oder Hildesheim mit Goslar gemeinsam zusammengefaßt hatte. Umsomehr
müssen wir uns freuen, daß über Münster wohl eine besondere Publikation vorbereitet wird, so
daß für beide Städte ein größerer Raum zur Entfaltung gegeben ist. — Schmitz läßt dem ausführ-
lichen kulturgeschichtlichen Teil der Patroklusstadt einen noch eingehender gearbeiteten kunst-
geschichtlichen Teil folgen, in welchem besonders die kirchliche und weltliche Architektur, aber
ebenso liebevoll auch die Malerei der romanischen und gotischen Periode zu ihrem Rechte kommt;
Bilder der Soester Schule, die sich heute nicht mehr in ihrer Heimat befinden, sind ganz richtig
zur näheren Orientierung herangezogen worden. Auch den Absatz über den großen, in Soest tätig
gewesenen Renaissance-Kupferstecher H. Aldegrever wird allen gewiß willkommen sein. Die
Illustrationen bringen viel neues, wertvolles Material. — Von den „Kunststätten" der ersten, noch
nicht ganz abgeschlossenen Folge möchten wir nur zwei, ganz besonders gelungene Bände
hier herausgreifen, nämlich A.Weeses „München" und E. Renards „Köln". Weese ist kein
Münchener von Geburt und auch derzeit nicht mehr dort ansässig, sondern in Bern Universitäts-
professor; aber ein langjähriger Aufenthalt in der ersten süddeutschen Kunststadt, deren Ver-
tretung unter den „berühmten Kunststätten" man schon längst erwartet hatte, ermöglichte ihm die
Erledigung seiner nicht leichten Aufgabe, wobei ihn namentlich die Vorarbeiten Trautmanns wesent-
lich förderten. Den Schwerpunkt bilden die Schilderungen der Renaissance-, Barock- und Rokoko-
zeit Münchens, wobei auch die Fürstenschlösser der nächsten Umgebung (die wir z. B. im Bändchen
„Berlin" auch gerne gesehen hätten) Aufnahme finden. Das 19. Jahrhundert tritt dagegen etwas
zurück, obwohl nicht nur die beispiellose Entwickelung der Münchener Kunstsammlungen reiche
Gelegenheit zu wichtigen Betrachtungen geboten hätte, sondern auch die so lange führende Rolle
der Münchener Malerschule und des modernsten Kunsthandwerkes, eine entsprechende Berück-
sichtigung verdient hätte. Aber das lehrreiche Buch, das manches in neuem Licht erscheinen läßt,
ist schon ohnedies mächtig angeschwollen, so daß das neue München vielleicht in einem selbständigen
Bande einen ebenso berufenen Bearbeiter finden sollte. — Der 38. Band, der Köln zum Gegen-
stande hat, ist eines der allerbesten Bücher der ganzen Serie. Köln ist nun allerdings ein be-
sonders dankbares, aber auch ein sehr schwieriges Objekt, und es gehörte die ganze Sachkenntnis,
aber auch die famose Darstellungsgabe eines Renard dazu, den Stoff so glänzend zu meistern.
Die Römerzeit, die Frankenzeit, die ganze reiche romanische Kunstentfaltung, die Gotik in Architektur
und Malerei, schließlich auch die zurücktretenden Epochen von der Renaissance an zeigen auf jeder
Seite den klaren, kunstgeübten Blick für alles Charakteristische und Wesentliche, den feinen Ge-
schmack in der Wahl der wertvollsten Kunstobjekte, unter denen auch dem Kunstgewerbe aller
Zeiten ein möglichst breites Geltungsgebiet eingeräumt wird. Gerade Renards Buch könnte man
für alle noch folgende Bände als ein Musterbeispiel hinstellen. P.
war die hiefür geeignete Persönlichkeit, zumal er schon wiederholt bewiesen, daß er auch den
Aeußerungen alten Kulturlebens als aufmerksamer Beobachter und Schätzer gegenübersteht. Die
Entwickelung der kleinen Flecken Berlin und Kölln an der Spree vom Mittelalter bis in das
19. Jahrhundert wird in Osborns Schilderungen ungemein anschaulich; namentlich die Zeit des
großen Kurfürsten und Friedrichs des Großen, wie auch das staunenswert rasche Anwachsen zur
Reichsmetropole und Weltstadt wird ausgezeichnet charakterisiert. Daß die großartigen Museen
und Sammlungen Berlins, die der bescheideneren bodenständigen Kunst für die früheren Jahr-
hunderte zu Hilfe kommen mußten, nicht vergessen werden, ist selbstverständlich. Besonders
wichtig ist aber das Kapitel über die „neuen Ziele", ist doch der Verfasser selbst in Wort und
Schrift unermüdlich tätig, an der Hebung der künstlerischen Kultur Groß-Berlins mitzuarbeiten,
daher auch ein trefflicher Kenner der modernen Bestrebungen, die gerade in diesem Bändchen
der „berühmten Kunststätten" nicht mit Stillschweigen übergangen werden durften. — Neben Athen
und Berlin kommen uns Assisi (Band 44) und Soest (Band 45) natürlich recht klein vor; aber
jeder weiß, daß es sich in gewissem Sinne um Brennpunkte italienischer und niederdeutscher
Kunst handelt, die in den „Kunststätten" keineswegs fehlen durften. Der Tübinger Professor
Walter Goetz, der in derselben Serie bereits Ravenna bearbeitete, hat speziell über Assisi und
seine S. Franziskuslegende die gründlichsten wissenschaftlichen Forschungen veröffentlicht und
ist somit auch für diese Arbeit geradezu prädestiniert. In seiner bekannten, formvollendeten Dar-
stellung ersteht die Glanzepoche umbrischer Kultur überaus anschaulich vor unseren Augen;
speziell die Großtaten der Kunst im 13. und 14. Jahrhundert, weiß er — mitunter Hand in Hand
mit Thode — trefflich zu schildern und durch gutgewählte Abbildungen zu unterstützen. Daneben
werden aber die späteren Zeiten ebensowenig übersehen, wie das Zurückgreifen auf das Altertum.
Jedenfalls haben wir alle Ursache, uns auch über dieses Buch herzlich zu freuen. — Bei Soest
hatte man wohl eine gemeinschaftliche Behandlung mit dem andern, gewiß nicht weniger wichtigen Vor-
ort Westfalens, mit Münster vermutet, ähnlich wie der Verlag schon früher Brügge mit Ypern, oder
Gent mit Tournai, oder Hildesheim mit Goslar gemeinsam zusammengefaßt hatte. Umsomehr
müssen wir uns freuen, daß über Münster wohl eine besondere Publikation vorbereitet wird, so
daß für beide Städte ein größerer Raum zur Entfaltung gegeben ist. — Schmitz läßt dem ausführ-
lichen kulturgeschichtlichen Teil der Patroklusstadt einen noch eingehender gearbeiteten kunst-
geschichtlichen Teil folgen, in welchem besonders die kirchliche und weltliche Architektur, aber
ebenso liebevoll auch die Malerei der romanischen und gotischen Periode zu ihrem Rechte kommt;
Bilder der Soester Schule, die sich heute nicht mehr in ihrer Heimat befinden, sind ganz richtig
zur näheren Orientierung herangezogen worden. Auch den Absatz über den großen, in Soest tätig
gewesenen Renaissance-Kupferstecher H. Aldegrever wird allen gewiß willkommen sein. Die
Illustrationen bringen viel neues, wertvolles Material. — Von den „Kunststätten" der ersten, noch
nicht ganz abgeschlossenen Folge möchten wir nur zwei, ganz besonders gelungene Bände
hier herausgreifen, nämlich A.Weeses „München" und E. Renards „Köln". Weese ist kein
Münchener von Geburt und auch derzeit nicht mehr dort ansässig, sondern in Bern Universitäts-
professor; aber ein langjähriger Aufenthalt in der ersten süddeutschen Kunststadt, deren Ver-
tretung unter den „berühmten Kunststätten" man schon längst erwartet hatte, ermöglichte ihm die
Erledigung seiner nicht leichten Aufgabe, wobei ihn namentlich die Vorarbeiten Trautmanns wesent-
lich förderten. Den Schwerpunkt bilden die Schilderungen der Renaissance-, Barock- und Rokoko-
zeit Münchens, wobei auch die Fürstenschlösser der nächsten Umgebung (die wir z. B. im Bändchen
„Berlin" auch gerne gesehen hätten) Aufnahme finden. Das 19. Jahrhundert tritt dagegen etwas
zurück, obwohl nicht nur die beispiellose Entwickelung der Münchener Kunstsammlungen reiche
Gelegenheit zu wichtigen Betrachtungen geboten hätte, sondern auch die so lange führende Rolle
der Münchener Malerschule und des modernsten Kunsthandwerkes, eine entsprechende Berück-
sichtigung verdient hätte. Aber das lehrreiche Buch, das manches in neuem Licht erscheinen läßt,
ist schon ohnedies mächtig angeschwollen, so daß das neue München vielleicht in einem selbständigen
Bande einen ebenso berufenen Bearbeiter finden sollte. — Der 38. Band, der Köln zum Gegen-
stande hat, ist eines der allerbesten Bücher der ganzen Serie. Köln ist nun allerdings ein be-
sonders dankbares, aber auch ein sehr schwieriges Objekt, und es gehörte die ganze Sachkenntnis,
aber auch die famose Darstellungsgabe eines Renard dazu, den Stoff so glänzend zu meistern.
Die Römerzeit, die Frankenzeit, die ganze reiche romanische Kunstentfaltung, die Gotik in Architektur
und Malerei, schließlich auch die zurücktretenden Epochen von der Renaissance an zeigen auf jeder
Seite den klaren, kunstgeübten Blick für alles Charakteristische und Wesentliche, den feinen Ge-
schmack in der Wahl der wertvollsten Kunstobjekte, unter denen auch dem Kunstgewerbe aller
Zeiten ein möglichst breites Geltungsgebiet eingeräumt wird. Gerade Renards Buch könnte man
für alle noch folgende Bände als ein Musterbeispiel hinstellen. P.