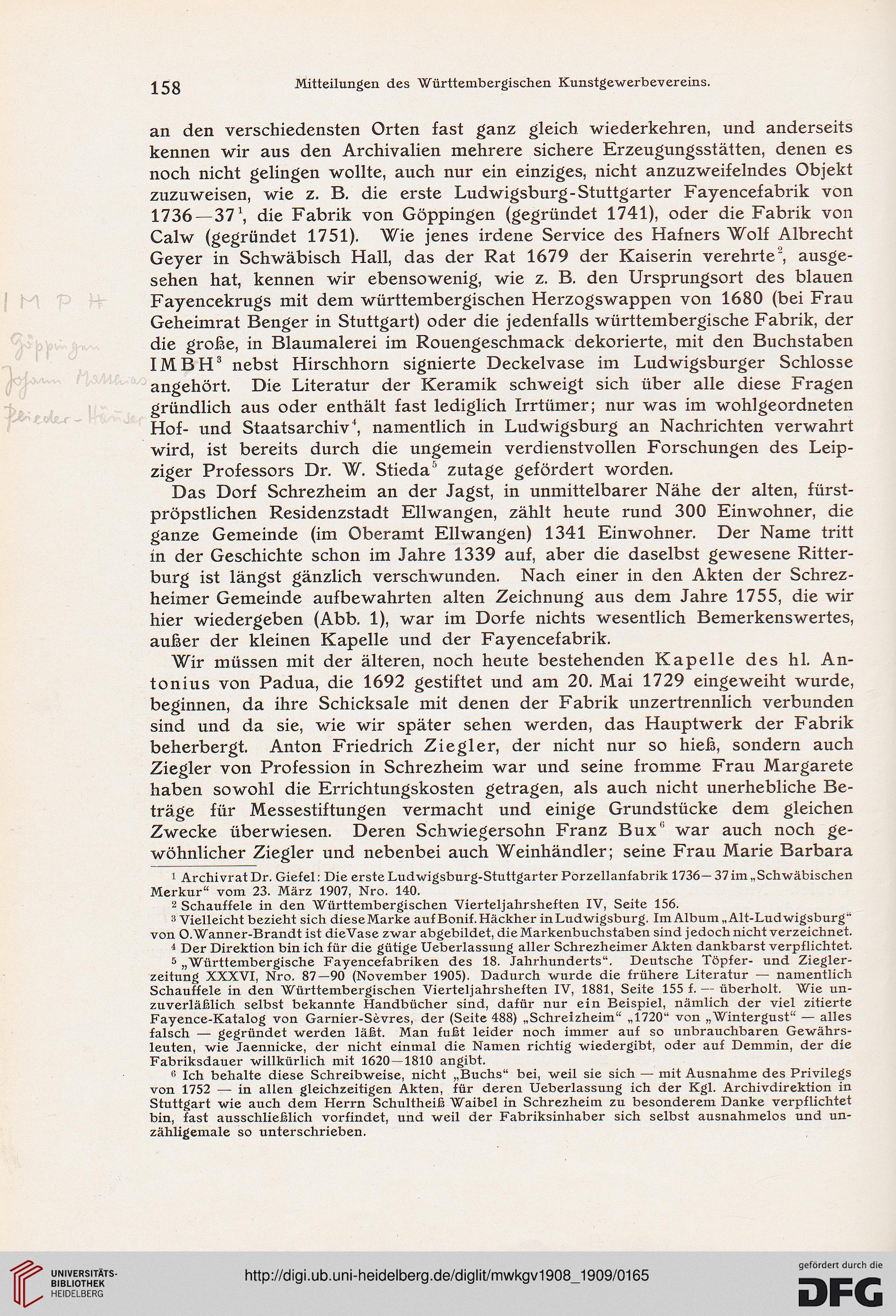158
Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.
an den verschiedensten Orten fast ganz gleich wiederkehren, und anderseits
kennen wir aus den Archivalien mehrere sichere Erzeugungsstätten, denen es
noch nicht gelingen wollte, auch nur ein einziges, nicht anzuzweifelndes Objekt
zuzuweisen, wie z. B. die erste Ludwigsburg-Stuttgarter Fayencefabrik von
1736—37\ die Fabrik von Göppingen (gegründet 1741), oder die Fabrik von
Calw (gegründet 1751). Wie jenes irdene Service des Hafners Wolf Albrecht
Geyer in Schwäbisch Hall, das der Rat 1679 der Kaiserin verehrte2, ausge-
sehen hat, kennen wir ebensowenig, wie z. B. den Ursprungsort des blauen
Fayencekrugs mit dem württembergischen Herzogswappen von 1680 (bei Frau
Geheimrat Benger in Stuttgart) oder die jedenfalls württembergische Fabrik, der
die große, in Blaumalerei im Rouengeschmack dekorierte, mit den Buchstaben
IMBH3 nebst Hirschhorn signierte Deckelvase im Ludwigsburger Schlosse
angehört. Die Literatur der Keramik schweigt sich über alle diese Fragen
gründlich aus oder enthält fast lediglich Irrtümer; nur was im wohlgeordneten
Hof- und Staatsarchiv4, namentlich in Ludwigsburg an Nachrichten verwahrt
wird, ist bereits durch die ungemein verdienstvollen Forschungen des Leip-
ziger Professors Dr. W. Stieda' zutage gefördert worden.
Das Dorf Schrezheim an der Jagst, in unmittelbarer Nähe der alten, fürst-
pröpstlichen Residenzstadt Ellwangen, zählt heute rund 300 Einwohner, die
ganze Gemeinde (im Oberamt Ellwangen) 1341 Einwohner. Der Name tritt
in der Geschichte schon im Jahre 1339 auf, aber die daselbst gewesene Ritter-
burg ist längst gänzlich verschwunden. Nach einer in den Akten der Schrez-
heimer Gemeinde aufbewahrten alten Zeichnung aus dem Jahre 1755, die wir
hier wiedergeben (Abb. 1), war im Dorfe nichts wesentlich Bemerkenswertes,
außer der kleinen Kapelle und der Fayencefabrik.
Wir müssen mit der älteren, noch heute bestehenden Kapelle des hl. An-
tonius von Padua, die 1692 gestiftet und am 20. Mai 1729 eingeweiht wurde,
beginnen, da ihre Schicksale mit denen der Fabrik unzertrennlich verbunden
sind und da sie, wie wir später sehen werden, das Hauptwerk der Fabrik
beherbergt. Anton Friedrich Ziegler, der nicht nur so hieß, sondern auch
Ziegler von Profession in Schrezheim war und seine fromme Frau Margarete
haben sowohl die Errichtungskosten getragen, als auch nicht unerhebliche Be-
träge für Messestiftungen vermacht und einige Grundstücke dem gleichen
Zwecke überwiesen. Deren Schwiegersohn Franz Bux" war auch noch ge-
wöhnlicher Ziegler und nebenbei auch Weinhändler; seine Frau Marie Barbara
1 Archivrat Dr. Giefel: Die erste Ludwigsburg-Stuttgarter Porzellanfabrik 1736— 37im „Schwäbischen
Merkur" vom 23. März 1907, Nro. 140.
2 Schauffeie in den Württembergischen Vierteljahrsheften IV, Seite 156.
:l Vielleicht bezieht sich dieseMarke auf Bonif.Häckher in Ludwigsburg. Im Album „Alt-Ludwigsburg"
von O. Wanner-Brandt ist dieVase zwar abgebildet, die Markenbuchstaben sind j edoch nicht verzeichnet.
4 Der Direktion bin ich für die gütige Ueberlassung aller Schrezheimer Akten dankbarst verpflichtet.
5 „Württembergische Fayencefabriken des 18. Jahrhunderts". Deutsche Töpfer- und Ziegler-
zeitung XXXVI, Nro. 87—90 (November 1905). Dadurch wurde die frühere Literatur — namentlich
Schauffeie in den Württembergischen Vierteljahrsheften IV, 1881, Seite 155 f. — überholt. Wie un-
zuverläßlich selbst bekannte Handbücher sind, dafür nur ein Beispiel, nämlich der viel zitierte
Fayence-Katalog von Garnier-Sevres, der (Seite 488) „Schreizheim" „1720" von „Wintergust" — alles
falsch — gegründet werden läßt. Man fußt leider noch immer auf so unbrauchbaren Gewährs-
leuten, wie Jaennicke, der nicht einmal die Namen richtig wiedergibt, oder auf Demmin, der die
Fabriksdauer willkürlich mit 1620 — 1810 angibt.
6 Ich behalte diese Schreibweise, nicht „Buchs" bei, weil sie sich — mit Ausnahme des Privilegs
von 1752 — in allen gleichzeitigen Akten, für deren Ueberlassung ich der Kgl. Archivdirektion in
Stuttgart wie auch dem Herrn Schultheiß Waibel in Schrezheim zu besonderem Danke verpflichtet
bin, fast ausschließlich vorfindet, und weil der Fabriksinhaber sich selbst ausnahmelos und un-
zähligemale so unterschrieben.
Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.
an den verschiedensten Orten fast ganz gleich wiederkehren, und anderseits
kennen wir aus den Archivalien mehrere sichere Erzeugungsstätten, denen es
noch nicht gelingen wollte, auch nur ein einziges, nicht anzuzweifelndes Objekt
zuzuweisen, wie z. B. die erste Ludwigsburg-Stuttgarter Fayencefabrik von
1736—37\ die Fabrik von Göppingen (gegründet 1741), oder die Fabrik von
Calw (gegründet 1751). Wie jenes irdene Service des Hafners Wolf Albrecht
Geyer in Schwäbisch Hall, das der Rat 1679 der Kaiserin verehrte2, ausge-
sehen hat, kennen wir ebensowenig, wie z. B. den Ursprungsort des blauen
Fayencekrugs mit dem württembergischen Herzogswappen von 1680 (bei Frau
Geheimrat Benger in Stuttgart) oder die jedenfalls württembergische Fabrik, der
die große, in Blaumalerei im Rouengeschmack dekorierte, mit den Buchstaben
IMBH3 nebst Hirschhorn signierte Deckelvase im Ludwigsburger Schlosse
angehört. Die Literatur der Keramik schweigt sich über alle diese Fragen
gründlich aus oder enthält fast lediglich Irrtümer; nur was im wohlgeordneten
Hof- und Staatsarchiv4, namentlich in Ludwigsburg an Nachrichten verwahrt
wird, ist bereits durch die ungemein verdienstvollen Forschungen des Leip-
ziger Professors Dr. W. Stieda' zutage gefördert worden.
Das Dorf Schrezheim an der Jagst, in unmittelbarer Nähe der alten, fürst-
pröpstlichen Residenzstadt Ellwangen, zählt heute rund 300 Einwohner, die
ganze Gemeinde (im Oberamt Ellwangen) 1341 Einwohner. Der Name tritt
in der Geschichte schon im Jahre 1339 auf, aber die daselbst gewesene Ritter-
burg ist längst gänzlich verschwunden. Nach einer in den Akten der Schrez-
heimer Gemeinde aufbewahrten alten Zeichnung aus dem Jahre 1755, die wir
hier wiedergeben (Abb. 1), war im Dorfe nichts wesentlich Bemerkenswertes,
außer der kleinen Kapelle und der Fayencefabrik.
Wir müssen mit der älteren, noch heute bestehenden Kapelle des hl. An-
tonius von Padua, die 1692 gestiftet und am 20. Mai 1729 eingeweiht wurde,
beginnen, da ihre Schicksale mit denen der Fabrik unzertrennlich verbunden
sind und da sie, wie wir später sehen werden, das Hauptwerk der Fabrik
beherbergt. Anton Friedrich Ziegler, der nicht nur so hieß, sondern auch
Ziegler von Profession in Schrezheim war und seine fromme Frau Margarete
haben sowohl die Errichtungskosten getragen, als auch nicht unerhebliche Be-
träge für Messestiftungen vermacht und einige Grundstücke dem gleichen
Zwecke überwiesen. Deren Schwiegersohn Franz Bux" war auch noch ge-
wöhnlicher Ziegler und nebenbei auch Weinhändler; seine Frau Marie Barbara
1 Archivrat Dr. Giefel: Die erste Ludwigsburg-Stuttgarter Porzellanfabrik 1736— 37im „Schwäbischen
Merkur" vom 23. März 1907, Nro. 140.
2 Schauffeie in den Württembergischen Vierteljahrsheften IV, Seite 156.
:l Vielleicht bezieht sich dieseMarke auf Bonif.Häckher in Ludwigsburg. Im Album „Alt-Ludwigsburg"
von O. Wanner-Brandt ist dieVase zwar abgebildet, die Markenbuchstaben sind j edoch nicht verzeichnet.
4 Der Direktion bin ich für die gütige Ueberlassung aller Schrezheimer Akten dankbarst verpflichtet.
5 „Württembergische Fayencefabriken des 18. Jahrhunderts". Deutsche Töpfer- und Ziegler-
zeitung XXXVI, Nro. 87—90 (November 1905). Dadurch wurde die frühere Literatur — namentlich
Schauffeie in den Württembergischen Vierteljahrsheften IV, 1881, Seite 155 f. — überholt. Wie un-
zuverläßlich selbst bekannte Handbücher sind, dafür nur ein Beispiel, nämlich der viel zitierte
Fayence-Katalog von Garnier-Sevres, der (Seite 488) „Schreizheim" „1720" von „Wintergust" — alles
falsch — gegründet werden läßt. Man fußt leider noch immer auf so unbrauchbaren Gewährs-
leuten, wie Jaennicke, der nicht einmal die Namen richtig wiedergibt, oder auf Demmin, der die
Fabriksdauer willkürlich mit 1620 — 1810 angibt.
6 Ich behalte diese Schreibweise, nicht „Buchs" bei, weil sie sich — mit Ausnahme des Privilegs
von 1752 — in allen gleichzeitigen Akten, für deren Ueberlassung ich der Kgl. Archivdirektion in
Stuttgart wie auch dem Herrn Schultheiß Waibel in Schrezheim zu besonderem Danke verpflichtet
bin, fast ausschließlich vorfindet, und weil der Fabriksinhaber sich selbst ausnahmelos und un-
zähligemale so unterschrieben.