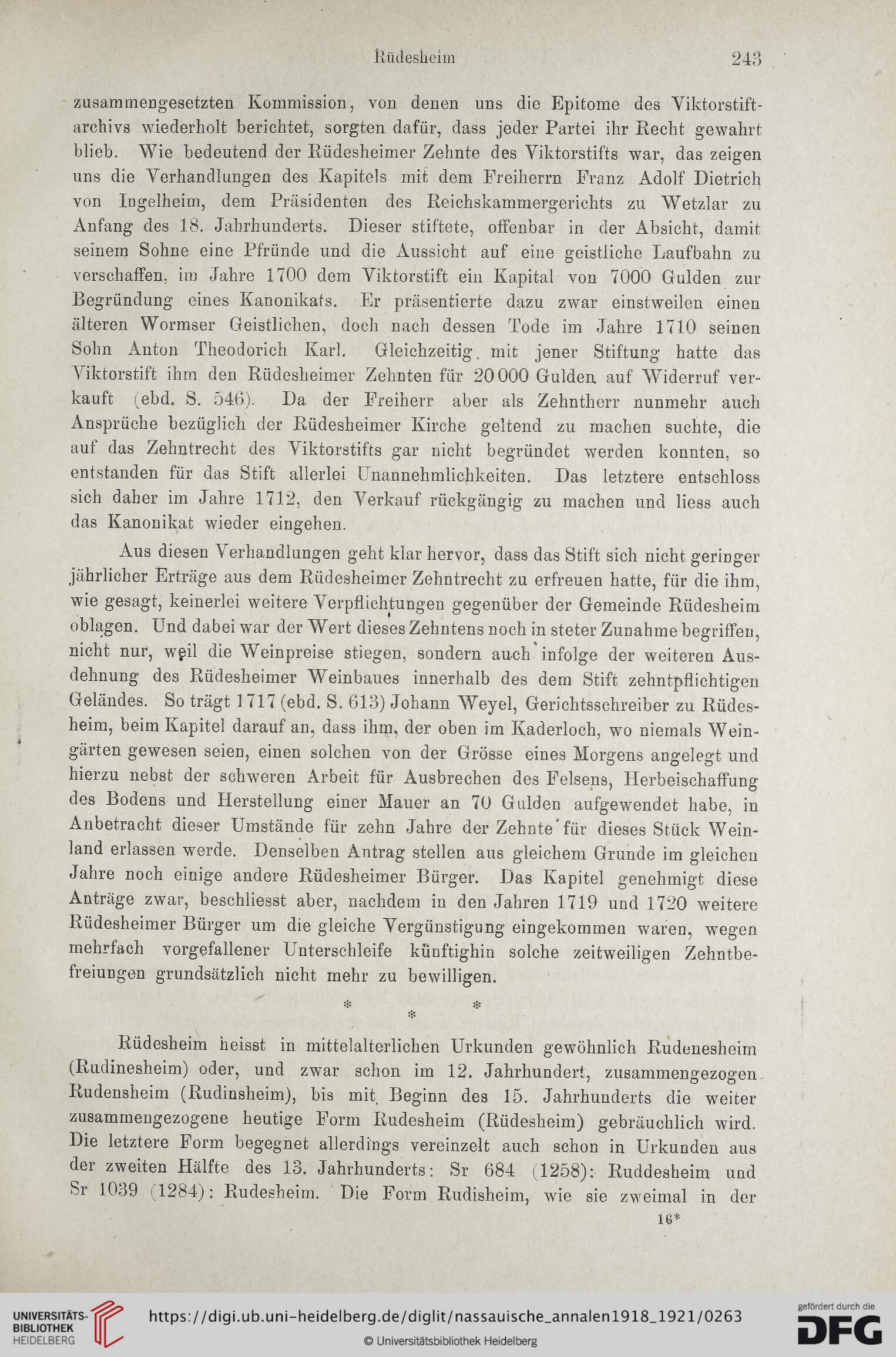Rüdesheim
243
zusammengesetzten Kommission, von denen uns die Epitome des Viktorstift-
archivs wiederholt berichtet, sorgten dafür, dass jeder Partei ihr Recht gewahrt
blieb. Wie bedeutend der Rüdesheimer Zehnte des Viktorstifts war, das zeigen
uns die Verhandlungen des Kapitels mit dem Freiherrn Franz Adolf Dietrich
von Ingelheim, dem Präsidenten des Reichskammergerichts zu Wetzlar zu
Anfang des 18. Jahrhunderts. Dieser stiftete, offenbar in der Absicht, damit
seinem Sohne eine Pfründe und die Aussicht auf eine geistliche Laufbahn zu
verschaffen, im Jahre 1700 dem Viktorstift ein Kapital von 7000 Gulden zur
Begründung eines Kanonikats. Er präsentierte dazu zwar einstweilen einen
älteren Wormser Geistlichen, doch nach dessen Tode im Jahre 1710 seinen
Sohn Anton Theodorich Karl. Gleichzeitig, mit jener Stiftung hatte das
Viktorstift ihm den Rüdesheimer Zehnten für 20000 Gulden, auf Widerruf ver-
kauft (ebd. S. 546). Da der Freiherr aber als Zehntherr nunmehr auch
Ansprüche bezüglich der Rüdesheimer Kirche geltend zu machen suchte, die
auf das Zehntrecht des Viktorstifts gar nicht begründet werden konnten, so
entstanden für das Stift allerlei Unannehmlichkeiten. Das letztere entschloss
sich daher im Jahre 1712, den Verkauf rückgängig zu machen und liess auch
das Kanonikat wieder eingehen.
Aus diesen Verhandlungen geht klar hervor, dass das Stift sich nicht geringer
jährlicher Erträge aus dem Rüdesheimer Zehntrecht zu erfreuen hatte, für die ihm,
wie gesagt, keinerlei weitere Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde Rüdesheim
oblagen. Und dabei war der Wert dieses Zehntens noch in steter Zunahme begriffen,
nicht nur, wgil die Weinpreise stiegen, sondern auch infolge der weiteren Aus-
dehnung des Rüdesheimer Weinbaues innerhalb des dem Stift zehntpflichtigen
Geländes. So trägt 1 717 (ebd. S. 613) Johann Weyel, Gerichtsschreiber zu Rüdes-
heim, beim Kapitel darauf an, dass ihm, der oben im Kaderloch, wo niemals Wein-
gärten gewesen seien, einen solchen von der Grösse eines Morgens angelegt und
hierzu nebst der schweren Arbeit für Ausbrechen des Felsens, Herbeischaffung
des Bodens und Herstellung einer Mauer an 70 Gulden aufgewendet habe, in
Anbetracht dieser Umstände für zehn Jahre der Zehnte’für dieses Stück Wein-
land erlassen werde. Denselben Antrag stellen aus gleichem Grunde im gleichen
Jahre noch einige andere Rüdesheimer Bürger. Das Kapitel genehmigt diese
Anträge zwar, beschliesst aber, nachdem in den Jahren 1719 und 1720 weitere
Rüdesheimer Bürger um die gleiche Vergünstigung eingekommen waren, wegen
mehrfach vorgefallener Unterschleife künftighin solche zeitweiligen Zehntbe-
freiungen grundsätzlich nicht mehr zu bewilligen.
❖ ❖
❖
Rüdesheim heisst in mittelalterlichen Urkunden gewöhnlich Rudenesheim
(Rudinesheim) oder, und zwar schon im 12. Jahrhundert, zusammengezogen
Rudensheim (Rudinsheim), bis mit Beginn des 15. Jahrhunderts die weiter
zusammengezogene heutige Form Rüdesheim (Rüdesheim) gebräuchlich wird.
Die letztere Form begegnet allerdings vereinzelt auch schon in Urkunden aus
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: Sr 684 (1258): Ruddesheim und
Sr 1039 (1284): Rüdesheim. Die Form Rudisheim, wie sie zweimal in der
iß*
243
zusammengesetzten Kommission, von denen uns die Epitome des Viktorstift-
archivs wiederholt berichtet, sorgten dafür, dass jeder Partei ihr Recht gewahrt
blieb. Wie bedeutend der Rüdesheimer Zehnte des Viktorstifts war, das zeigen
uns die Verhandlungen des Kapitels mit dem Freiherrn Franz Adolf Dietrich
von Ingelheim, dem Präsidenten des Reichskammergerichts zu Wetzlar zu
Anfang des 18. Jahrhunderts. Dieser stiftete, offenbar in der Absicht, damit
seinem Sohne eine Pfründe und die Aussicht auf eine geistliche Laufbahn zu
verschaffen, im Jahre 1700 dem Viktorstift ein Kapital von 7000 Gulden zur
Begründung eines Kanonikats. Er präsentierte dazu zwar einstweilen einen
älteren Wormser Geistlichen, doch nach dessen Tode im Jahre 1710 seinen
Sohn Anton Theodorich Karl. Gleichzeitig, mit jener Stiftung hatte das
Viktorstift ihm den Rüdesheimer Zehnten für 20000 Gulden, auf Widerruf ver-
kauft (ebd. S. 546). Da der Freiherr aber als Zehntherr nunmehr auch
Ansprüche bezüglich der Rüdesheimer Kirche geltend zu machen suchte, die
auf das Zehntrecht des Viktorstifts gar nicht begründet werden konnten, so
entstanden für das Stift allerlei Unannehmlichkeiten. Das letztere entschloss
sich daher im Jahre 1712, den Verkauf rückgängig zu machen und liess auch
das Kanonikat wieder eingehen.
Aus diesen Verhandlungen geht klar hervor, dass das Stift sich nicht geringer
jährlicher Erträge aus dem Rüdesheimer Zehntrecht zu erfreuen hatte, für die ihm,
wie gesagt, keinerlei weitere Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde Rüdesheim
oblagen. Und dabei war der Wert dieses Zehntens noch in steter Zunahme begriffen,
nicht nur, wgil die Weinpreise stiegen, sondern auch infolge der weiteren Aus-
dehnung des Rüdesheimer Weinbaues innerhalb des dem Stift zehntpflichtigen
Geländes. So trägt 1 717 (ebd. S. 613) Johann Weyel, Gerichtsschreiber zu Rüdes-
heim, beim Kapitel darauf an, dass ihm, der oben im Kaderloch, wo niemals Wein-
gärten gewesen seien, einen solchen von der Grösse eines Morgens angelegt und
hierzu nebst der schweren Arbeit für Ausbrechen des Felsens, Herbeischaffung
des Bodens und Herstellung einer Mauer an 70 Gulden aufgewendet habe, in
Anbetracht dieser Umstände für zehn Jahre der Zehnte’für dieses Stück Wein-
land erlassen werde. Denselben Antrag stellen aus gleichem Grunde im gleichen
Jahre noch einige andere Rüdesheimer Bürger. Das Kapitel genehmigt diese
Anträge zwar, beschliesst aber, nachdem in den Jahren 1719 und 1720 weitere
Rüdesheimer Bürger um die gleiche Vergünstigung eingekommen waren, wegen
mehrfach vorgefallener Unterschleife künftighin solche zeitweiligen Zehntbe-
freiungen grundsätzlich nicht mehr zu bewilligen.
❖ ❖
❖
Rüdesheim heisst in mittelalterlichen Urkunden gewöhnlich Rudenesheim
(Rudinesheim) oder, und zwar schon im 12. Jahrhundert, zusammengezogen
Rudensheim (Rudinsheim), bis mit Beginn des 15. Jahrhunderts die weiter
zusammengezogene heutige Form Rüdesheim (Rüdesheim) gebräuchlich wird.
Die letztere Form begegnet allerdings vereinzelt auch schon in Urkunden aus
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts: Sr 684 (1258): Ruddesheim und
Sr 1039 (1284): Rüdesheim. Die Form Rudisheim, wie sie zweimal in der
iß*