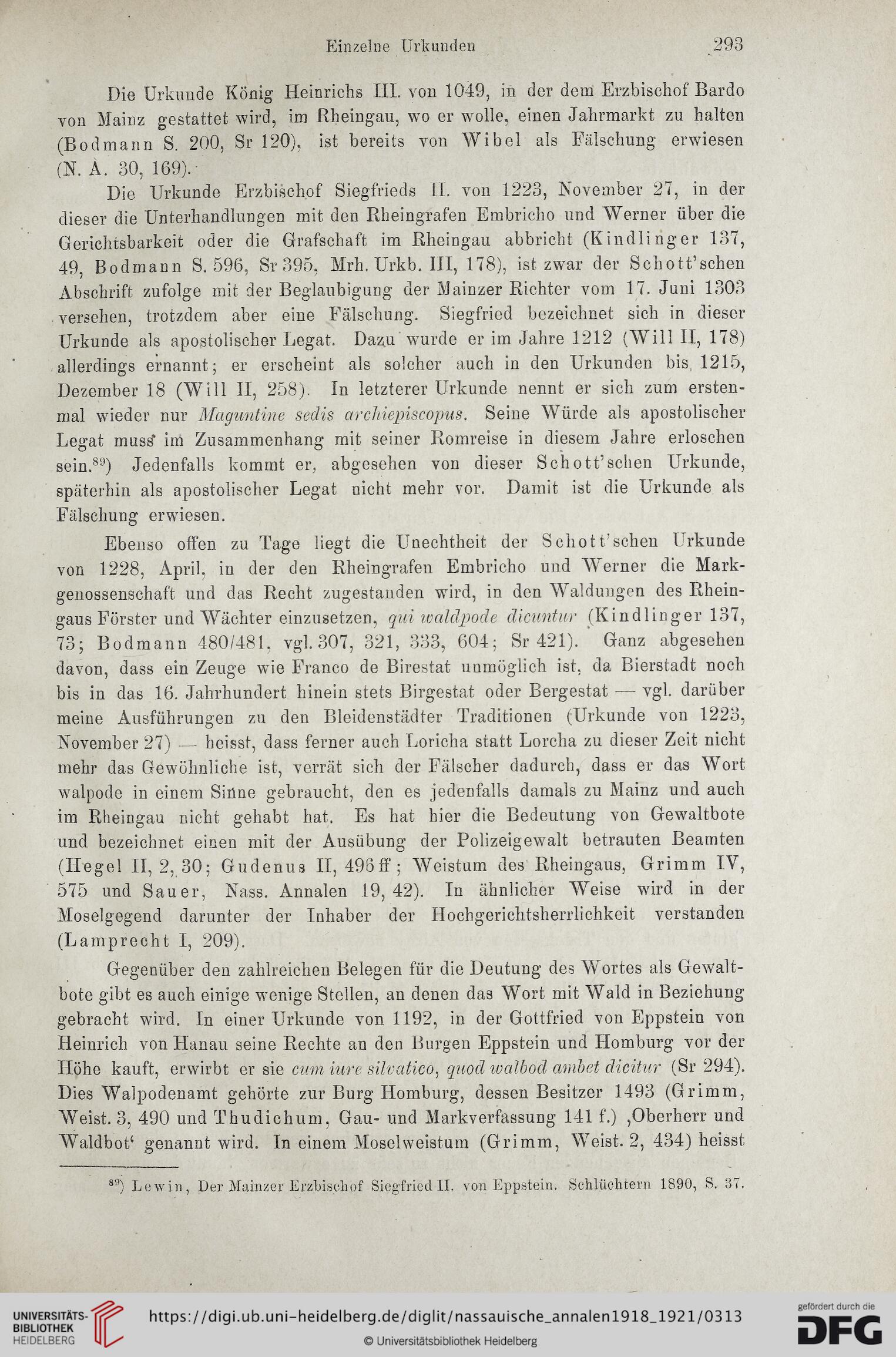Einzelne Urkunden
293
Die Urkunde König Heinrichs III. von 1049, in der dem Erzbischof Bardo
von Mainz gestattet wird, im Rheingau, wo er wolle, einen Jahrmarkt zu halten
(Bodmann S. 200, Sr 120), ist bereits von Wibel als Fälschung erwiesen
(N. A. 30, 169). -
Die Urkunde Erzbischof Siegfrieds II. von 1223, November 27, in der
dieser die Unterhandlungen mit den Rheingrafen Embricho und Werner über die
Gerichtsbarkeit oder die Grafschaft im Rheingau abbricht (Findlinger 137,
49, Bodmann S. 596, Sr 395, Mrh. Urkb. III, 178), ist zwar der Schott’sehen
Abschrift zufolge mit der Beglaubigung der Mainzer Richter vom 17. Juni 1303
versehen, trotzdem aber eine Fälschung. Siegfried bezeichnet sich in dieser
Urkunde als apostolischer Legat. Dazu wurde er im Jahre 1212 (Will II, 178)
allerdings ernannt; er erscheint als solcher auch in den Urkunden bis 1215,
Dezember 18 (Will II, 258). In letzterer Urkunde nennt er sich zum ersten-
mal wieder nur Maguntine seclis archiepiscopus. Seine Würde als apostolischer
Legat muss* im Zusammenhang mit seiner Romreise in diesem Jahre erloschen
sein.89) Jedenfalls kommt er, abgesehen von dieser Schott’sehen Urkunde,
späterhin als apostolischer Legat nicht mehr vor. Damit ist die Urkunde als
Fälschung erwiesen.
Ebenso offen zu Tage liegt die Unechtheit der Schott’sehen Urkunde
von 1228, April, in der den Rheingrafen Embricho und Werner die Mark-
genossenschaft und das Recht zugestanden wrird, in den Waldungen des Rhein-
gaus Förster und Wächter einzusetzen, qui ivaldpode dicuntur (Kindlinger 137,
73; Bodmann 480/481, vgl. 307, 321, 333, 604; Sr 421). Ganz abgesehen
davon, dass ein Zeuge wie Franco de Birestat unmöglich ist, da Bierstadt noch
bis in das 16. Jahrhundert hinein stets Birgestat oder Bergestat — vgl. darüber
meine Ausführungen zu den Bieidenstädter Traditionen (Urkunde von 1223,
November 27) — heisst, dass ferner auch Loricha statt Lorcha zu dieser Zeit nicht
mehr das Gewöhnliche ist, verrät sich der Fälscher dadurch, dass er das Wort
walpode in einem Sinne gebraucht, den es jedenfalls damals zu Mainz und auch
im Rheingau nicht gehabt hat. Es hat hier die Bedeutung von Gewaltbote
und bezeichnet einen mit der Ausübung der Polizeigewalt betrauten Beamten
(Hegel 11,2,30; Gudenus II, 496ff; Weistum des Rheingaus, Grimm IV,
575 und Sauer, Nass. Annalen 19,42). In ähnlicher Weise wird in der
Moselgegend darunter der Inhaber der Hochgericlitsherrlichkeit verstanden
(Lamprecht I, 209).
Gegenüber den zahlreichen Belegen für die Deutung des Wortes als Gewalt-
bote gibt es auch einige wenige Stellen, an denen das Wort mit Wald in Beziehung
gebracht wird. In einer Urkunde von 1192, in der Gottfried von Eppstein von
Heinrich von Hanau seine Rechte an den Burgen Eppstein und Homburg vor der
Höhe kauft, erwirbt er sie cum iure silvatico, quod tvalbod arnbet dicitur (Sr 294).
Dies Walpodenamt gehörte zur Burg Homburg, dessen Besitzer 1493 (Grimm,
Weist. 3, 490 und Thudichum, Gau- und Markverfassung 141 f.) ,Oberherr und
Waldbot4 genannt wird. In einem Moselweistum (Grimm, Weist. 2, 434) heisst
s9) Lewin, Der Mainzer Erzbischof Siegfried II. von Eppstein. Schlüchtern 1890, S. 37.
293
Die Urkunde König Heinrichs III. von 1049, in der dem Erzbischof Bardo
von Mainz gestattet wird, im Rheingau, wo er wolle, einen Jahrmarkt zu halten
(Bodmann S. 200, Sr 120), ist bereits von Wibel als Fälschung erwiesen
(N. A. 30, 169). -
Die Urkunde Erzbischof Siegfrieds II. von 1223, November 27, in der
dieser die Unterhandlungen mit den Rheingrafen Embricho und Werner über die
Gerichtsbarkeit oder die Grafschaft im Rheingau abbricht (Findlinger 137,
49, Bodmann S. 596, Sr 395, Mrh. Urkb. III, 178), ist zwar der Schott’sehen
Abschrift zufolge mit der Beglaubigung der Mainzer Richter vom 17. Juni 1303
versehen, trotzdem aber eine Fälschung. Siegfried bezeichnet sich in dieser
Urkunde als apostolischer Legat. Dazu wurde er im Jahre 1212 (Will II, 178)
allerdings ernannt; er erscheint als solcher auch in den Urkunden bis 1215,
Dezember 18 (Will II, 258). In letzterer Urkunde nennt er sich zum ersten-
mal wieder nur Maguntine seclis archiepiscopus. Seine Würde als apostolischer
Legat muss* im Zusammenhang mit seiner Romreise in diesem Jahre erloschen
sein.89) Jedenfalls kommt er, abgesehen von dieser Schott’sehen Urkunde,
späterhin als apostolischer Legat nicht mehr vor. Damit ist die Urkunde als
Fälschung erwiesen.
Ebenso offen zu Tage liegt die Unechtheit der Schott’sehen Urkunde
von 1228, April, in der den Rheingrafen Embricho und Werner die Mark-
genossenschaft und das Recht zugestanden wrird, in den Waldungen des Rhein-
gaus Förster und Wächter einzusetzen, qui ivaldpode dicuntur (Kindlinger 137,
73; Bodmann 480/481, vgl. 307, 321, 333, 604; Sr 421). Ganz abgesehen
davon, dass ein Zeuge wie Franco de Birestat unmöglich ist, da Bierstadt noch
bis in das 16. Jahrhundert hinein stets Birgestat oder Bergestat — vgl. darüber
meine Ausführungen zu den Bieidenstädter Traditionen (Urkunde von 1223,
November 27) — heisst, dass ferner auch Loricha statt Lorcha zu dieser Zeit nicht
mehr das Gewöhnliche ist, verrät sich der Fälscher dadurch, dass er das Wort
walpode in einem Sinne gebraucht, den es jedenfalls damals zu Mainz und auch
im Rheingau nicht gehabt hat. Es hat hier die Bedeutung von Gewaltbote
und bezeichnet einen mit der Ausübung der Polizeigewalt betrauten Beamten
(Hegel 11,2,30; Gudenus II, 496ff; Weistum des Rheingaus, Grimm IV,
575 und Sauer, Nass. Annalen 19,42). In ähnlicher Weise wird in der
Moselgegend darunter der Inhaber der Hochgericlitsherrlichkeit verstanden
(Lamprecht I, 209).
Gegenüber den zahlreichen Belegen für die Deutung des Wortes als Gewalt-
bote gibt es auch einige wenige Stellen, an denen das Wort mit Wald in Beziehung
gebracht wird. In einer Urkunde von 1192, in der Gottfried von Eppstein von
Heinrich von Hanau seine Rechte an den Burgen Eppstein und Homburg vor der
Höhe kauft, erwirbt er sie cum iure silvatico, quod tvalbod arnbet dicitur (Sr 294).
Dies Walpodenamt gehörte zur Burg Homburg, dessen Besitzer 1493 (Grimm,
Weist. 3, 490 und Thudichum, Gau- und Markverfassung 141 f.) ,Oberherr und
Waldbot4 genannt wird. In einem Moselweistum (Grimm, Weist. 2, 434) heisst
s9) Lewin, Der Mainzer Erzbischof Siegfried II. von Eppstein. Schlüchtern 1890, S. 37.