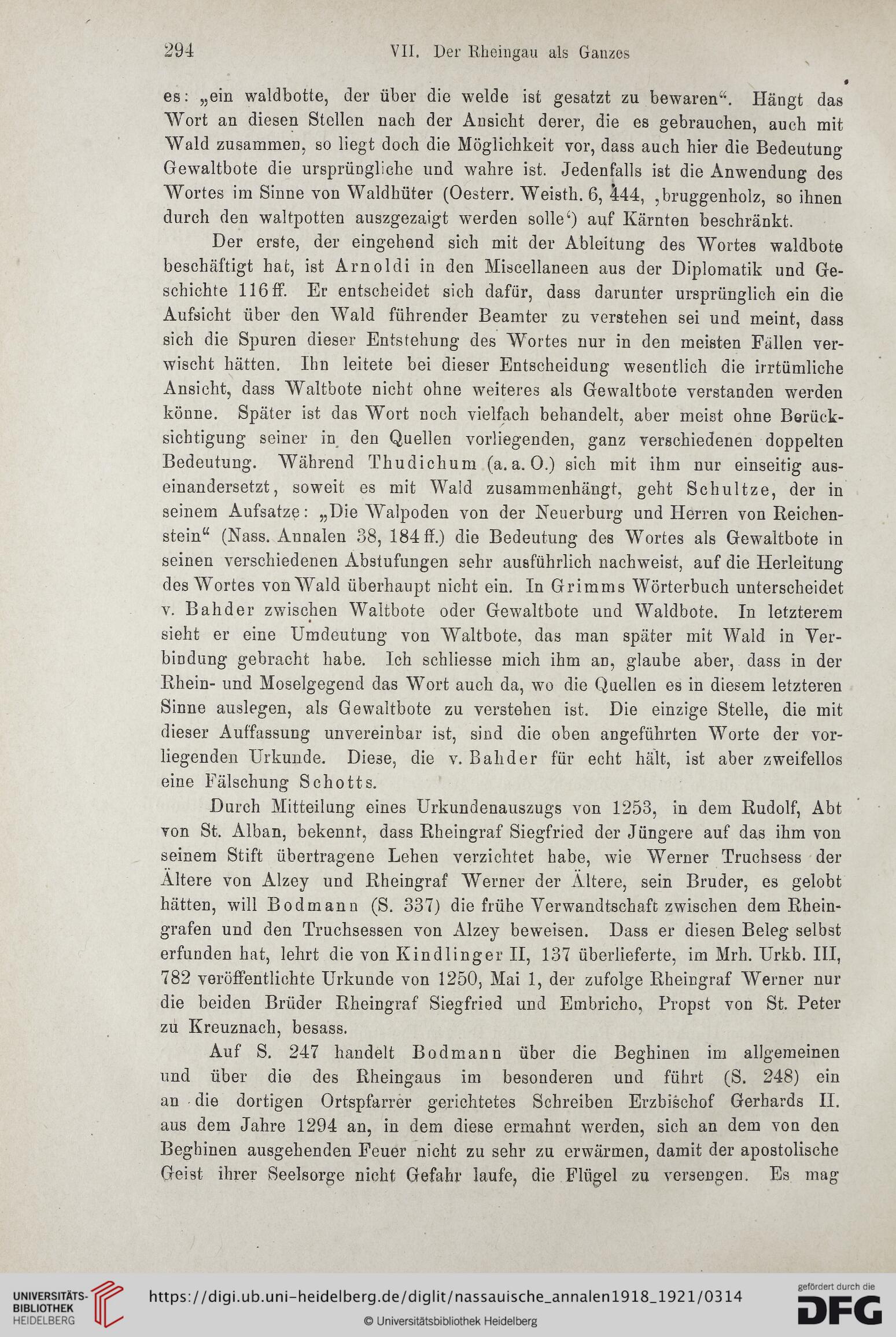294
VII. Der Rheingau als Ganzes
es: „ein waldbotte, der über die weide ist gesatzt zu bewaren“. Hängt das
Wort an diesen Stellen nach der Ansicht derer, die es gebrauchen, auch mit
Wald zusammen, so liegt doch die Möglichkeit vor, dass auch hier die Bedeutung
Gewaltbote die ursprüngliche und wahre ist. Jedenfalls ist die Anwendung des
Wortes im Sinne von Waldhüter (Oesterr. Weisth. 6, 444, ,bruggenholz, so ihnen
durch den waltpotten auszgezaigt werden solle auf Kärnten beschränkt.
Der erste, der eingehend sich mit der Ableitung des Wortes waldbote
beschäftigt hat, ist Arnoldi in den Miscellaneen aus der Diplomatik und Ge-
schichte 116 ff. Er entscheidet sich dafür, dass darunter ursprünglich ein die
Aufsicht über den Wald führender Beamter zu verstehen sei und meint, dass
sich die Spuren dieser Entstehung des Wortes nur in den meisten Fällen ver-
wischt hätten. Ibn leitete bei dieser Entscheidung wesentlich die irrtümliche
Ansicht, dass Waltbote nicht ohne weiteres als Gewaltbote verstanden werden
könne. Später ist das Wort noch vielfach behandelt, aber meist ohne Berück-
sichtigung seiner in den Quellen vorliegenden, ganz verschiedenen doppelten
Bedeutung. Während Thudichum (a. a. 0.) sich mit ihm nur einseitig aus-
einandersetzt, soweit es mit Wald zusammenhängt, geht Schultze, der in
seinem Aufsatze: „Die Walpoden von der Neuerburg und Herren von Reichen-
stein“ (Nass. Annalen 38, 184 ff.) die Bedeutung des Wortes als Gewaltbote in
seinen verschiedenen Abstufungen sehr ausführlich nachweist, auf die Herleitung
des Wortes von Wald überhaupt nicht ein. In Grimms Wörterbuch unterscheidet
v. Bahder zwischen Waltbote oder Gewaltbote und Waldbote. In letzterem
sieht er eine Umdeutung von Waltbote, das man später mit Wald in Ver-
bindung gebracht habe. Ich schliesse mich ihm an, glaube aber, dass in der
Rhein- und Moselgegend das Wort auch da, wo die Quellen es in diesem letzteren
Sinne auslegen, als Gewaltbote zu verstehen ist. Die einzige Stelle, die mit
dieser Auffassung unvereinbar ist, sind die oben angeführten Worte der vor-
liegenden Urkunde. Diese, die v. Bahder für echt hält, ist aber zweifellos
eine Fälschung Schotts.
Durch Mitteilung eines Urkundenauszugs von 1253, in dem Rudolf, Abt
von St. Alban, bekennt, dass Rheingraf Siegfried der Jüngere auf das ihm von
seinem Stift übertragene Lehen verzichtet habe, wie Werner Truchsess der
Altere von Alzey und Rheingraf Werner der Altere, sein Bruder, es gelobt
hätten, will Bodmann (S. 337) die frühe Verwandtschaft zwischen dem Rhein-
grafen und den Truchsessen von Alzey beweisen. Dass er diesen Beleg selbst
erfunden hat, lehrt die von Kindlinger II, 137 überlieferte, im Mrh. Urkb. III,
782 veröffentlichte Urkunde von 1250, Mai 1, der zufolge Rheingraf Werner nur
die beiden Brüder Rheingraf Siegfried und Embricho, Propst von St. Peter
zu Kreuznach, besass.
Auf S. 247 handelt Bodmann über die Beghinen im allgemeinen
und über die des Rheingaus im besonderen und führt (S. 248) ein
an die dortigen Ortspfarrer gerichtetes Schreiben Erzbischof Gerhards II.
aus dem Jahre 1294 an, in dem diese ermahnt werden, sich an dem von den
Beghinen ausgehenden Feuer nicht zu sehr zu erwärmen, damit der apostolische
Geist ihrer Seelsorge nicht Gefahr laufe? die Flügel zu versengen. Es mag
VII. Der Rheingau als Ganzes
es: „ein waldbotte, der über die weide ist gesatzt zu bewaren“. Hängt das
Wort an diesen Stellen nach der Ansicht derer, die es gebrauchen, auch mit
Wald zusammen, so liegt doch die Möglichkeit vor, dass auch hier die Bedeutung
Gewaltbote die ursprüngliche und wahre ist. Jedenfalls ist die Anwendung des
Wortes im Sinne von Waldhüter (Oesterr. Weisth. 6, 444, ,bruggenholz, so ihnen
durch den waltpotten auszgezaigt werden solle auf Kärnten beschränkt.
Der erste, der eingehend sich mit der Ableitung des Wortes waldbote
beschäftigt hat, ist Arnoldi in den Miscellaneen aus der Diplomatik und Ge-
schichte 116 ff. Er entscheidet sich dafür, dass darunter ursprünglich ein die
Aufsicht über den Wald führender Beamter zu verstehen sei und meint, dass
sich die Spuren dieser Entstehung des Wortes nur in den meisten Fällen ver-
wischt hätten. Ibn leitete bei dieser Entscheidung wesentlich die irrtümliche
Ansicht, dass Waltbote nicht ohne weiteres als Gewaltbote verstanden werden
könne. Später ist das Wort noch vielfach behandelt, aber meist ohne Berück-
sichtigung seiner in den Quellen vorliegenden, ganz verschiedenen doppelten
Bedeutung. Während Thudichum (a. a. 0.) sich mit ihm nur einseitig aus-
einandersetzt, soweit es mit Wald zusammenhängt, geht Schultze, der in
seinem Aufsatze: „Die Walpoden von der Neuerburg und Herren von Reichen-
stein“ (Nass. Annalen 38, 184 ff.) die Bedeutung des Wortes als Gewaltbote in
seinen verschiedenen Abstufungen sehr ausführlich nachweist, auf die Herleitung
des Wortes von Wald überhaupt nicht ein. In Grimms Wörterbuch unterscheidet
v. Bahder zwischen Waltbote oder Gewaltbote und Waldbote. In letzterem
sieht er eine Umdeutung von Waltbote, das man später mit Wald in Ver-
bindung gebracht habe. Ich schliesse mich ihm an, glaube aber, dass in der
Rhein- und Moselgegend das Wort auch da, wo die Quellen es in diesem letzteren
Sinne auslegen, als Gewaltbote zu verstehen ist. Die einzige Stelle, die mit
dieser Auffassung unvereinbar ist, sind die oben angeführten Worte der vor-
liegenden Urkunde. Diese, die v. Bahder für echt hält, ist aber zweifellos
eine Fälschung Schotts.
Durch Mitteilung eines Urkundenauszugs von 1253, in dem Rudolf, Abt
von St. Alban, bekennt, dass Rheingraf Siegfried der Jüngere auf das ihm von
seinem Stift übertragene Lehen verzichtet habe, wie Werner Truchsess der
Altere von Alzey und Rheingraf Werner der Altere, sein Bruder, es gelobt
hätten, will Bodmann (S. 337) die frühe Verwandtschaft zwischen dem Rhein-
grafen und den Truchsessen von Alzey beweisen. Dass er diesen Beleg selbst
erfunden hat, lehrt die von Kindlinger II, 137 überlieferte, im Mrh. Urkb. III,
782 veröffentlichte Urkunde von 1250, Mai 1, der zufolge Rheingraf Werner nur
die beiden Brüder Rheingraf Siegfried und Embricho, Propst von St. Peter
zu Kreuznach, besass.
Auf S. 247 handelt Bodmann über die Beghinen im allgemeinen
und über die des Rheingaus im besonderen und führt (S. 248) ein
an die dortigen Ortspfarrer gerichtetes Schreiben Erzbischof Gerhards II.
aus dem Jahre 1294 an, in dem diese ermahnt werden, sich an dem von den
Beghinen ausgehenden Feuer nicht zu sehr zu erwärmen, damit der apostolische
Geist ihrer Seelsorge nicht Gefahr laufe? die Flügel zu versengen. Es mag