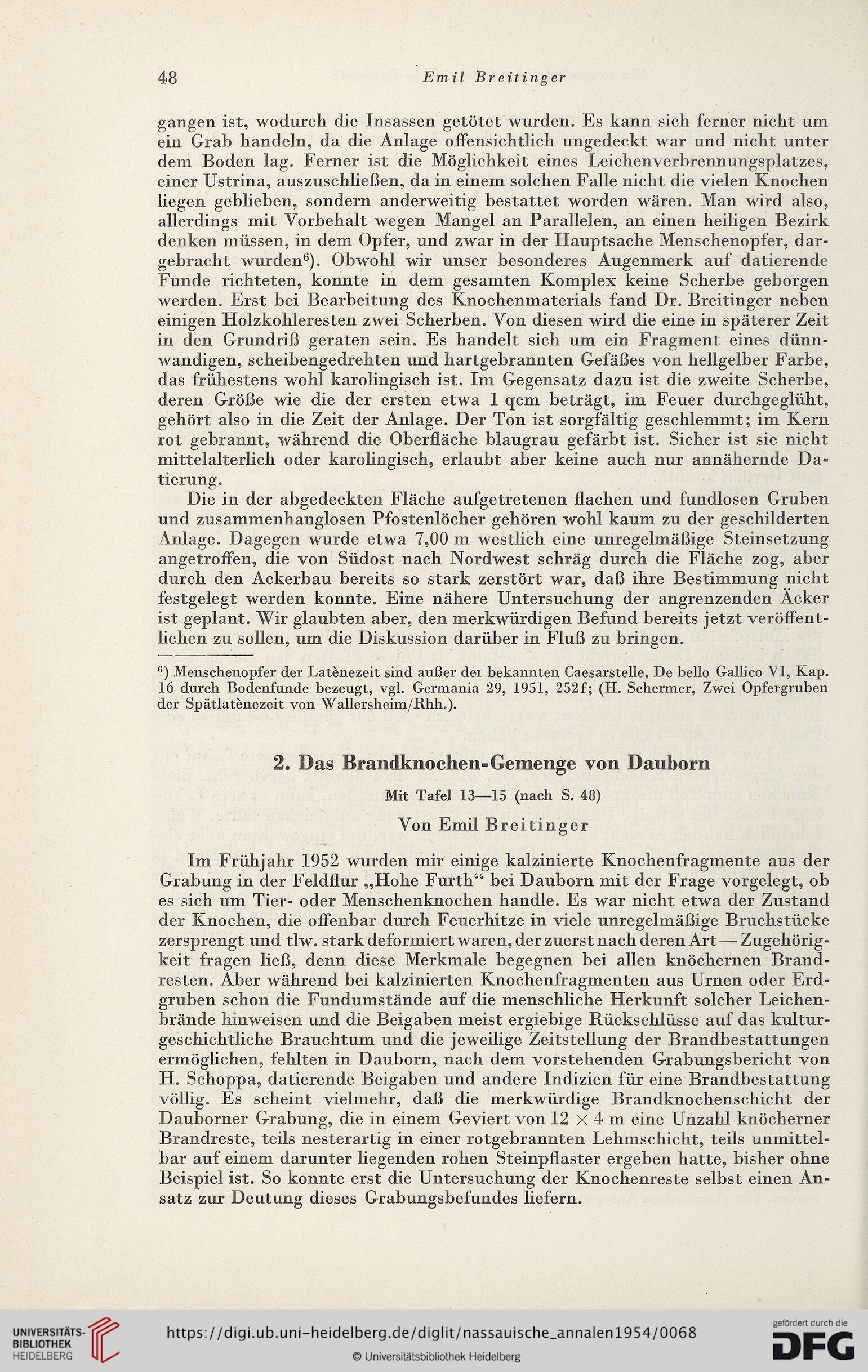48
Emil Br eitinger
gangen ist, wodurch die Insassen getötet wurden. Es kann sich ferner nicht um
ein Grab handeln, da die Anlage offensichtlich ungedeckt war und nicht unter
dem Boden lag. Ferner ist die Möglichkeit eines Leichenverbrennungsplatzes,
einer Ustrina, auszuschließen, da in einem solchen Falle nicht die vielen Knochen
liegen geblieben, sondern anderweitig bestattet worden wären. Man wird also,
allerdings mit Vorbehalt wegen Mangel an Parallelen, an einen heiligen Bezirk
denken müssen, in dem Opfer, und zwar in der Hauptsache Menschenopfer, dar-
gebracht wurden6). Obwohl wir unser besonderes Augenmerk auf datierende
Funde richteten, konnte in dem gesamten Komplex keine Scherbe geborgen
werden. Erst bei Bearbeitung des Knochenmaterials fand Dr. Breitinger neben
einigen Holzkohleresten zwei Scherben. Von diesen wird die eine in späterer Zeit
in den Grundriß geraten sein. Es handelt sich um ein Fragment eines dünn-
wandigen, scheibengedrehten und hartgebrannten Gefäßes von hellgelber Farbe,
das frühestens wohl karolingisch ist. Im Gegensatz dazu ist die zweite Scherbe,
deren Größe wie die der ersten etwa 1 qcm beträgt, im Feuer durchgeglüht,
gehört also in die Zeit der Anlage. Der Ton ist sorgfältig geschlemmt; im Kern
rot gebrannt, während die Oberfläche blaugrau gefärbt ist. Sicher ist sie nicht
mittelalterlich oder karolingisch, erlaubt aber keine auch nur annähernde Da-
tierung.
Die in der abgedeckten Fläche aufgetretenen flachen und fundlosen Gruben
und zusammenhanglosen Pfostenlöcher gehören wohl kaum zu der geschilderten
Anlage. Dagegen wurde etwa 7,00 m westlich eine unregelmäßige Steinsetzung
angetroffen, die von Südost nach Nordwest schräg durch die Fläche zog, aber
durch den Ackerbau bereits so stark zerstört war, daß ihre Bestimmung nicht
festgelegt werden konnte. Eine nähere Untersuchung der angrenzenden Acker
ist geplant. Wir glaubten aber, den merkwürdigen Befund bereits jetzt veröffent-
lichen zu sollen, um die Diskussion darüber in Fluß zu bringen.
6) Menschenopfer der Latenezeit sind außer der bekannten Caesarstelle, De bello Gallico VI, Kap.
16 durch Bodenfunde bezeugt, vgl. Germania 29, 1951, 252f; (H. Schermer, Zwei Opfergruben
der Spätlatenezeit von Wallersheim/Rhh.).
2. Das Brandknochen-Gemenge von Dauborn
Mit Tafel 13—15 (nach S. 48)
Von Emil Breitinger
Im Frühjahr 1952 wurden mir einige kalzinierte Knochenfragmente aus der
Grabung in der Feldflur „Hohe Furth“ bei Dauborn mit der Frage vorgelegt, ob
es sich um Tier- oder Menschenknochen handle. Es war nicht etwa der Zustand
der Knochen, die offenbar durch Feuerhitze in viele unregelmäßige Bruchstücke
zersprengt und tlw. stark deformiert waren, der zuerst nach deren Art—Zugehörig-
keit fragen ließ, denn diese Merkmale begegnen bei allen knöchernen Brand-
resten. Aber während bei kalzinierten Knochenfragmenten aus Urnen oder Erd-
gruben schon die Fundumstände auf die menschliche Herkunft solcher Leichen-
brände hinweisen und die Beigaben meist ergiebige Rückschlüsse auf das kultur-
geschichtliche Brauchtum und die jeweilige Zeitstellung der Brandbestattungen
ermöglichen, fehlten in Dauborn, nach dem vorstehenden Grabungsbericht von
H. Schoppa, datierende Beigaben und andere Indizien für eine Brandbestattung
völlig. Es scheint vielmehr, daß die merkwürdige Brandknochenschicht der
Dauborner Grabung, die in einem Geviert von 12 X 4 m eine Unzahl knöcherner
Brandreste, teils nesterartig in einer rotgebrannten Lehmschicht, teils unmittel-
bar auf einem darunter liegenden rohen Steinpflaster ergeben hatte, bisher ohne
Beispiel ist. So konnte erst die Untersuchung der Knochenreste selbst einen An-
satz zur Deutung dieses Grabungsbefundes liefern.
Emil Br eitinger
gangen ist, wodurch die Insassen getötet wurden. Es kann sich ferner nicht um
ein Grab handeln, da die Anlage offensichtlich ungedeckt war und nicht unter
dem Boden lag. Ferner ist die Möglichkeit eines Leichenverbrennungsplatzes,
einer Ustrina, auszuschließen, da in einem solchen Falle nicht die vielen Knochen
liegen geblieben, sondern anderweitig bestattet worden wären. Man wird also,
allerdings mit Vorbehalt wegen Mangel an Parallelen, an einen heiligen Bezirk
denken müssen, in dem Opfer, und zwar in der Hauptsache Menschenopfer, dar-
gebracht wurden6). Obwohl wir unser besonderes Augenmerk auf datierende
Funde richteten, konnte in dem gesamten Komplex keine Scherbe geborgen
werden. Erst bei Bearbeitung des Knochenmaterials fand Dr. Breitinger neben
einigen Holzkohleresten zwei Scherben. Von diesen wird die eine in späterer Zeit
in den Grundriß geraten sein. Es handelt sich um ein Fragment eines dünn-
wandigen, scheibengedrehten und hartgebrannten Gefäßes von hellgelber Farbe,
das frühestens wohl karolingisch ist. Im Gegensatz dazu ist die zweite Scherbe,
deren Größe wie die der ersten etwa 1 qcm beträgt, im Feuer durchgeglüht,
gehört also in die Zeit der Anlage. Der Ton ist sorgfältig geschlemmt; im Kern
rot gebrannt, während die Oberfläche blaugrau gefärbt ist. Sicher ist sie nicht
mittelalterlich oder karolingisch, erlaubt aber keine auch nur annähernde Da-
tierung.
Die in der abgedeckten Fläche aufgetretenen flachen und fundlosen Gruben
und zusammenhanglosen Pfostenlöcher gehören wohl kaum zu der geschilderten
Anlage. Dagegen wurde etwa 7,00 m westlich eine unregelmäßige Steinsetzung
angetroffen, die von Südost nach Nordwest schräg durch die Fläche zog, aber
durch den Ackerbau bereits so stark zerstört war, daß ihre Bestimmung nicht
festgelegt werden konnte. Eine nähere Untersuchung der angrenzenden Acker
ist geplant. Wir glaubten aber, den merkwürdigen Befund bereits jetzt veröffent-
lichen zu sollen, um die Diskussion darüber in Fluß zu bringen.
6) Menschenopfer der Latenezeit sind außer der bekannten Caesarstelle, De bello Gallico VI, Kap.
16 durch Bodenfunde bezeugt, vgl. Germania 29, 1951, 252f; (H. Schermer, Zwei Opfergruben
der Spätlatenezeit von Wallersheim/Rhh.).
2. Das Brandknochen-Gemenge von Dauborn
Mit Tafel 13—15 (nach S. 48)
Von Emil Breitinger
Im Frühjahr 1952 wurden mir einige kalzinierte Knochenfragmente aus der
Grabung in der Feldflur „Hohe Furth“ bei Dauborn mit der Frage vorgelegt, ob
es sich um Tier- oder Menschenknochen handle. Es war nicht etwa der Zustand
der Knochen, die offenbar durch Feuerhitze in viele unregelmäßige Bruchstücke
zersprengt und tlw. stark deformiert waren, der zuerst nach deren Art—Zugehörig-
keit fragen ließ, denn diese Merkmale begegnen bei allen knöchernen Brand-
resten. Aber während bei kalzinierten Knochenfragmenten aus Urnen oder Erd-
gruben schon die Fundumstände auf die menschliche Herkunft solcher Leichen-
brände hinweisen und die Beigaben meist ergiebige Rückschlüsse auf das kultur-
geschichtliche Brauchtum und die jeweilige Zeitstellung der Brandbestattungen
ermöglichen, fehlten in Dauborn, nach dem vorstehenden Grabungsbericht von
H. Schoppa, datierende Beigaben und andere Indizien für eine Brandbestattung
völlig. Es scheint vielmehr, daß die merkwürdige Brandknochenschicht der
Dauborner Grabung, die in einem Geviert von 12 X 4 m eine Unzahl knöcherner
Brandreste, teils nesterartig in einer rotgebrannten Lehmschicht, teils unmittel-
bar auf einem darunter liegenden rohen Steinpflaster ergeben hatte, bisher ohne
Beispiel ist. So konnte erst die Untersuchung der Knochenreste selbst einen An-
satz zur Deutung dieses Grabungsbefundes liefern.