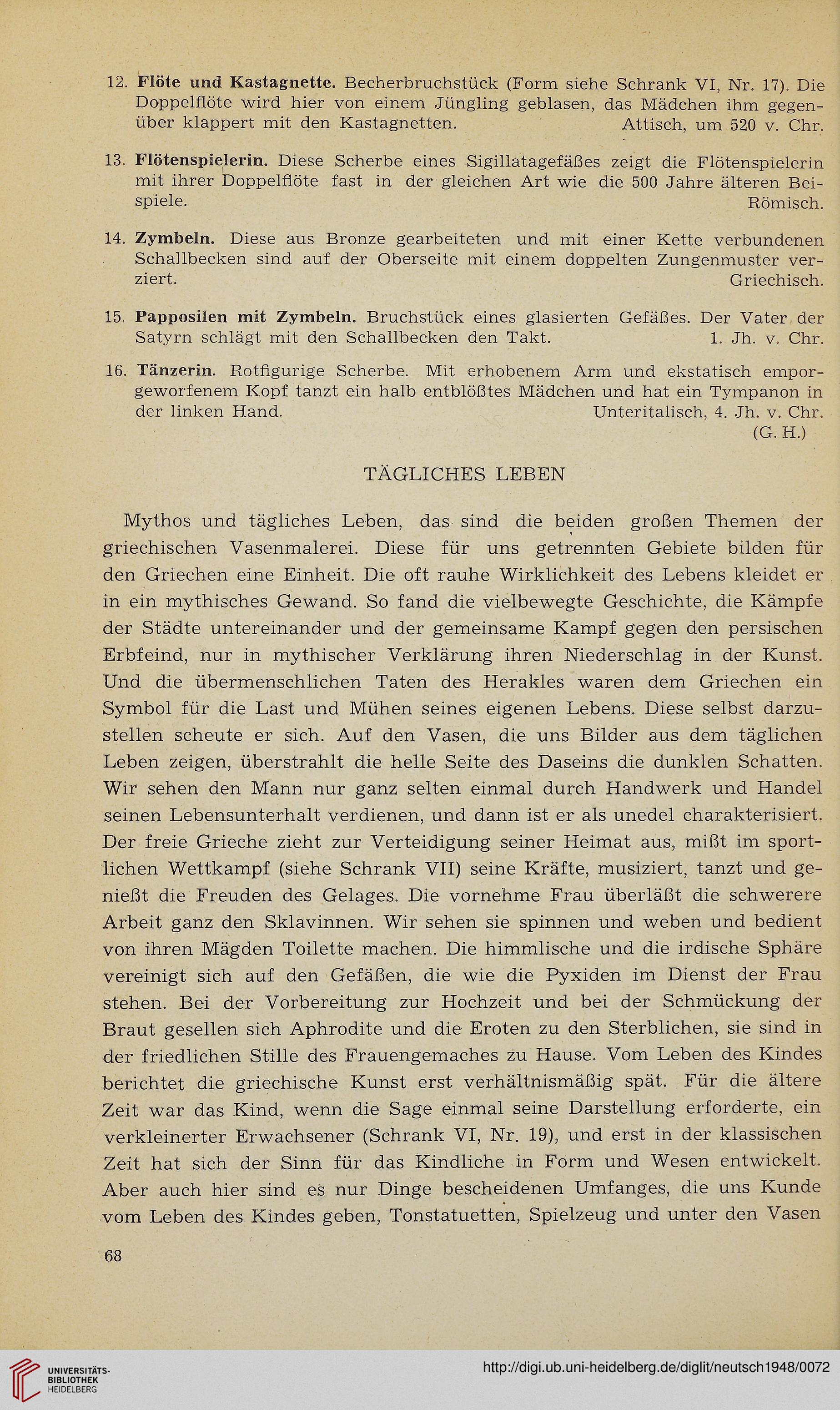12. Flöte und Kastagnette. Becherbruchstück (Form siehe Schrank VI, Nr. 17). Die
Doppelflöte wird hier von einem Jüngling geblasen, das Mädchen ihm gegen-
über klappert mit den Kastagnetten. Attisch, um 520 v. Chr.
13. Flötenspielerin. Diese Scherbe eines Sigillatagefäßes zeigt die Flötenspielerin
mit ihrer Doppelflöte fast in der gleichen Art wie die 500 Jahre älteren Bei-
spiele. Römisch.
14. Zymbeln. Diese aus Bronze gearbeiteten und mit einer Kette verbundenen
Schallbecken sind auf der Oberseite mit einem doppelten Zungenmuster ver-
ziert. Griechisch.
15. Papposilen mit Zymbeln. Bruchstück eines glasierten Gefäßes. Der Vater der
Satyrn schlägt mit den Schallbecken den Takt. 1. Jh. v. Chr.
16. Tänzerin. Rotfigurige Scherbe. Mit erhobenem Arm und ekstatisch empor-
geworfenem Kopf tanzt ein halb entblößtes Mädchen und hat ein Tympanon in
der linken Hand. Unteritalisch, 4. Jh. v. Chr.
(G. H.)
TÄGLICHES LEBEN
Mythos und tägliches Leben, das sind die beiden großen Themen der
griechischen Vasenmalerei. Diese für uns getrennten Gebiete bilden für
den Griechen eine Einheit. Die oft rauhe Wirklichkeit des Lebens kleidet er
in ein mythisches Gewand. So fand die vielbewegte Geschichte, die Kämpfe
der Städte untereinander und der gemeinsame Kampf gegen den persischen
Erbfeind, nur in mythischer Verklärung ihren Niederschlag in der Kunst.
Und die übermenschlichen Taten des Herakles waren dem Griechen ein
Symbol für die Last und Mühen seines eigenen Lebens. Diese selbst darzu-
stellen scheute er sich. Auf den Vasen, die uns Bilder aus dem täglichen
Leben zeigen, überstrahlt die helle Seite des Daseins die dunklen Schatten.
Wir sehen den Mann nur ganz selten einmal durch Handwerk und Handel
seinen Lebensunterhalt verdienen, und dann ist er als unedel charakterisiert.
Der freie Grieche zieht zur Verteidigung seiner Heimat aus, mißt im sport-
lichen Wettkampf (siehe Schrank VII) seine Kräfte, musiziert, tanzt und ge-
nießt die Freuden des Gelages. Die vornehme Frau überläßt die schwerere
Arbeit ganz den Sklavinnen. Wir sehen sie spinnen und weben und bedient
von ihren Mägden Toilette machen. Die himmlische und die irdische Sphäre
vereinigt sich auf den Gefäßen, die wie die Pyxiden im Dienst der Frau
stehen. Bei der Vorbereitung zur Hochzeit und bei der Schmückung der
Braut gesellen sich Aphrodite und die Eroten zu den Sterblichen, sie sind in
der friedlichen Stille des Frauengemaches zu Hause. Vom Leben des Kindes
berichtet die griechische Kunst erst verhältnismäßig spät. Für die ältere
Zeit war das Kind, wenn die Sage einmal seine Darstellung erforderte, ein
verkleinerter Erwachsener (Schrank VI, Nr. 19), und erst in der klassischen
Zeit hat sich der Sinn für das Kindliche in Form und Wesen entwickelt.
Aber auch hier sind es nur Dinge bescheidenen Umfanges, die uns Kunde
vom Leben des Kindes geben, Tonstatuetten, Spielzeug und unter den Vasen
68
Doppelflöte wird hier von einem Jüngling geblasen, das Mädchen ihm gegen-
über klappert mit den Kastagnetten. Attisch, um 520 v. Chr.
13. Flötenspielerin. Diese Scherbe eines Sigillatagefäßes zeigt die Flötenspielerin
mit ihrer Doppelflöte fast in der gleichen Art wie die 500 Jahre älteren Bei-
spiele. Römisch.
14. Zymbeln. Diese aus Bronze gearbeiteten und mit einer Kette verbundenen
Schallbecken sind auf der Oberseite mit einem doppelten Zungenmuster ver-
ziert. Griechisch.
15. Papposilen mit Zymbeln. Bruchstück eines glasierten Gefäßes. Der Vater der
Satyrn schlägt mit den Schallbecken den Takt. 1. Jh. v. Chr.
16. Tänzerin. Rotfigurige Scherbe. Mit erhobenem Arm und ekstatisch empor-
geworfenem Kopf tanzt ein halb entblößtes Mädchen und hat ein Tympanon in
der linken Hand. Unteritalisch, 4. Jh. v. Chr.
(G. H.)
TÄGLICHES LEBEN
Mythos und tägliches Leben, das sind die beiden großen Themen der
griechischen Vasenmalerei. Diese für uns getrennten Gebiete bilden für
den Griechen eine Einheit. Die oft rauhe Wirklichkeit des Lebens kleidet er
in ein mythisches Gewand. So fand die vielbewegte Geschichte, die Kämpfe
der Städte untereinander und der gemeinsame Kampf gegen den persischen
Erbfeind, nur in mythischer Verklärung ihren Niederschlag in der Kunst.
Und die übermenschlichen Taten des Herakles waren dem Griechen ein
Symbol für die Last und Mühen seines eigenen Lebens. Diese selbst darzu-
stellen scheute er sich. Auf den Vasen, die uns Bilder aus dem täglichen
Leben zeigen, überstrahlt die helle Seite des Daseins die dunklen Schatten.
Wir sehen den Mann nur ganz selten einmal durch Handwerk und Handel
seinen Lebensunterhalt verdienen, und dann ist er als unedel charakterisiert.
Der freie Grieche zieht zur Verteidigung seiner Heimat aus, mißt im sport-
lichen Wettkampf (siehe Schrank VII) seine Kräfte, musiziert, tanzt und ge-
nießt die Freuden des Gelages. Die vornehme Frau überläßt die schwerere
Arbeit ganz den Sklavinnen. Wir sehen sie spinnen und weben und bedient
von ihren Mägden Toilette machen. Die himmlische und die irdische Sphäre
vereinigt sich auf den Gefäßen, die wie die Pyxiden im Dienst der Frau
stehen. Bei der Vorbereitung zur Hochzeit und bei der Schmückung der
Braut gesellen sich Aphrodite und die Eroten zu den Sterblichen, sie sind in
der friedlichen Stille des Frauengemaches zu Hause. Vom Leben des Kindes
berichtet die griechische Kunst erst verhältnismäßig spät. Für die ältere
Zeit war das Kind, wenn die Sage einmal seine Darstellung erforderte, ein
verkleinerter Erwachsener (Schrank VI, Nr. 19), und erst in der klassischen
Zeit hat sich der Sinn für das Kindliche in Form und Wesen entwickelt.
Aber auch hier sind es nur Dinge bescheidenen Umfanges, die uns Kunde
vom Leben des Kindes geben, Tonstatuetten, Spielzeug und unter den Vasen
68