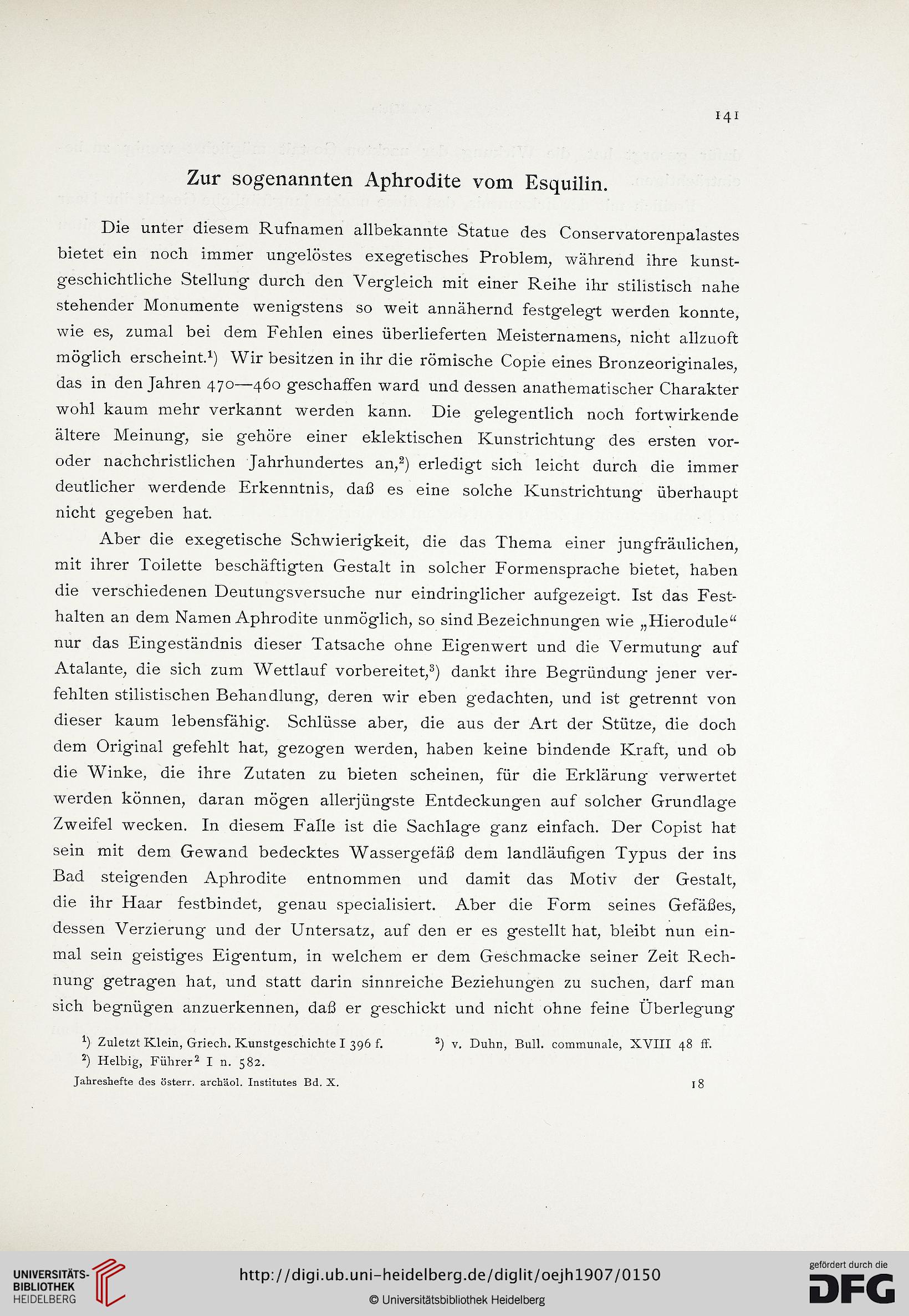Zur sogenannten Aphrodite vom Esquilin.
Die unter diesem Rufnamen allbekannte Statue des Conservatorenpalastes
bietet ein noch immer ungelöstes exegetisches Problem., während ihre kunst-
geschichtliche Stellung durch den Vergleich mit einer Reihe ihr stilistisch nahe
stehender Monumente wenigstens so weit annähernd festgelegt werden konnte,
wie es, zumal bei dem Fehlen eines überlieferten Meisternamens, nicht allzuoft
möglich erscheint.*) Wir besitzen in ihr die römische Copie eines Bronzeoriginales,
das in den Jahren 470—460 geschaffen ward und dessen anathematischer Charakter
wohl kaum mehr verkannt werden kann. Die gelegentlich noch fortwirkende
ältere Meinung, sie gehöre einer eklektischen Kunstrichtung des ersten vor-
oder nachchristlichen Jahrhundertes an,^) erledigt sich leicht durch die immer
deutlicher werdende Erkenntnis, daß es eine solche Kunstrichtung überhaupt
nicht gegeben hat.
Aber die exegetische Schwierigkeit, die das Thema einer jungfräulichen,
mit ihrer Toilette beschäftigten Gestalt in solcher Formensprache bietet, haben
die verschiedenen Deutungsversuche nur eindringlicher aufgezeigt. Ist das Fest-
halten an dem Namen Aphrodite unmöglich, so sind Bezeichnungen wie „Hierodule"
nur das Eingeständnis dieser Tatsache ohne Eigenwert und die Vermutung auf
Atalante, die sich zum Wettlauf vorbereitet,^) dankt ihre Begründung jener ver-
fehlten stilistischen Behandlung, deren wir eben gedachten, und ist getrennt von
dieser kaum lebensfähig. Schlüsse aber, die aus der Art der Stütze, die doch
dem Original gefehlt hat, gezogen werden, haben keine bindende Kraft, und ob
die Winke, die ihre Zutaten zu bieten scheinen, für die Erklärung verwertet
werden können, daran mögen allerjüngste Entdeckungen auf solcher Grundlage
Zweifel wecken. In diesem Falle ist die Sachlage ganz einfach. Der Copist hat
sein mit dem Gewand bedecktes Wassergeiäß dem landläufigen Typus der ins
Bad steigenden Aphrodite entnommen und damit das Motiv der Gestalt,
die ihr Haar festbindet, genau specialisiert. Aber die Form seines Gefäßes,
dessen Verzierung und der Untersatz, auf den er es gestellt hat, bleibt nun ein-
mal sein geistiges Eigentum, in welchem er dem Geschmacke seiner Zeit Rech-
nung getragen hat, und statt darin sinnreiche Beziehungen zu suchen, darf man
sich begnügen anzuerkennen, daß er geschickt und nicht ohne feine Überlegung
l) ZuletztKlein,Griech. Kunstgeschichte 1396 t b v. Duhn, Bull, communale, XVIII 48 ft
*) Helbig, Führer^ I n. 382.
Die unter diesem Rufnamen allbekannte Statue des Conservatorenpalastes
bietet ein noch immer ungelöstes exegetisches Problem., während ihre kunst-
geschichtliche Stellung durch den Vergleich mit einer Reihe ihr stilistisch nahe
stehender Monumente wenigstens so weit annähernd festgelegt werden konnte,
wie es, zumal bei dem Fehlen eines überlieferten Meisternamens, nicht allzuoft
möglich erscheint.*) Wir besitzen in ihr die römische Copie eines Bronzeoriginales,
das in den Jahren 470—460 geschaffen ward und dessen anathematischer Charakter
wohl kaum mehr verkannt werden kann. Die gelegentlich noch fortwirkende
ältere Meinung, sie gehöre einer eklektischen Kunstrichtung des ersten vor-
oder nachchristlichen Jahrhundertes an,^) erledigt sich leicht durch die immer
deutlicher werdende Erkenntnis, daß es eine solche Kunstrichtung überhaupt
nicht gegeben hat.
Aber die exegetische Schwierigkeit, die das Thema einer jungfräulichen,
mit ihrer Toilette beschäftigten Gestalt in solcher Formensprache bietet, haben
die verschiedenen Deutungsversuche nur eindringlicher aufgezeigt. Ist das Fest-
halten an dem Namen Aphrodite unmöglich, so sind Bezeichnungen wie „Hierodule"
nur das Eingeständnis dieser Tatsache ohne Eigenwert und die Vermutung auf
Atalante, die sich zum Wettlauf vorbereitet,^) dankt ihre Begründung jener ver-
fehlten stilistischen Behandlung, deren wir eben gedachten, und ist getrennt von
dieser kaum lebensfähig. Schlüsse aber, die aus der Art der Stütze, die doch
dem Original gefehlt hat, gezogen werden, haben keine bindende Kraft, und ob
die Winke, die ihre Zutaten zu bieten scheinen, für die Erklärung verwertet
werden können, daran mögen allerjüngste Entdeckungen auf solcher Grundlage
Zweifel wecken. In diesem Falle ist die Sachlage ganz einfach. Der Copist hat
sein mit dem Gewand bedecktes Wassergeiäß dem landläufigen Typus der ins
Bad steigenden Aphrodite entnommen und damit das Motiv der Gestalt,
die ihr Haar festbindet, genau specialisiert. Aber die Form seines Gefäßes,
dessen Verzierung und der Untersatz, auf den er es gestellt hat, bleibt nun ein-
mal sein geistiges Eigentum, in welchem er dem Geschmacke seiner Zeit Rech-
nung getragen hat, und statt darin sinnreiche Beziehungen zu suchen, darf man
sich begnügen anzuerkennen, daß er geschickt und nicht ohne feine Überlegung
l) ZuletztKlein,Griech. Kunstgeschichte 1396 t b v. Duhn, Bull, communale, XVIII 48 ft
*) Helbig, Führer^ I n. 382.