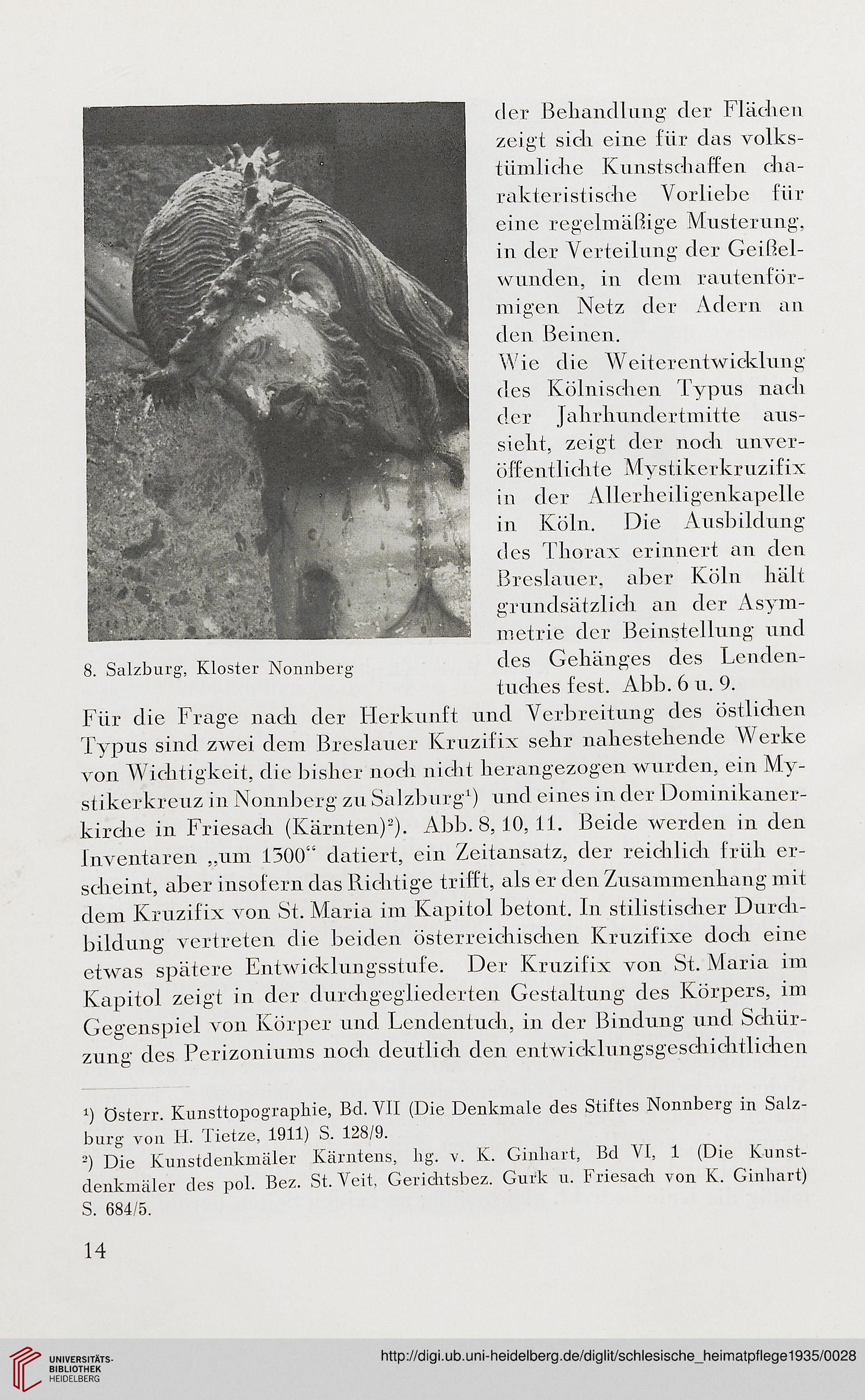der Behandlung der Flächen
zeigt sich eine für das volks-
tümliche Kunstschaffen cha-
rakteristische Vorliebe für
eine regelmäßige Musterung,
in der Verteilung der Geißel-
wunden, in dem rautenför-
migen Netz der Adern an
den Beinen.
Wie die Weiterentwicklung
des Kölnischen Typus nach
der Jahrhundertmitte aus-
sieht, zeigt der noch unver-
öffentlichte Mystikerkruzifix
in der Allerheiligenkapelle
in Köln. Die Ausbildung
des Thorax erinnert an eleu
.jl Breslauer. aber Köln hält
grundsätzlich an der Asym-
^EuÄÄÄ^.JLi-Sli^feMHEl 'J&HmBk meine der Bei nstel hing und
8. Salzburg, Kloster Nonnbetg cles Gehänges des Lenden-
tuches fest. Abb. 6 u. 9.
Für die Frage nach der Herkunft und Verbreitung des östlichen
Typus sind zwei dem Breslauer Kruzifix sehr nahestehende Werke
von Wichtigkeit, die bisher noch nicht herangezogen wurden, ein My-
sl i kerkreuz in Nonnberg zu Salzburg1) und eines in der Dominikaner-
kirche in Friesach. (Kärnten)2). Abb. 8, 10, I I . Beide werden in den
Inventaren „um 1500" datiert, ein Zeitansatz, der reichlich früh er-
scheint, aber insofern das Richtige trifft, als er den Zusammenhang mit
dem Kruzifix von St. Maria im Kapitol betont. In stilistischer Durch-
bildung vertreten die beiden österreichischen Kruzifixe doch eine
etwas spätere Entwicklungsstufe. Der Kruzifix von St. Maria im
Kapitol zeigt in der durehgegliederten Gestaltung des Körpers, im
Gegenspiel von Körper und Lendentuch, in der Bindung und Schür-
zung des Perizoniums noch deutlich den entwicklungsgeschichtlichen
österr. Kunsttopographie, Bd. VII (Die Denkmale des Stiftes Nonnberg in Salz-
burg von H. Tictze, 1911) S. 128/9.
2) Die Kunstdenkmäler Kärntens, hg. v. K. Ginlmrt, Bd VI, 1 (Die Kunst-
denkmäler cles pol. Bez. St. Veit. Gericlitsbez. Gurk u. Friesach von K. Ginliart)
S. 684/5.
14
zeigt sich eine für das volks-
tümliche Kunstschaffen cha-
rakteristische Vorliebe für
eine regelmäßige Musterung,
in der Verteilung der Geißel-
wunden, in dem rautenför-
migen Netz der Adern an
den Beinen.
Wie die Weiterentwicklung
des Kölnischen Typus nach
der Jahrhundertmitte aus-
sieht, zeigt der noch unver-
öffentlichte Mystikerkruzifix
in der Allerheiligenkapelle
in Köln. Die Ausbildung
des Thorax erinnert an eleu
.jl Breslauer. aber Köln hält
grundsätzlich an der Asym-
^EuÄÄÄ^.JLi-Sli^feMHEl 'J&HmBk meine der Bei nstel hing und
8. Salzburg, Kloster Nonnbetg cles Gehänges des Lenden-
tuches fest. Abb. 6 u. 9.
Für die Frage nach der Herkunft und Verbreitung des östlichen
Typus sind zwei dem Breslauer Kruzifix sehr nahestehende Werke
von Wichtigkeit, die bisher noch nicht herangezogen wurden, ein My-
sl i kerkreuz in Nonnberg zu Salzburg1) und eines in der Dominikaner-
kirche in Friesach. (Kärnten)2). Abb. 8, 10, I I . Beide werden in den
Inventaren „um 1500" datiert, ein Zeitansatz, der reichlich früh er-
scheint, aber insofern das Richtige trifft, als er den Zusammenhang mit
dem Kruzifix von St. Maria im Kapitol betont. In stilistischer Durch-
bildung vertreten die beiden österreichischen Kruzifixe doch eine
etwas spätere Entwicklungsstufe. Der Kruzifix von St. Maria im
Kapitol zeigt in der durehgegliederten Gestaltung des Körpers, im
Gegenspiel von Körper und Lendentuch, in der Bindung und Schür-
zung des Perizoniums noch deutlich den entwicklungsgeschichtlichen
österr. Kunsttopographie, Bd. VII (Die Denkmale des Stiftes Nonnberg in Salz-
burg von H. Tictze, 1911) S. 128/9.
2) Die Kunstdenkmäler Kärntens, hg. v. K. Ginlmrt, Bd VI, 1 (Die Kunst-
denkmäler cles pol. Bez. St. Veit. Gericlitsbez. Gurk u. Friesach von K. Ginliart)
S. 684/5.
14