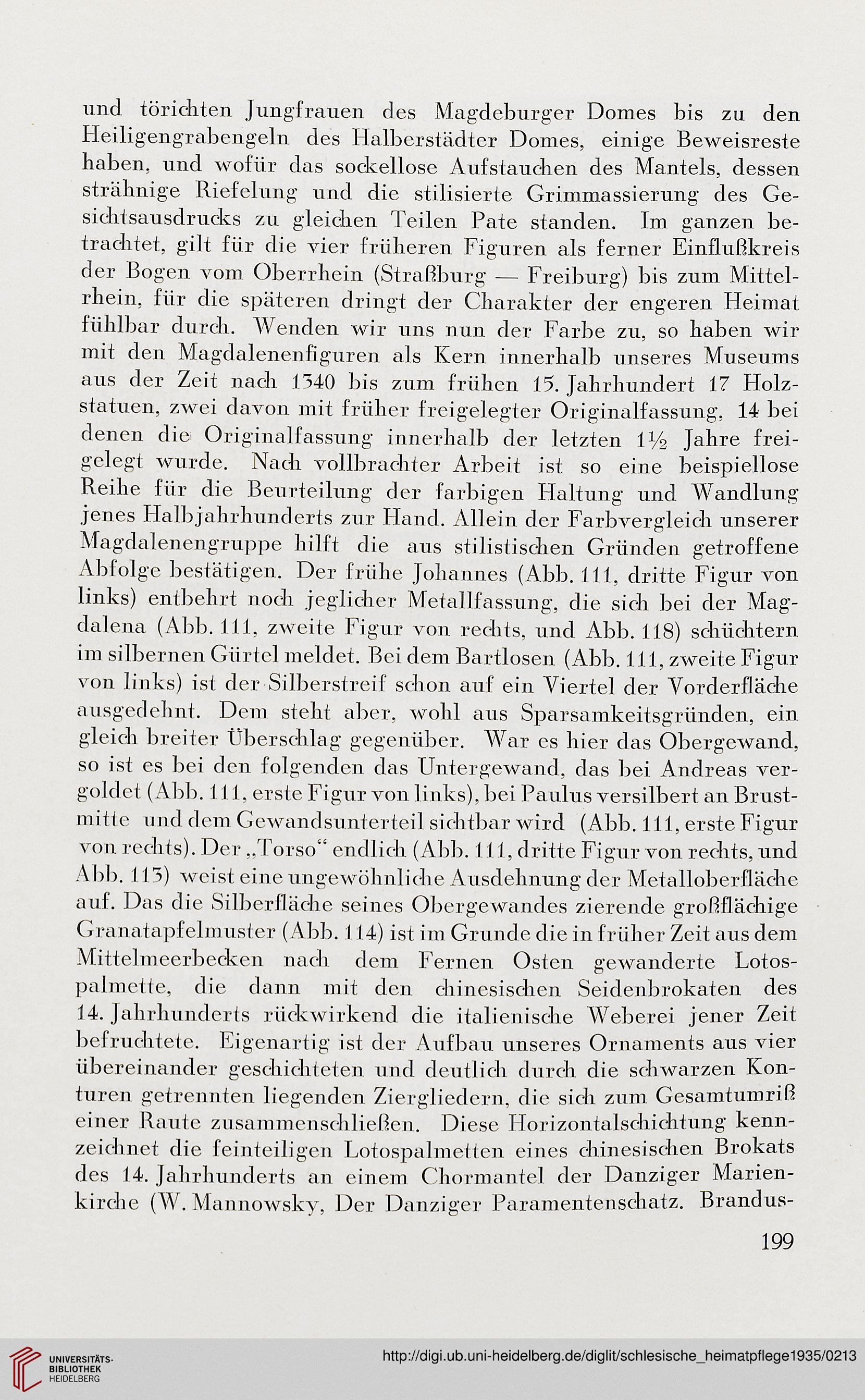und törichten Jungfrauen des Magdeburger Domes bis zu den
Heiligengrabcngeln des Halberstädter Domes, einige Beweisreste
haben, und wofür das sockellose Aufstauchen des Mantels, dessen
strähnige Riefelung und die stilisierte Grimmassierung des Ge-
sichtsausdrucks zu gleichen Teilen Pate standen. Im ganzen be-
trachtet, gilt für die vier früheren Figuren als ferner Einflußkreis
der Bogen vom Oberrhein (Straßburg — Freiburg) bis zum Mittel-
rhein, für die späteren dringt der Charakter der engeren Heimat
fühlbar durch. Wenden wir uns nun der Farbe zu, so haben wir
mit den Magdalenenfiguren als Kern innerhalb unseres Museums
aus der Zeit nach 1340 bis zum frühen 15. Jahrhundert 17 Holz-
statuen, zwei davon mit früher freigelegter Originalfassung, 14 bei
denen die Originalfassung innerhalb der letzten \xfa Jahre frei-
gelegt wurde. Nach vollbrachter Arbeit ist so eine beispiellose
Reihe für die Beurteilung der farbigen Haltung und Wandlung
jenes Halbjahrhunderts zur Hand. Allein der Farbvergleich unserer
Magdalenengruppe hilft die aus stilistischen Gründen getroffene
Abfolge bestätigen. Der frühe Johannes (Abb. 111, dritte Figur von
links) entbehrt noch jeglicher Mefallfassung, die sich bei der Mag-
dalena (Abb. 111. zweite Figur von rechts, und Abb. 118) schüchtern
im silbernen Gürtel meldet. Bei dem Bartlosen (Abb. III, zweite Figur
von links) ist der Silberstreif schon auf ein Viertel der Vorderfläche
ausgedehnt. Dem steht aber, wohl aus Sparsamkeitsgründen, ein
gleich breiter Überschlag gegenüber. War es hier das Obergewand,
so ist es bei den folgenden das Untergewand, das bei Andreas ver-
goldet ( Abi). III. erste Figur von links), bei Paulus versilbert an Brust-
mitte und dem Gewandsunterteil sichtbar wird (Abb. 111, erste Figur
von rechts). Der „Torso" endlich (Abb. 111, dritte Figur von rechts, und
Ahl). 113) weist eine ungewöhnliche Ausdehnung der Metallobcrfläche
auf. Das die Silberfläche seines Obergewandes zierende großflächige
Granatäpfeln!uster (Abb. I 14) ist im Grunde die in früher Zeit aus dem
Mittelmcerbecken nach dem Fernen Osten gewanderte Lotos-
palmette, die dann mit den chinesischen Seidenbrokaten des
14. Jahrhunderts rückwirkend die italienische Weberei jener Zeit
befruchtete. Eigenartig ist der Aufbau unseres Ornaments aus vier
übereinander geschichteten und deutlich durch die schwarzen Kon-
turen getrennten liegenden Ziergliedern, die sich zum Gesamtumriß
einer Raute zusammenschließen. Diese Horizontalschichtung kenn-
zeichnet die feinteiligen Lotospalmetten eines chinesischen Brokats
des 14. Jahrhunderts an einem Chormantel der Danziger Marien-
kirche (W. Mannowsky, Der Danziger Paramentenschatz. Brandus-
199
Heiligengrabcngeln des Halberstädter Domes, einige Beweisreste
haben, und wofür das sockellose Aufstauchen des Mantels, dessen
strähnige Riefelung und die stilisierte Grimmassierung des Ge-
sichtsausdrucks zu gleichen Teilen Pate standen. Im ganzen be-
trachtet, gilt für die vier früheren Figuren als ferner Einflußkreis
der Bogen vom Oberrhein (Straßburg — Freiburg) bis zum Mittel-
rhein, für die späteren dringt der Charakter der engeren Heimat
fühlbar durch. Wenden wir uns nun der Farbe zu, so haben wir
mit den Magdalenenfiguren als Kern innerhalb unseres Museums
aus der Zeit nach 1340 bis zum frühen 15. Jahrhundert 17 Holz-
statuen, zwei davon mit früher freigelegter Originalfassung, 14 bei
denen die Originalfassung innerhalb der letzten \xfa Jahre frei-
gelegt wurde. Nach vollbrachter Arbeit ist so eine beispiellose
Reihe für die Beurteilung der farbigen Haltung und Wandlung
jenes Halbjahrhunderts zur Hand. Allein der Farbvergleich unserer
Magdalenengruppe hilft die aus stilistischen Gründen getroffene
Abfolge bestätigen. Der frühe Johannes (Abb. 111, dritte Figur von
links) entbehrt noch jeglicher Mefallfassung, die sich bei der Mag-
dalena (Abb. 111. zweite Figur von rechts, und Abb. 118) schüchtern
im silbernen Gürtel meldet. Bei dem Bartlosen (Abb. III, zweite Figur
von links) ist der Silberstreif schon auf ein Viertel der Vorderfläche
ausgedehnt. Dem steht aber, wohl aus Sparsamkeitsgründen, ein
gleich breiter Überschlag gegenüber. War es hier das Obergewand,
so ist es bei den folgenden das Untergewand, das bei Andreas ver-
goldet ( Abi). III. erste Figur von links), bei Paulus versilbert an Brust-
mitte und dem Gewandsunterteil sichtbar wird (Abb. 111, erste Figur
von rechts). Der „Torso" endlich (Abb. 111, dritte Figur von rechts, und
Ahl). 113) weist eine ungewöhnliche Ausdehnung der Metallobcrfläche
auf. Das die Silberfläche seines Obergewandes zierende großflächige
Granatäpfeln!uster (Abb. I 14) ist im Grunde die in früher Zeit aus dem
Mittelmcerbecken nach dem Fernen Osten gewanderte Lotos-
palmette, die dann mit den chinesischen Seidenbrokaten des
14. Jahrhunderts rückwirkend die italienische Weberei jener Zeit
befruchtete. Eigenartig ist der Aufbau unseres Ornaments aus vier
übereinander geschichteten und deutlich durch die schwarzen Kon-
turen getrennten liegenden Ziergliedern, die sich zum Gesamtumriß
einer Raute zusammenschließen. Diese Horizontalschichtung kenn-
zeichnet die feinteiligen Lotospalmetten eines chinesischen Brokats
des 14. Jahrhunderts an einem Chormantel der Danziger Marien-
kirche (W. Mannowsky, Der Danziger Paramentenschatz. Brandus-
199