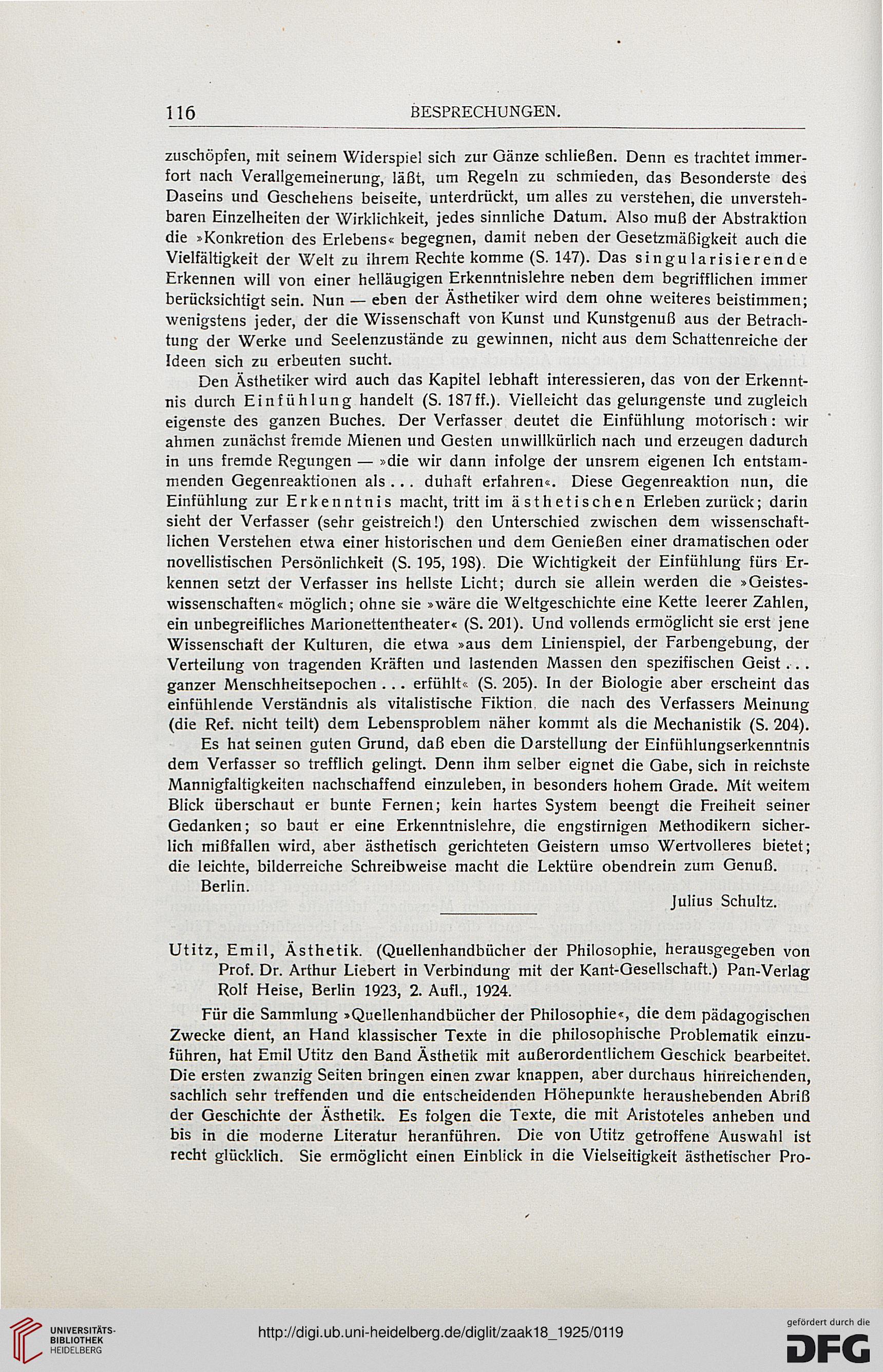116 BESPRECHUNGEN.
zuschöpfen, mit seinem Widerspiel sich zur Gänze schließen. Denn es trachtet immer-
fort nach Verallgemeinerung, läßt, um Regeln zu schmieden, das Besonderste des
Daseins und Geschehens beiseite, unterdrückt, um alles zu verstehen, die unversteh-
baren Einzelheiten der Wirklichkeit, jedes sinnliche Datum. Also muß der Abstraktion
die »Konkretion des Erlebens« begegnen, damit neben der Gesetzmäßigkeit auch die
Vielfältigkeit der Welt zu ihrem Rechte komme (S. 147). Das singularisierende
Erkennen will von einer helläugigen Erkenntnislehre neben dem begrifflichen immer
berücksichtigt sein. Nun — eben der Ästhetiker wird dem ohne weiteres beistimmen;
wenigstens jeder, der die Wissenschaft von Kunst und Kunstgenuß aus der Betrach-
tung der Werke und Seelenzustände zu gewinnen, nicht aus dem Schattenreiche der
Ideen sich zu erbeuten sucht.
Den Ästhetiker wird auch das Kapitel lebhaft interessieren, das von der Erkennt-
nis durch Einfühlung handelt (S. 187ff.). Vielleicht das gelungenste und zugleich
eigenste des ganzen Buches. Der Verfasser deutet die Einfühlung motorisch: wir
ahmen zunächst fremde Mienen und Gesten unwillkürlich nach und erzeugen dadurch
in uns fremde Regungen — »die wir dann infolge der unsrem eigenen Ich entstam-
menden Gegenreaktionen als . . . duhaft erfahren«. Diese Gegenreaktion nun, die
Einfühlung zur Erkenntnis macht, tritt im ästhetischen Erleben zurück; darin
sieht der Verfasser (sehr geistreich!) den Unterschied zwischen dem wissenschaft-
lichen Verstehen etwa einer historischen und dem Genießen einer dramatischen oder
novellistischen Persönlichkeit (S. 195, 19S). Die Wichtigkeit der Einfühlung fürs Er-
kennen setzt der Verfasser ins hellste Licht; durch sie allein werden die »Geistes-
wissenschaften« möglich; ohne sie »wäre die Weltgeschichte eine Kette leerer Zahlen,
ein unbegreifliches Marionettentheater« (S. 201). Und vollends ermöglicht sie erst jene
Wissenschaft der Kulturen, die etwa »aus dem Linienspiel, der Farbengebung, der
Verteilung von tragenden Kräften und lastenden Massen den spezifischen Geist . . .
ganzer Menschheitsepochen . . . erfühlt« (S. 205). In der Biologie aber erscheint das
einfühlende Verständnis als vitalistische Fiktion die nach des Verfassers Meinung
(die Ref. nicht teilt) dem Lebensproblem näher kommt als die Mechanistik (S. 204).
Es hat seinen guten Grund, daß eben die Darstellung der Einfühlungserkenntnis
dem Verfasser so trefflich gelingt. Denn ihm selber eignet die Gabe, sich in reichste
Mannigfaltigkeiten nachschaffend einzuleben, in besonders hohem Grade. Mit weitem
Blick überschaut er bunte Fernen; kein hartes System beengt die Freiheit seiner
Gedanken; so baut er eine Erkenntnislehre, die engstirnigen Methodikern sicher-
lich mißfallen wird, aber ästhetisch gerichteten Geistern umso Wertvolleres bietet;
die leichte, bilderreiche Schreibweise macht die Lektüre obendrein zum Genuß.
Berlin.
Julius Schultz.
Utitz, Emil, Ästhetik. (Quellenhandbücher der Philosophie, herausgegeben von
Prof. Dr. Arthur Liebert in Verbindung mit der Kant-Gesellschaft.) Pan-Verlag
Rolf Heise, Berlin 1923, 2. Aufl., 1924.
Für die Sammlung »Quellenhandbücher der Philosophie«, die dem pädagogischen
Zwecke dient, an Hand klassischer Texte in die philosophische Problematik einzu-
führen, hat Emil Utitz den Band Ästhetik mit außerordentlichem Geschick bearbeitet.
Die ersten zwanzig Seiten bringen einen zwar knappen, aber durchaus hinreichenden,
sachlich sehr treffenden und die entscheidenden Höhepunkte heraushebenden Abriß
der Geschichte der Ästhetik. Es folgen die Texte, die mit Aristoteles anheben und
bis in die moderne Literatur heranführen. Die von Utitz getroffene Auswahl ist
recht glücklich. Sie ermöglicht einen Einblick in die Vielseitigkeit ästhetischer Pro-
zuschöpfen, mit seinem Widerspiel sich zur Gänze schließen. Denn es trachtet immer-
fort nach Verallgemeinerung, läßt, um Regeln zu schmieden, das Besonderste des
Daseins und Geschehens beiseite, unterdrückt, um alles zu verstehen, die unversteh-
baren Einzelheiten der Wirklichkeit, jedes sinnliche Datum. Also muß der Abstraktion
die »Konkretion des Erlebens« begegnen, damit neben der Gesetzmäßigkeit auch die
Vielfältigkeit der Welt zu ihrem Rechte komme (S. 147). Das singularisierende
Erkennen will von einer helläugigen Erkenntnislehre neben dem begrifflichen immer
berücksichtigt sein. Nun — eben der Ästhetiker wird dem ohne weiteres beistimmen;
wenigstens jeder, der die Wissenschaft von Kunst und Kunstgenuß aus der Betrach-
tung der Werke und Seelenzustände zu gewinnen, nicht aus dem Schattenreiche der
Ideen sich zu erbeuten sucht.
Den Ästhetiker wird auch das Kapitel lebhaft interessieren, das von der Erkennt-
nis durch Einfühlung handelt (S. 187ff.). Vielleicht das gelungenste und zugleich
eigenste des ganzen Buches. Der Verfasser deutet die Einfühlung motorisch: wir
ahmen zunächst fremde Mienen und Gesten unwillkürlich nach und erzeugen dadurch
in uns fremde Regungen — »die wir dann infolge der unsrem eigenen Ich entstam-
menden Gegenreaktionen als . . . duhaft erfahren«. Diese Gegenreaktion nun, die
Einfühlung zur Erkenntnis macht, tritt im ästhetischen Erleben zurück; darin
sieht der Verfasser (sehr geistreich!) den Unterschied zwischen dem wissenschaft-
lichen Verstehen etwa einer historischen und dem Genießen einer dramatischen oder
novellistischen Persönlichkeit (S. 195, 19S). Die Wichtigkeit der Einfühlung fürs Er-
kennen setzt der Verfasser ins hellste Licht; durch sie allein werden die »Geistes-
wissenschaften« möglich; ohne sie »wäre die Weltgeschichte eine Kette leerer Zahlen,
ein unbegreifliches Marionettentheater« (S. 201). Und vollends ermöglicht sie erst jene
Wissenschaft der Kulturen, die etwa »aus dem Linienspiel, der Farbengebung, der
Verteilung von tragenden Kräften und lastenden Massen den spezifischen Geist . . .
ganzer Menschheitsepochen . . . erfühlt« (S. 205). In der Biologie aber erscheint das
einfühlende Verständnis als vitalistische Fiktion die nach des Verfassers Meinung
(die Ref. nicht teilt) dem Lebensproblem näher kommt als die Mechanistik (S. 204).
Es hat seinen guten Grund, daß eben die Darstellung der Einfühlungserkenntnis
dem Verfasser so trefflich gelingt. Denn ihm selber eignet die Gabe, sich in reichste
Mannigfaltigkeiten nachschaffend einzuleben, in besonders hohem Grade. Mit weitem
Blick überschaut er bunte Fernen; kein hartes System beengt die Freiheit seiner
Gedanken; so baut er eine Erkenntnislehre, die engstirnigen Methodikern sicher-
lich mißfallen wird, aber ästhetisch gerichteten Geistern umso Wertvolleres bietet;
die leichte, bilderreiche Schreibweise macht die Lektüre obendrein zum Genuß.
Berlin.
Julius Schultz.
Utitz, Emil, Ästhetik. (Quellenhandbücher der Philosophie, herausgegeben von
Prof. Dr. Arthur Liebert in Verbindung mit der Kant-Gesellschaft.) Pan-Verlag
Rolf Heise, Berlin 1923, 2. Aufl., 1924.
Für die Sammlung »Quellenhandbücher der Philosophie«, die dem pädagogischen
Zwecke dient, an Hand klassischer Texte in die philosophische Problematik einzu-
führen, hat Emil Utitz den Band Ästhetik mit außerordentlichem Geschick bearbeitet.
Die ersten zwanzig Seiten bringen einen zwar knappen, aber durchaus hinreichenden,
sachlich sehr treffenden und die entscheidenden Höhepunkte heraushebenden Abriß
der Geschichte der Ästhetik. Es folgen die Texte, die mit Aristoteles anheben und
bis in die moderne Literatur heranführen. Die von Utitz getroffene Auswahl ist
recht glücklich. Sie ermöglicht einen Einblick in die Vielseitigkeit ästhetischer Pro-