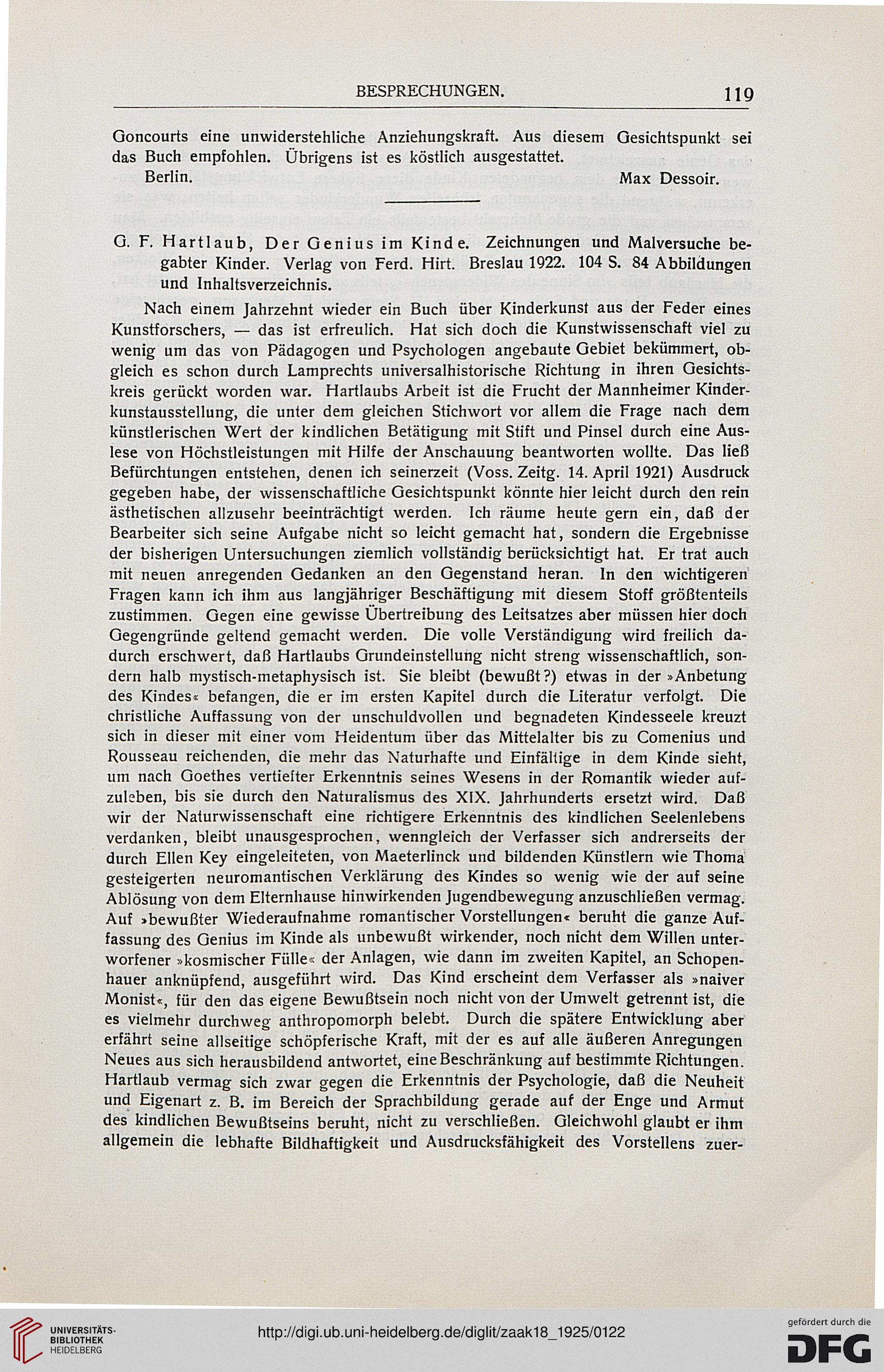BESPRECHUNGEN. 1]g
Qoncourts eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Aus diesem Gesichtspunkt sei
das Buch empfohlen. Übrigens ist es köstlich ausgestattet.
Berlin. Max Dessoir.
G. F. Hartlaub, Der Genius im Kinde. Zeichnungen und Malversuche be-
gabter Kinder. Verlag von Ferd. Hirt. Breslau 1922. 104 S. 84 Abbildungen
und Inhaltsverzeichnis.
Nach einem Jahrzehnt wieder ein Buch über Kinderkunst aus der Feder eines
Kunstforschers, — das ist erfreulich. Hat sich doch die Kunstwissenschaft viel zu
wenig um das von Pädagogen und Psychologen angebaute Gebiet bekümmert, ob-
gleich es schon durch Lamprechts universalhistorische Richtung in ihren Gesichts-
kreis gerückt worden war. Hartlaubs Arbeit ist die Frucht der Mannheimer Kinder-
kunstausstellung, die unter dem gleichen Stichwort vor allem die Frage nach dem
künstlerischen Wert der kindlichen Betätigung mit Stift und Pinsel durch eine Aus-
lese von Höchstleistungen mit Hilfe der Anschauung beantworten wollte. Das ließ
Befürchtungen entstehen, denen ich seinerzeit (Voss. Zeitg. 14. April 1921) Ausdruck
gegeben habe, der wissenschaftliche Gesichtspunkt könnte hier leicht durch den rein
ästhetischen allzusehr beeinträchtigt werden. Ich räume heute gern ein, daß der
Bearbeiter sich seine Aufgabe nicht so leicht gemacht hat, sondern die Ergebnisse
der bisherigen Untersuchungen ziemlich vollständig berücksichtigt hat. Er trat auch
mit neuen anregenden Gedanken an den Gegenstand heran. In den wichtigeren
Fragen kann ich ihm aus langjähriger Beschäftigung mit diesem Stoff größtenteils
zustimmen. Gegen eine gewisse Übertreibung des Leitsatzes aber müssen hier doch
Gegengründe geltend gemacht werden. Die volle Verständigung wird freilich da-
durch erschwert, daß Hartlaubs Grundeinstellung nicht streng wissenschaftlich, son-
dern halb mystisch-metaphysisch ist. Sie bleibt (bewußt ?) etwas in der »Anbetung
des Kindes« befangen, die er im ersten Kapitel durch die Literatur verfolgt. Die
christliche Auffassung von der unschuldvollen und begnadeten Kindesseele kreuzt
sich in dieser mit einer vom Heidentum über das Mittelalter bis zu Comenius und
Rousseau reichenden, die mehr das Naturhafte und Einfähige in dem Kinde sieht,
um nach Goethes vertiefter Erkenntnis seines Wesens in der Romantik wieder auf-
zuleben, bis sie durch den Naturalismus des XIX. Jahrhunderts ersetzt wird. Daß
wir der Naturwissenschaft eine richtigere Erkenntnis des kindlichen Seelenlebens
verdanken, bleibt unausgesprochen, wenngleich der Verfasser sich andrerseits der
durch Ellen Key eingeleiteten, von Maeterlinck und bildenden Künstlern wie Thoma
gesteigerten neuromantischen Verklärung des Kindes so wenig wie der auf seine
Ablösung von dem Elternhause hinwirkenden Jugendbewegung anzuschließen vermag.
Auf >bewußter Wiederaufnahme romantischer Vorstellungen« beruht die ganze Auf-
fassung des Genius im Kinde als unbewußt wirkender, noch nicht dem Willen unter-
worfener »kosmischer Fülle« der Anlagen, wie dann im zweiten Kapitel, an Schopen-
hauer anknüpfend, ausgeführt wird. Das Kind erscheint dem Verfasser als »naiver
Monist«, für den das eigene Bewußtsein noch nicht von der Umwelt getrennt ist, die
es vielmehr durchweg anthropomorph belebt. Durch die spätere Entwicklung aber
erfährt seine allseitige schöpferische Kraft, mit der es auf alle äußeren Anregungen
Neues aus sich herausbildend antwortet, eine Beschränkung auf hestimmte Richtungen.
Hartlaub vermag sich zwar gegen die Erkenntnis der Psychologie, daß die Neuheit
und Eigenart z. B. im Bereich der Sprachbildung gerade auf der Enge und Armut
des kindlichen Bewußtseins beruht, nicht zu verschließen. Gleichwohl glaubt er ihm
allgemein die lebhafte Bildhaftigkeit und Ausdrucksfähigkeit des Vorstellens zuer-
Qoncourts eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Aus diesem Gesichtspunkt sei
das Buch empfohlen. Übrigens ist es köstlich ausgestattet.
Berlin. Max Dessoir.
G. F. Hartlaub, Der Genius im Kinde. Zeichnungen und Malversuche be-
gabter Kinder. Verlag von Ferd. Hirt. Breslau 1922. 104 S. 84 Abbildungen
und Inhaltsverzeichnis.
Nach einem Jahrzehnt wieder ein Buch über Kinderkunst aus der Feder eines
Kunstforschers, — das ist erfreulich. Hat sich doch die Kunstwissenschaft viel zu
wenig um das von Pädagogen und Psychologen angebaute Gebiet bekümmert, ob-
gleich es schon durch Lamprechts universalhistorische Richtung in ihren Gesichts-
kreis gerückt worden war. Hartlaubs Arbeit ist die Frucht der Mannheimer Kinder-
kunstausstellung, die unter dem gleichen Stichwort vor allem die Frage nach dem
künstlerischen Wert der kindlichen Betätigung mit Stift und Pinsel durch eine Aus-
lese von Höchstleistungen mit Hilfe der Anschauung beantworten wollte. Das ließ
Befürchtungen entstehen, denen ich seinerzeit (Voss. Zeitg. 14. April 1921) Ausdruck
gegeben habe, der wissenschaftliche Gesichtspunkt könnte hier leicht durch den rein
ästhetischen allzusehr beeinträchtigt werden. Ich räume heute gern ein, daß der
Bearbeiter sich seine Aufgabe nicht so leicht gemacht hat, sondern die Ergebnisse
der bisherigen Untersuchungen ziemlich vollständig berücksichtigt hat. Er trat auch
mit neuen anregenden Gedanken an den Gegenstand heran. In den wichtigeren
Fragen kann ich ihm aus langjähriger Beschäftigung mit diesem Stoff größtenteils
zustimmen. Gegen eine gewisse Übertreibung des Leitsatzes aber müssen hier doch
Gegengründe geltend gemacht werden. Die volle Verständigung wird freilich da-
durch erschwert, daß Hartlaubs Grundeinstellung nicht streng wissenschaftlich, son-
dern halb mystisch-metaphysisch ist. Sie bleibt (bewußt ?) etwas in der »Anbetung
des Kindes« befangen, die er im ersten Kapitel durch die Literatur verfolgt. Die
christliche Auffassung von der unschuldvollen und begnadeten Kindesseele kreuzt
sich in dieser mit einer vom Heidentum über das Mittelalter bis zu Comenius und
Rousseau reichenden, die mehr das Naturhafte und Einfähige in dem Kinde sieht,
um nach Goethes vertiefter Erkenntnis seines Wesens in der Romantik wieder auf-
zuleben, bis sie durch den Naturalismus des XIX. Jahrhunderts ersetzt wird. Daß
wir der Naturwissenschaft eine richtigere Erkenntnis des kindlichen Seelenlebens
verdanken, bleibt unausgesprochen, wenngleich der Verfasser sich andrerseits der
durch Ellen Key eingeleiteten, von Maeterlinck und bildenden Künstlern wie Thoma
gesteigerten neuromantischen Verklärung des Kindes so wenig wie der auf seine
Ablösung von dem Elternhause hinwirkenden Jugendbewegung anzuschließen vermag.
Auf >bewußter Wiederaufnahme romantischer Vorstellungen« beruht die ganze Auf-
fassung des Genius im Kinde als unbewußt wirkender, noch nicht dem Willen unter-
worfener »kosmischer Fülle« der Anlagen, wie dann im zweiten Kapitel, an Schopen-
hauer anknüpfend, ausgeführt wird. Das Kind erscheint dem Verfasser als »naiver
Monist«, für den das eigene Bewußtsein noch nicht von der Umwelt getrennt ist, die
es vielmehr durchweg anthropomorph belebt. Durch die spätere Entwicklung aber
erfährt seine allseitige schöpferische Kraft, mit der es auf alle äußeren Anregungen
Neues aus sich herausbildend antwortet, eine Beschränkung auf hestimmte Richtungen.
Hartlaub vermag sich zwar gegen die Erkenntnis der Psychologie, daß die Neuheit
und Eigenart z. B. im Bereich der Sprachbildung gerade auf der Enge und Armut
des kindlichen Bewußtseins beruht, nicht zu verschließen. Gleichwohl glaubt er ihm
allgemein die lebhafte Bildhaftigkeit und Ausdrucksfähigkeit des Vorstellens zuer-