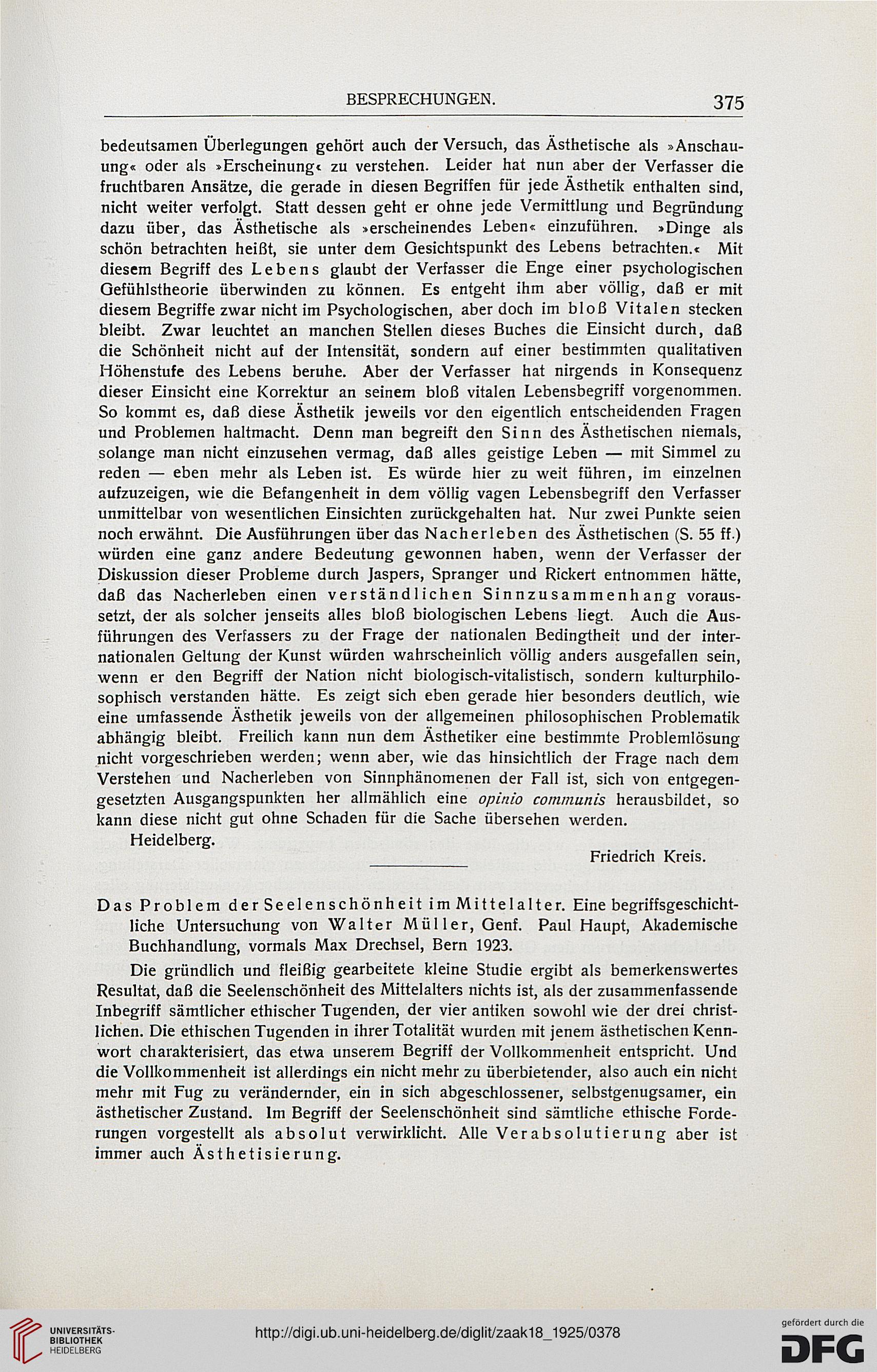BESPRECHUNGEN. 375
bedeutsamen Überlegungen gehört auch der Versuch, das Ästhetische als »Anschau-
ung« oder als »Erscheinung! zu verstehen. Leider hat nun aber der Verfasser die
fruchtbaren Ansätze, die gerade in diesen Begriffen für jede Ästhetik enthalten sind,
nicht weiter verfolgt. Statt dessen geht er ohne jede Vermittlung und Begründung
dazu über, das Ästhetische als »erscheinendes Leben« einzuführen. »Dinge als
schön betrachten heißt, sie unter dem Gesichtspunkt des Lebens betrachten.« Mit
diesem Begriff des Lebens glaubt der Verfasser die Enge einer psychologischen
Qefühlstheorie überwinden zu können. Es entgeht ihm aber völlig, daß er mit
diesem Begriffe zwar nicht im Psychologischen, aber doch im bloß Vitalen stecken
bleibt. Zwar leuchtet an manchen Stellen dieses Buches die Einsicht durch, daß
die Schönheit nicht auf der Intensität, sondern auf einer bestimmten qualitativen
Höhenstufe des Lebens beruhe. Aber der Verfasser hat nirgends in Konsequenz
dieser Einsicht eine Korrektur an seinem bloß vitalen Lebensbegriff vorgenommen.
So kommt es, daß diese Ästhetik jeweils vor den eigentlich entscheidenden Fragen
und Problemen haltmacht. Denn man begreift den Sinn des Ästhetischen niemals,
solange man nicht einzusehen vermag, daß alles geistige Leben — mit Simmel zu
reden — eben mehr als Leben ist. Es würde hier zu weit führen, im einzelnen
aufzuzeigen, wie die Befangenheit in dem völlig vagen Lebensbegriff den Verfasser
unmittelbar von wesentlichen Einsichten zurückgehalten hat. Nur zwei Punkte seien
noch erwähnt. Die Ausführungen über das Nacherleben des Ästhetischen (S. 55 ff.)
würden eine ganz andere Bedeutung gewonnen haben, wenn der Verfasser der
Diskussion dieser Probleme durch Jaspers, Spranger und Rickert entnommen hätte,
daß das Nacherleben einen verständlichen Sinnzusammenhang voraus-
setzt, der als solcher jenseits alles bloß biologischen Lebens liegt. Auch die Aus-
führungen des Verfassers zu der Frage der nationalen Bedingtheit und der inter-
nationalen Geltung der Kunst würden wahrscheinlich völlig anders ausgefallen sein,
wenn er den Begriff der Nation nicht biologisch-vitalistisch, sondern kulturphilo-
sophisch verstanden hätte. Es zeigt sich eben gerade hier besonders deutlich, wie
eine umfassende Ästhetik jeweils von der allgemeinen philosophischen Problematik
abhängig bleibt. Freilich kann nun dem Ästhetiker eine bestimmte Problemlösung
nicht vorgeschrieben werden; wenn aber, wie das hinsichtlich der Frage nach dem
Verstehen und Nacherleben von Sinnphänomenen der Fall ist, sich von entgegen-
gesetzten Ausgangspunkten her allmählich eine opinio communis herausbildet, so
kann diese nicht gut ohne Schaden für die Sache übersehen werden.
Heidelberg.
___________ Friedrich Kreis.
Das Problem der Seelenschönheit im Mittelalter. Eine begriffsgeschicht-
liche Untersuchung von Walter Müller, Genf. Paul Haupt, Akademische
Buchhandlung, vormals Max Drechsel, Bern 1923.
Die gründlich und fleißig gearbeitete kleine Studie ergibt als bemerkenswertes
Resultat, daß die Seelenschönheit des Mittelalters nichts ist, als der zusammenfassende
Inbegriff sämtlicher ethischer Tugenden, der vier antiken sowohl wie der drei christ-
lichen. Die ethischen Tugenden in ihrer Totalität wurden mit jenem ästhetischen Kenn-
wort charakterisiert, das etwa unserem Begriff der Vollkommenheit entspricht. Und
die Vollkommenheit ist allerdings ein nicht mehr zu überbietender, also auch ein nicht
mehr mit Fug zu verändernder, ein in sich abgeschlossener, selbstgenugsamer, ein
ästhetischer Zustand. Im Begriff der Seelenschönheit sind sämtliche ethische Forde-
rungen vorgestellt als absolut verwirklicht. Alle Verabsolutierung aber ist
immer auch Ästhetisierung.
bedeutsamen Überlegungen gehört auch der Versuch, das Ästhetische als »Anschau-
ung« oder als »Erscheinung! zu verstehen. Leider hat nun aber der Verfasser die
fruchtbaren Ansätze, die gerade in diesen Begriffen für jede Ästhetik enthalten sind,
nicht weiter verfolgt. Statt dessen geht er ohne jede Vermittlung und Begründung
dazu über, das Ästhetische als »erscheinendes Leben« einzuführen. »Dinge als
schön betrachten heißt, sie unter dem Gesichtspunkt des Lebens betrachten.« Mit
diesem Begriff des Lebens glaubt der Verfasser die Enge einer psychologischen
Qefühlstheorie überwinden zu können. Es entgeht ihm aber völlig, daß er mit
diesem Begriffe zwar nicht im Psychologischen, aber doch im bloß Vitalen stecken
bleibt. Zwar leuchtet an manchen Stellen dieses Buches die Einsicht durch, daß
die Schönheit nicht auf der Intensität, sondern auf einer bestimmten qualitativen
Höhenstufe des Lebens beruhe. Aber der Verfasser hat nirgends in Konsequenz
dieser Einsicht eine Korrektur an seinem bloß vitalen Lebensbegriff vorgenommen.
So kommt es, daß diese Ästhetik jeweils vor den eigentlich entscheidenden Fragen
und Problemen haltmacht. Denn man begreift den Sinn des Ästhetischen niemals,
solange man nicht einzusehen vermag, daß alles geistige Leben — mit Simmel zu
reden — eben mehr als Leben ist. Es würde hier zu weit führen, im einzelnen
aufzuzeigen, wie die Befangenheit in dem völlig vagen Lebensbegriff den Verfasser
unmittelbar von wesentlichen Einsichten zurückgehalten hat. Nur zwei Punkte seien
noch erwähnt. Die Ausführungen über das Nacherleben des Ästhetischen (S. 55 ff.)
würden eine ganz andere Bedeutung gewonnen haben, wenn der Verfasser der
Diskussion dieser Probleme durch Jaspers, Spranger und Rickert entnommen hätte,
daß das Nacherleben einen verständlichen Sinnzusammenhang voraus-
setzt, der als solcher jenseits alles bloß biologischen Lebens liegt. Auch die Aus-
führungen des Verfassers zu der Frage der nationalen Bedingtheit und der inter-
nationalen Geltung der Kunst würden wahrscheinlich völlig anders ausgefallen sein,
wenn er den Begriff der Nation nicht biologisch-vitalistisch, sondern kulturphilo-
sophisch verstanden hätte. Es zeigt sich eben gerade hier besonders deutlich, wie
eine umfassende Ästhetik jeweils von der allgemeinen philosophischen Problematik
abhängig bleibt. Freilich kann nun dem Ästhetiker eine bestimmte Problemlösung
nicht vorgeschrieben werden; wenn aber, wie das hinsichtlich der Frage nach dem
Verstehen und Nacherleben von Sinnphänomenen der Fall ist, sich von entgegen-
gesetzten Ausgangspunkten her allmählich eine opinio communis herausbildet, so
kann diese nicht gut ohne Schaden für die Sache übersehen werden.
Heidelberg.
___________ Friedrich Kreis.
Das Problem der Seelenschönheit im Mittelalter. Eine begriffsgeschicht-
liche Untersuchung von Walter Müller, Genf. Paul Haupt, Akademische
Buchhandlung, vormals Max Drechsel, Bern 1923.
Die gründlich und fleißig gearbeitete kleine Studie ergibt als bemerkenswertes
Resultat, daß die Seelenschönheit des Mittelalters nichts ist, als der zusammenfassende
Inbegriff sämtlicher ethischer Tugenden, der vier antiken sowohl wie der drei christ-
lichen. Die ethischen Tugenden in ihrer Totalität wurden mit jenem ästhetischen Kenn-
wort charakterisiert, das etwa unserem Begriff der Vollkommenheit entspricht. Und
die Vollkommenheit ist allerdings ein nicht mehr zu überbietender, also auch ein nicht
mehr mit Fug zu verändernder, ein in sich abgeschlossener, selbstgenugsamer, ein
ästhetischer Zustand. Im Begriff der Seelenschönheit sind sämtliche ethische Forde-
rungen vorgestellt als absolut verwirklicht. Alle Verabsolutierung aber ist
immer auch Ästhetisierung.