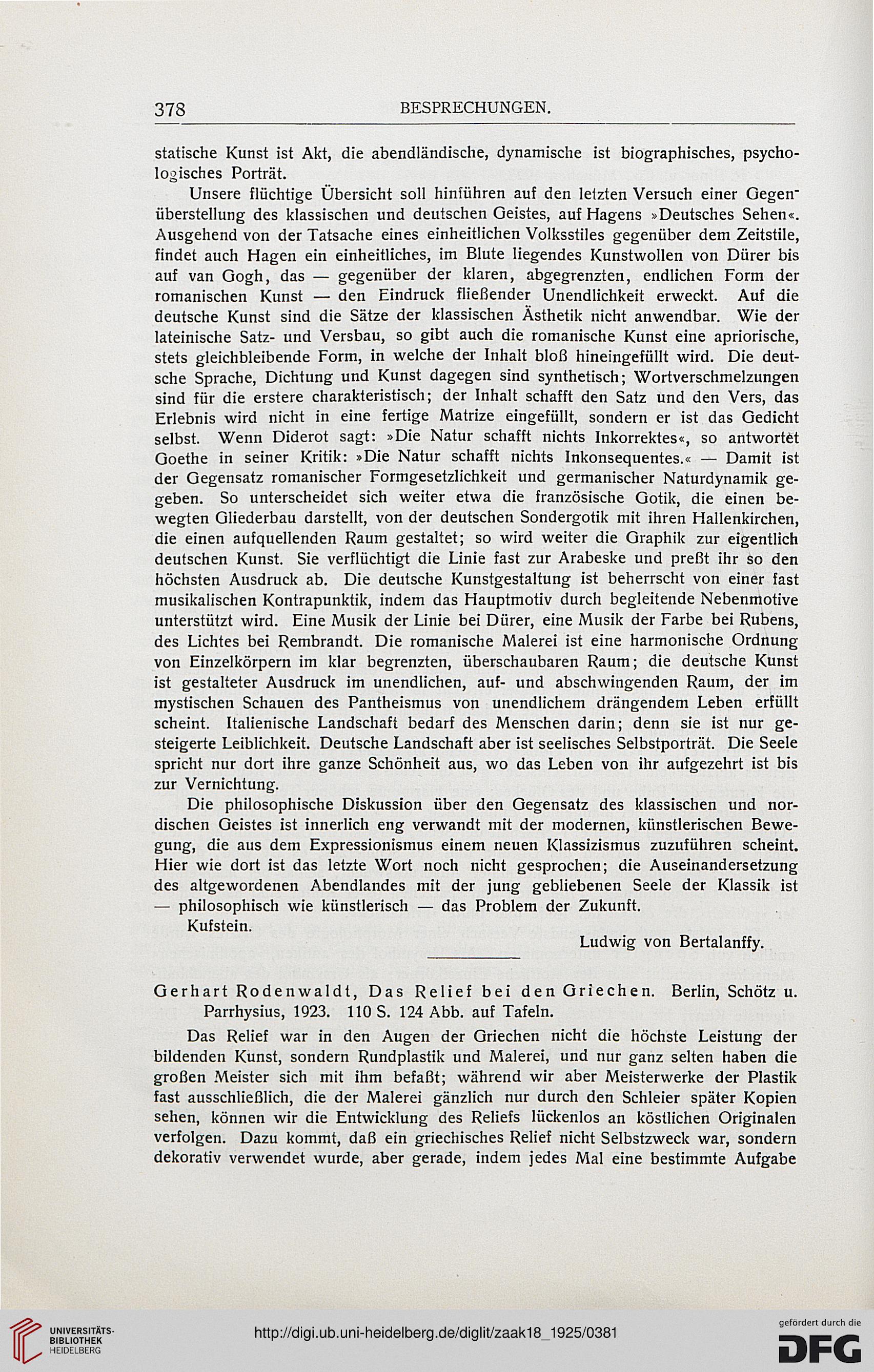378 BESPRECHUNGEN.
statische Kunst ist Akt, die abendländische, dynamische ist biographisches, psycho-
logisches Porträt.
Unsere flüchtige Übersicht soll hinführen auf den letzten Versuch einer Gegen"
überstellung des klassischen und deutschen Geistes, auf Hagens »Deutsches Sehen«.
Ausgehend von der Tatsache eines einheitlichen Volksstiles gegenüber dem Zeitstile,
findet auch Hagen ein einheitliches, im Blute liegendes Kunstwollen von Dürer bis
auf van Gogh, das — gegenüber der klaren, abgegrenzten, endlichen Form der
romanischen Kunst — den Eindruck fließender Unendlichkeit erweckt. Auf die
deutsche Kunst sind die Sätze der klassischen Ästhetik nicht anwendbar. Wie der
lateinische Satz- und Versbau, so gibt auch die romanische Kunst eine apriorische,
stets gleichbleibende Form, in welche der Inhalt bloß hineingefüllt wird. Die deut-
sche Sprache, Dichtung und Kunst dagegen sind synthetisch; Wortverschmelzungen
sind für die erstere charakteristisch; der Inhalt schafft den Satz und den Vers, das
Erlebnis wird nicht in eine fertige Matrize eingefüllt, sondern er ist das Gedicht
selbst. Wenn Diderot sagt: »Die Natur schafft nichts Inkorrektes«, so antwortet
Goethe in seiner Kritik: »Die Natur schafft nichts Inkonsequentes.« — Damit ist
der Gegensatz romanischer Formgesetzlichkeit und germanischer Naturdynamik ge-
geben. So unterscheidet sich weiter etwa die französische Gotik, die einen be-
wegten Gliederbau darstellt, von der deutschen Sondergotik mit ihren Hallenkirchen,
die einen aufquellenden Raum gestaltet; so wird weiter die Graphik zur eigentlich
deutschen Kunst. Sie verflüchtigt die Linie fast zur Arabeske und preßt ihr so den
höchsten Ausdruck ab. Die deutsche Kunstgestaltung ist beherrscht von einer fast
musikalischen Kontrapunktik, indem das Hauptmotiv durch begleitende Nebenmotive
unterstützt wird. Eine Musik der Linie bei Dürer, eine Musik der Farbe bei Rubens,
des Lichtes bei Rembrandt. Die romanische Malerei ist eine harmonische Ordnung
von Einzelkörpern im klar begrenzten, überschaubaren Raum; die deutsche Kunst
ist gestalteter Ausdruck im unendlichen, auf- und abschwingenden Raum, der im
mystischen Schauen des Pantheismus von unendlichem drängendem Leben erfüllt
scheint. Italienische Landschaft bedarf des Menschen darin; denn sie ist nur ge-
steigerte Leiblichkeit. Deutsche Landschaft aber ist seelisches Selbstporträt. Die Seele
spricht nur dort ihre ganze Schönheit aus, wo das Leben von ihr aufgezehrt ist bis
zur Vernichtung.
Die philosophische Diskussion über den Gegensatz des klassischen und nor-
dischen Geistes ist innerlich eng verwandt mit der modernen, künstlerischen Bewe-
gung, die aus dem Expressionismus einem neuen Klassizismus zuzuführen scheint.
Hier wie dort ist das letzte Wort noch nicht gesprochen; die Auseinandersetzung
des altgewordenen Abendlandes mit der jung gebliebenen Seele der Klassik ist
— philosophisch wie künstlerisch — das Problem der Zukunft.
Kufstein.
Ludwig von Bertalanffy.
Gerhart Rodenwaldt, Das Relief bei den Griechen. Berlin, Schötz u.
Parrhysius, 1923. 110 S. 124 Abb. auf Tafeln.
Das Relief war in den Augen der Griechen nicht die höchste Leistung der
bildenden Kunst, sondern Rundplastik und Malerei, und nur ganz selten haben die
großen Meister sich mit ihm befaßt; während wir aber Meisterwerke der Plastik
fast ausschließlich, die der Malerei gänzlich nur durch den Schleier später Kopien
sehen, können wir die Entwicklung des Reliefs lückenlos an köstlichen Originalen
verfolgen. Dazu kommt, daß ein griechisches Relief nicht Selbstzweck war, sondern
dekorativ verwendet wurde, aber gerade, indem jedes Mal eine bestimmte Aufgabe
statische Kunst ist Akt, die abendländische, dynamische ist biographisches, psycho-
logisches Porträt.
Unsere flüchtige Übersicht soll hinführen auf den letzten Versuch einer Gegen"
überstellung des klassischen und deutschen Geistes, auf Hagens »Deutsches Sehen«.
Ausgehend von der Tatsache eines einheitlichen Volksstiles gegenüber dem Zeitstile,
findet auch Hagen ein einheitliches, im Blute liegendes Kunstwollen von Dürer bis
auf van Gogh, das — gegenüber der klaren, abgegrenzten, endlichen Form der
romanischen Kunst — den Eindruck fließender Unendlichkeit erweckt. Auf die
deutsche Kunst sind die Sätze der klassischen Ästhetik nicht anwendbar. Wie der
lateinische Satz- und Versbau, so gibt auch die romanische Kunst eine apriorische,
stets gleichbleibende Form, in welche der Inhalt bloß hineingefüllt wird. Die deut-
sche Sprache, Dichtung und Kunst dagegen sind synthetisch; Wortverschmelzungen
sind für die erstere charakteristisch; der Inhalt schafft den Satz und den Vers, das
Erlebnis wird nicht in eine fertige Matrize eingefüllt, sondern er ist das Gedicht
selbst. Wenn Diderot sagt: »Die Natur schafft nichts Inkorrektes«, so antwortet
Goethe in seiner Kritik: »Die Natur schafft nichts Inkonsequentes.« — Damit ist
der Gegensatz romanischer Formgesetzlichkeit und germanischer Naturdynamik ge-
geben. So unterscheidet sich weiter etwa die französische Gotik, die einen be-
wegten Gliederbau darstellt, von der deutschen Sondergotik mit ihren Hallenkirchen,
die einen aufquellenden Raum gestaltet; so wird weiter die Graphik zur eigentlich
deutschen Kunst. Sie verflüchtigt die Linie fast zur Arabeske und preßt ihr so den
höchsten Ausdruck ab. Die deutsche Kunstgestaltung ist beherrscht von einer fast
musikalischen Kontrapunktik, indem das Hauptmotiv durch begleitende Nebenmotive
unterstützt wird. Eine Musik der Linie bei Dürer, eine Musik der Farbe bei Rubens,
des Lichtes bei Rembrandt. Die romanische Malerei ist eine harmonische Ordnung
von Einzelkörpern im klar begrenzten, überschaubaren Raum; die deutsche Kunst
ist gestalteter Ausdruck im unendlichen, auf- und abschwingenden Raum, der im
mystischen Schauen des Pantheismus von unendlichem drängendem Leben erfüllt
scheint. Italienische Landschaft bedarf des Menschen darin; denn sie ist nur ge-
steigerte Leiblichkeit. Deutsche Landschaft aber ist seelisches Selbstporträt. Die Seele
spricht nur dort ihre ganze Schönheit aus, wo das Leben von ihr aufgezehrt ist bis
zur Vernichtung.
Die philosophische Diskussion über den Gegensatz des klassischen und nor-
dischen Geistes ist innerlich eng verwandt mit der modernen, künstlerischen Bewe-
gung, die aus dem Expressionismus einem neuen Klassizismus zuzuführen scheint.
Hier wie dort ist das letzte Wort noch nicht gesprochen; die Auseinandersetzung
des altgewordenen Abendlandes mit der jung gebliebenen Seele der Klassik ist
— philosophisch wie künstlerisch — das Problem der Zukunft.
Kufstein.
Ludwig von Bertalanffy.
Gerhart Rodenwaldt, Das Relief bei den Griechen. Berlin, Schötz u.
Parrhysius, 1923. 110 S. 124 Abb. auf Tafeln.
Das Relief war in den Augen der Griechen nicht die höchste Leistung der
bildenden Kunst, sondern Rundplastik und Malerei, und nur ganz selten haben die
großen Meister sich mit ihm befaßt; während wir aber Meisterwerke der Plastik
fast ausschließlich, die der Malerei gänzlich nur durch den Schleier später Kopien
sehen, können wir die Entwicklung des Reliefs lückenlos an köstlichen Originalen
verfolgen. Dazu kommt, daß ein griechisches Relief nicht Selbstzweck war, sondern
dekorativ verwendet wurde, aber gerade, indem jedes Mal eine bestimmte Aufgabe