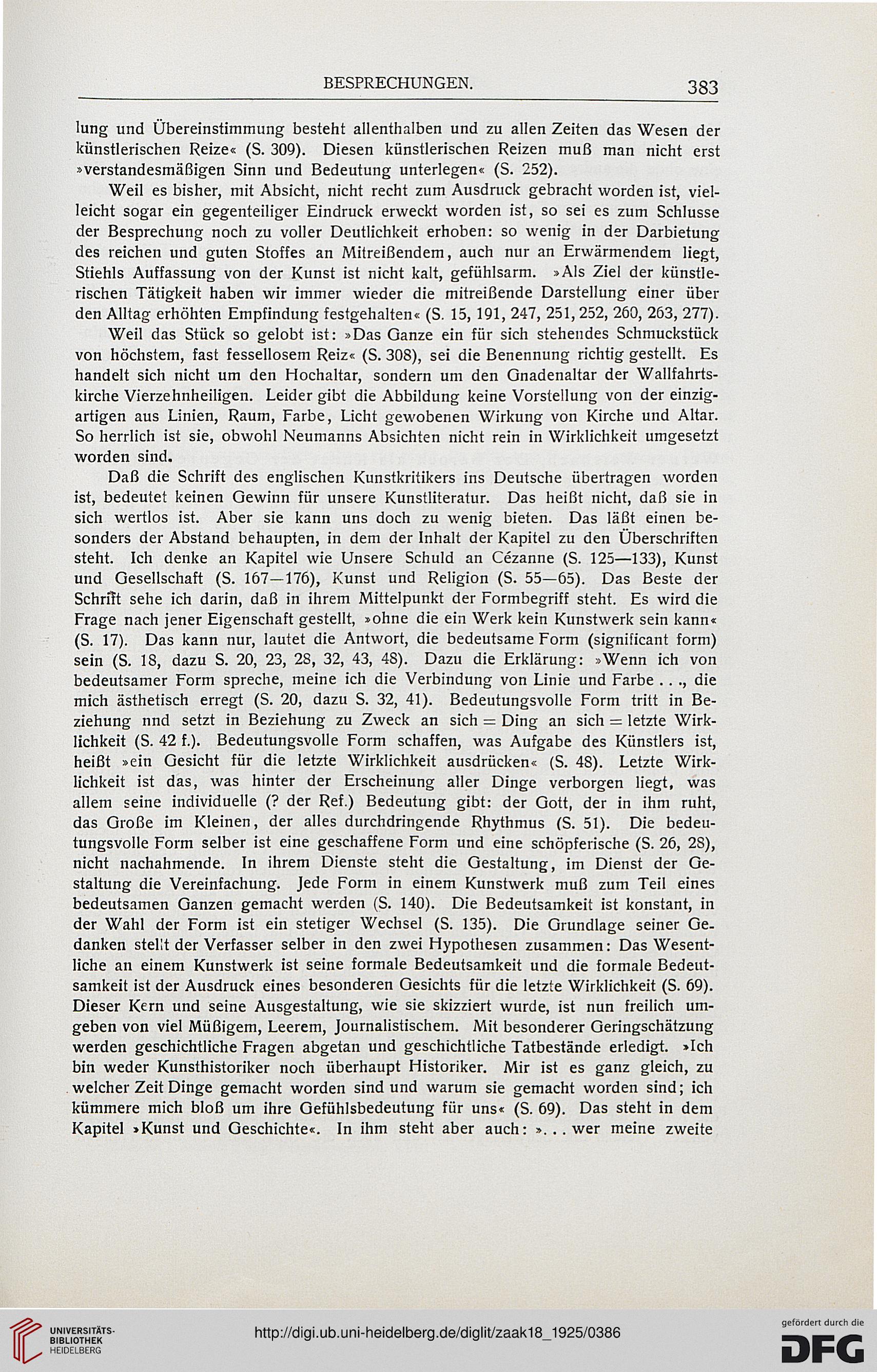BESPRECHUNGEN. 333
lung und Übereinstimmung besteht allenthalben und zu allen Zeiten das Wesen der
künstlerischen Reize« (S. 309). Diesen künstlerischen Reizen muß man nicht erst
»verstandesmäßigen Sinn und Bedeutung unterlegen« (S. 252).
Weil es bisher, mit Absicht, nicht recht zum Ausdruck gebracht worden ist, viel-
leicht sogar ein gegenteiliger Eindruck erweckt worden ist, so sei es zum Schlüsse
der Besprechung noch zu voller Deutlichkeit erhoben: so wenig in der Darbietung
des reichen und guten Stoffes an Mitreißendem, auch nur an Erwärmendem liegt,
Stiehls Auffassung von der Kunst ist nicht kalt, gefühlsarm. »Als Ziel der künstle-
rischen Tätigkeit haben wir immer wieder die mitreißende Darstellung einer über
den Alltag erhöhten Empfindung festgehalten« (S. 15, 191, 247, 251, 252, 260, 263, 277).
Weil das Stück so gelobt ist: »Das Ganze ein für sich stehendes Schmuckstück
von höchstem, fast fessellosem Reiz« (S. 308), sei die Benennung richtig gestellt. Es
handelt sich nicht um den Hochaltar, sondern um den Gnadenaltar der Wallfahrts-
kirche Vierzehnheiligen. Leider gibt die Abbildung keine Vorstellung von der einzig-
artigen aus Linien, Raum, Farbe, Licht gewobenen Wirkung von Kirche und Altar.
So herrlich ist sie, obwohl Neumanns Absichten nicht rein in Wirklichkeit umgesetzt
worden sind.
Daß die Schrift des englischen Kunstkritikers ins Deutsche übertragen worden
ist, bedeutet keinen Gewinn für unsere Kunstliteratur. Das heißt nicht, daß sie in
sich wertlos ist. Aber sie kann uns doch zu wenig bieten. Das läßt einen be-
sonders der Abstand behaupten, in dem der Inhalt der Kapitel zu den Überschriften
steht. Ich denke an Kapitel wie Unsere Schuld an Cezanne (S. 125—133), Kunst
und Gesellschaft (S. 167—176), Kunst und Religion (S. 55—65). Das Beste der
SchriTt sehe ich darin, daß in ihrem Mittelpunkt der Formbegriff steht. Es wird die
Frage nach jener Eigenschaft gestellt, »ohne die ein Werk kein Kunstwerk sein kann«
(S. 17). Das kann nur, lautet die Antwort, die bedeutsame Form (significant form)
sein (S. 18, dazu S. 20, 23, 28, 32, 43, 48). Dazu die Erklärung: »Wenn ich von
bedeutsamer Form spreche, meine ich die Verbindung von Linie und Farbe . . ., die
mich ästhetisch erregt (S. 20, dazu S. 32, 41). Bedeutungsvolle Form tritt in Be-
ziehung und setzt in Beziehung zu Zweck an sich = Ding an sich = letzte Wirk-
lichkeit (S. 42 f.). Bedeutungsvolle Form schaffen, was Aufgabe des Künstlers ist,
heißt »ein Gesicht für die letzte Wirklichkeit ausdrücken« (S. 48). Letzte Wirk-
lichkeit ist das, was hinter der Erscheinung aller Dinge verborgen liegt, was
allem seine individuelle (? der Ref.) Bedeutung gibt: der Gott, der in ihm ruht,
das Große im Kleinen, der alles durchdringende Rhythmus (S. 51). Die bedeu-
tungsvolle Form selber ist eine geschaffene Form und eine schöpferische (S. 26, 2S),
nicht nachahmende. In ihrem Dienste steht die Gestaltung, im Dienst der Ge-
staltung die Vereinfachung. Jede Form in einem Kunstwerk muß zum Teil eines
bedeutsamen Ganzen gemacht werden (S. 140). Die Bedeutsamkeit ist konstant, in
der Wahl der Form ist ein stetiger Wechsel (S. 135). Die Grundlage seiner Ge-
danken stellt der Verfasser selber in den zwei Hypothesen zusammen: Das Wesent-
liche an einem Kunstwerk ist seine formale Bedeutsamkeit und die formale Bedeut-
samkeit ist der Ausdruck eines besonderen Gesichts für die letzte Wirklichkeit (S. 69).
Dieser Kern und seine Ausgestaltung, wie sie skizziert wurde, ist nun freilich um-
geben von viel Müßigem, Leerem, Journalistischem. Mit besonderer Geringschätzung
werden geschichtliche Fragen abgetan und geschichtliche Tatbestände erledigt. »Ich
bin weder Kunsthistoriker noch überhaupt Historiker. Mir ist es ganz gleich, zu
welcher Zeit Dinge gemacht worden sind und warum sie gemacht worden sind; ich
kümmere mich bloß um ihre Gefühlsbedeutung für uns« (S. 69). Das steht in dem
Kapitel »Kunst und Geschichte«. In ihm steht aber auch: »...wer meine zweite
lung und Übereinstimmung besteht allenthalben und zu allen Zeiten das Wesen der
künstlerischen Reize« (S. 309). Diesen künstlerischen Reizen muß man nicht erst
»verstandesmäßigen Sinn und Bedeutung unterlegen« (S. 252).
Weil es bisher, mit Absicht, nicht recht zum Ausdruck gebracht worden ist, viel-
leicht sogar ein gegenteiliger Eindruck erweckt worden ist, so sei es zum Schlüsse
der Besprechung noch zu voller Deutlichkeit erhoben: so wenig in der Darbietung
des reichen und guten Stoffes an Mitreißendem, auch nur an Erwärmendem liegt,
Stiehls Auffassung von der Kunst ist nicht kalt, gefühlsarm. »Als Ziel der künstle-
rischen Tätigkeit haben wir immer wieder die mitreißende Darstellung einer über
den Alltag erhöhten Empfindung festgehalten« (S. 15, 191, 247, 251, 252, 260, 263, 277).
Weil das Stück so gelobt ist: »Das Ganze ein für sich stehendes Schmuckstück
von höchstem, fast fessellosem Reiz« (S. 308), sei die Benennung richtig gestellt. Es
handelt sich nicht um den Hochaltar, sondern um den Gnadenaltar der Wallfahrts-
kirche Vierzehnheiligen. Leider gibt die Abbildung keine Vorstellung von der einzig-
artigen aus Linien, Raum, Farbe, Licht gewobenen Wirkung von Kirche und Altar.
So herrlich ist sie, obwohl Neumanns Absichten nicht rein in Wirklichkeit umgesetzt
worden sind.
Daß die Schrift des englischen Kunstkritikers ins Deutsche übertragen worden
ist, bedeutet keinen Gewinn für unsere Kunstliteratur. Das heißt nicht, daß sie in
sich wertlos ist. Aber sie kann uns doch zu wenig bieten. Das läßt einen be-
sonders der Abstand behaupten, in dem der Inhalt der Kapitel zu den Überschriften
steht. Ich denke an Kapitel wie Unsere Schuld an Cezanne (S. 125—133), Kunst
und Gesellschaft (S. 167—176), Kunst und Religion (S. 55—65). Das Beste der
SchriTt sehe ich darin, daß in ihrem Mittelpunkt der Formbegriff steht. Es wird die
Frage nach jener Eigenschaft gestellt, »ohne die ein Werk kein Kunstwerk sein kann«
(S. 17). Das kann nur, lautet die Antwort, die bedeutsame Form (significant form)
sein (S. 18, dazu S. 20, 23, 28, 32, 43, 48). Dazu die Erklärung: »Wenn ich von
bedeutsamer Form spreche, meine ich die Verbindung von Linie und Farbe . . ., die
mich ästhetisch erregt (S. 20, dazu S. 32, 41). Bedeutungsvolle Form tritt in Be-
ziehung und setzt in Beziehung zu Zweck an sich = Ding an sich = letzte Wirk-
lichkeit (S. 42 f.). Bedeutungsvolle Form schaffen, was Aufgabe des Künstlers ist,
heißt »ein Gesicht für die letzte Wirklichkeit ausdrücken« (S. 48). Letzte Wirk-
lichkeit ist das, was hinter der Erscheinung aller Dinge verborgen liegt, was
allem seine individuelle (? der Ref.) Bedeutung gibt: der Gott, der in ihm ruht,
das Große im Kleinen, der alles durchdringende Rhythmus (S. 51). Die bedeu-
tungsvolle Form selber ist eine geschaffene Form und eine schöpferische (S. 26, 2S),
nicht nachahmende. In ihrem Dienste steht die Gestaltung, im Dienst der Ge-
staltung die Vereinfachung. Jede Form in einem Kunstwerk muß zum Teil eines
bedeutsamen Ganzen gemacht werden (S. 140). Die Bedeutsamkeit ist konstant, in
der Wahl der Form ist ein stetiger Wechsel (S. 135). Die Grundlage seiner Ge-
danken stellt der Verfasser selber in den zwei Hypothesen zusammen: Das Wesent-
liche an einem Kunstwerk ist seine formale Bedeutsamkeit und die formale Bedeut-
samkeit ist der Ausdruck eines besonderen Gesichts für die letzte Wirklichkeit (S. 69).
Dieser Kern und seine Ausgestaltung, wie sie skizziert wurde, ist nun freilich um-
geben von viel Müßigem, Leerem, Journalistischem. Mit besonderer Geringschätzung
werden geschichtliche Fragen abgetan und geschichtliche Tatbestände erledigt. »Ich
bin weder Kunsthistoriker noch überhaupt Historiker. Mir ist es ganz gleich, zu
welcher Zeit Dinge gemacht worden sind und warum sie gemacht worden sind; ich
kümmere mich bloß um ihre Gefühlsbedeutung für uns« (S. 69). Das steht in dem
Kapitel »Kunst und Geschichte«. In ihm steht aber auch: »...wer meine zweite