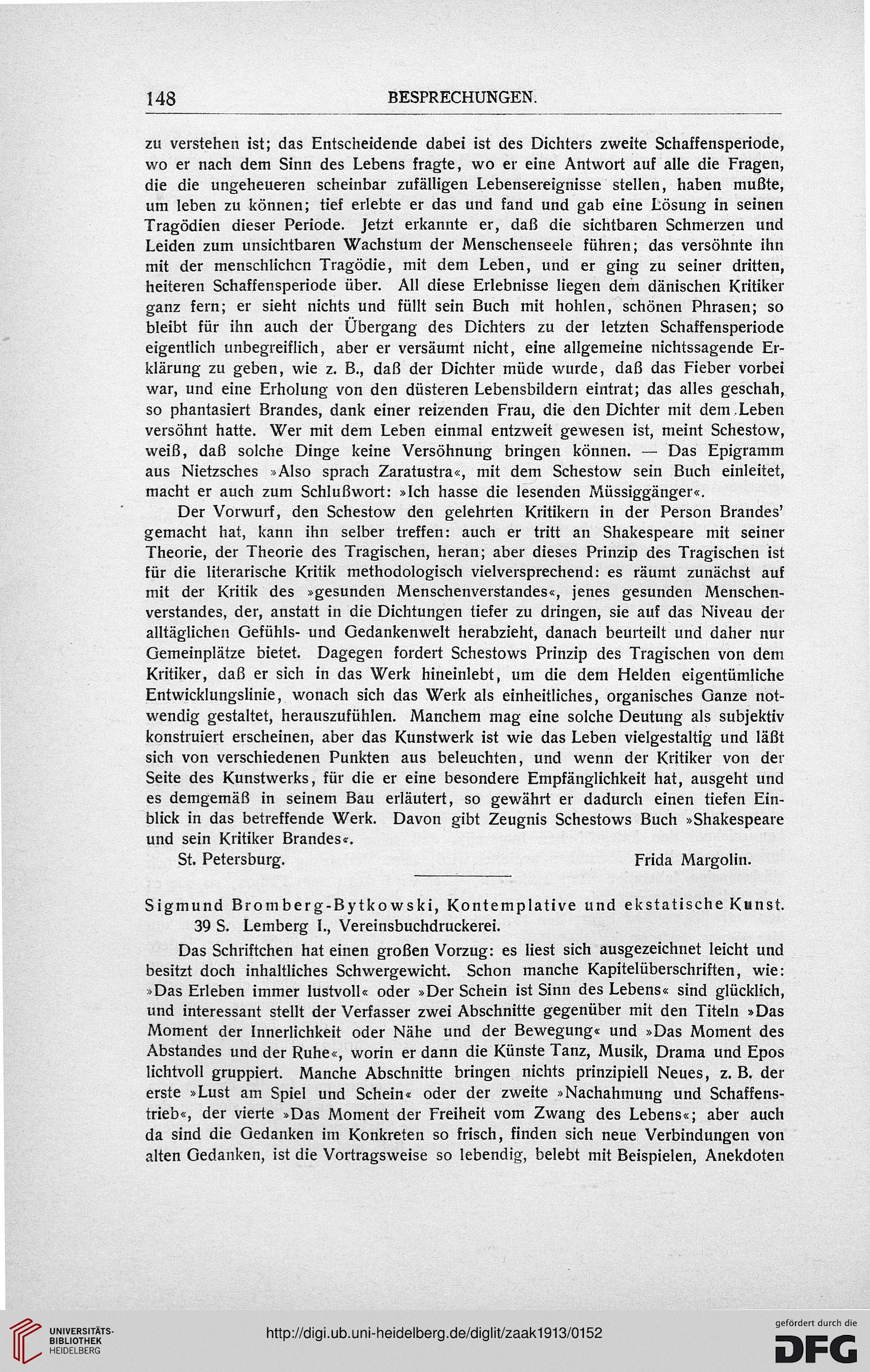148 BESPRECHUNGEN.
zu verstehen ist; das Entscheidende dabei ist des Dichters zweite Schaffensperiode,
wo er nach dem Sinn des Lebens fragte, wo er eine Antwort auf alle die Fragen,
die die ungeheueren scheinbar zufälligen Lebensereignisse stellen, haben mußte,
um leben zu können; tief erlebte er das und fand und gab eine Lösung in seinen
Tragödien dieser Periode. Jetzt erkannte er, daß die sichtbaren Schmerzen und
Leiden zum unsichtbaren Wachstum der Menschenseele führen; das versöhnte ihn
mit der menschlichen Tragödie, mit dem Leben, und er ging zu seiner dritten,
heiteren Schaffensperiode über. All diese Erlebnisse liegen dem dänischen Kritiker
ganz fern; er sieht nichts und füllt sein Buch mit hohlen, schönen Phrasen; so
bleibt für ihn auch der Übergang des Dichters zu der letzten Schaffensperiode
eigentlich unbegreiflich, aber er versäumt nicht, eine allgemeine nichtssagende Er-
klärung zu geben, wie z. B., daß der Dichter müde wurde, daß das Fieber vorbei
war, und eine Erholung von den düsteren Lebensbildern eintrat; das alles geschah,
so phantasiert Brandes, dank einer reizenden Frau, die den Dichter mit dem.Leben
versöhnt hatte. Wer mit dem Leben einmal entzweit gewesen ist, meint Schestow,
weiß, daß solche Dinge keine Versöhnung bringen können. — Das Epigramm
aus Nietzsches »Also sprach Zaratustra«, mit dem Schestow sein Buch einleitet,
macht er auch zum Schlußwort: »Ich hasse die lesenden Müssiggänger«.
Der Vorwurf, den Schestow den gelehrten Kritikern in der Person Brandes'
gemacht hat, kann ihn selber treffen: auch er tritt an Shakespeare mit seiner
Theorie, der Theorie des Tragischen, heran; aber dieses Prinzip des Tragischen ist
für die literarische Kritik methodologisch vielversprechend: es räumt zunächst auf
mit der Kritik des »gesunden Menschenverstandes«, jenes gesunden Menschen-
verstandes, der, anstatt in die Dichtungen tiefer zu dringen, sie auf das Niveau der
alltäglichen Gefühls- und Gedankenwelt herabzieht, danach beurteilt und daher nur
Gemeinplätze bietet. Dagegen fordert Schestows Prinzip des Tragischen von dem
Kritiker, daß er sich in das Werk hineinlebt, um die dem Helden eigentümliche
Entwicklungslinie, wonach sich das Werk als einheitliches, organisches Ganze not-
wendig gestaltet, herauszufühlen. Manchem mag eine solche Deutung als subjektiv
konstruiert erscheinen, aber das Kunstwerk ist wie das Leben vielgestaltig und läßt
sich von verschiedenen Punkten aus beleuchten, und wenn der Kritiker von der
Seite des Kunstwerks, für die er eine besondere Empfänglichkeit hat, ausgeht und
es demgemäß in seinem Bau erläutert, so gewährt er dadurch einen tiefen Ein-
blick in das betreffende Werk. Davon gibt Zeugnis Schestows Buch »Shakespeare
und sein Kritiker Brandes*.
St. Petersburg. Frida Margolin.
Sigmund Bromberg-Bytkowski, Kontemplative und ekstatische Kunst.
39 S. Lemberg I., Vereinsbuchdruckerei.
Das Schriftchen hat einen großen Vorzug: es liest sich ausgezeichnet leicht und
besitzt doch inhaltliches Schwergewicht. Schon manche Kapitelüberschriften, wie:
»Das Erleben immer lustvoll« oder »Der Schein ist Sinn des Lebens« sind glücklich,
und interessant stellt der Verfasser zwei Abschnitte gegenüber mit den Titeln »Das
Moment der Innerlichkeit oder Nähe und der Bewegung« und »Das Moment des
Abstandes und der Ruhe«, worin er dann die Künste Tanz, Musik, Drama und Epos
lichtvoll gruppiert. Manche Abschnitte bringen nichts prinzipiell Neues, z. B. der
erste »Lust am Spiel und Schein« oder der zweite »Nachahmung und Schaffens-
trieb«, der vierte »Das Moment der Freiheit vom Zwang des Lebens«; aber auch
da sind die Gedanken im Konkreten so frisch, finden sich neue Verbindungen von
alten Gedanken, ist die Vortragsweise so lebendig, belebt mit Beispielen, Anekdoten
zu verstehen ist; das Entscheidende dabei ist des Dichters zweite Schaffensperiode,
wo er nach dem Sinn des Lebens fragte, wo er eine Antwort auf alle die Fragen,
die die ungeheueren scheinbar zufälligen Lebensereignisse stellen, haben mußte,
um leben zu können; tief erlebte er das und fand und gab eine Lösung in seinen
Tragödien dieser Periode. Jetzt erkannte er, daß die sichtbaren Schmerzen und
Leiden zum unsichtbaren Wachstum der Menschenseele führen; das versöhnte ihn
mit der menschlichen Tragödie, mit dem Leben, und er ging zu seiner dritten,
heiteren Schaffensperiode über. All diese Erlebnisse liegen dem dänischen Kritiker
ganz fern; er sieht nichts und füllt sein Buch mit hohlen, schönen Phrasen; so
bleibt für ihn auch der Übergang des Dichters zu der letzten Schaffensperiode
eigentlich unbegreiflich, aber er versäumt nicht, eine allgemeine nichtssagende Er-
klärung zu geben, wie z. B., daß der Dichter müde wurde, daß das Fieber vorbei
war, und eine Erholung von den düsteren Lebensbildern eintrat; das alles geschah,
so phantasiert Brandes, dank einer reizenden Frau, die den Dichter mit dem.Leben
versöhnt hatte. Wer mit dem Leben einmal entzweit gewesen ist, meint Schestow,
weiß, daß solche Dinge keine Versöhnung bringen können. — Das Epigramm
aus Nietzsches »Also sprach Zaratustra«, mit dem Schestow sein Buch einleitet,
macht er auch zum Schlußwort: »Ich hasse die lesenden Müssiggänger«.
Der Vorwurf, den Schestow den gelehrten Kritikern in der Person Brandes'
gemacht hat, kann ihn selber treffen: auch er tritt an Shakespeare mit seiner
Theorie, der Theorie des Tragischen, heran; aber dieses Prinzip des Tragischen ist
für die literarische Kritik methodologisch vielversprechend: es räumt zunächst auf
mit der Kritik des »gesunden Menschenverstandes«, jenes gesunden Menschen-
verstandes, der, anstatt in die Dichtungen tiefer zu dringen, sie auf das Niveau der
alltäglichen Gefühls- und Gedankenwelt herabzieht, danach beurteilt und daher nur
Gemeinplätze bietet. Dagegen fordert Schestows Prinzip des Tragischen von dem
Kritiker, daß er sich in das Werk hineinlebt, um die dem Helden eigentümliche
Entwicklungslinie, wonach sich das Werk als einheitliches, organisches Ganze not-
wendig gestaltet, herauszufühlen. Manchem mag eine solche Deutung als subjektiv
konstruiert erscheinen, aber das Kunstwerk ist wie das Leben vielgestaltig und läßt
sich von verschiedenen Punkten aus beleuchten, und wenn der Kritiker von der
Seite des Kunstwerks, für die er eine besondere Empfänglichkeit hat, ausgeht und
es demgemäß in seinem Bau erläutert, so gewährt er dadurch einen tiefen Ein-
blick in das betreffende Werk. Davon gibt Zeugnis Schestows Buch »Shakespeare
und sein Kritiker Brandes*.
St. Petersburg. Frida Margolin.
Sigmund Bromberg-Bytkowski, Kontemplative und ekstatische Kunst.
39 S. Lemberg I., Vereinsbuchdruckerei.
Das Schriftchen hat einen großen Vorzug: es liest sich ausgezeichnet leicht und
besitzt doch inhaltliches Schwergewicht. Schon manche Kapitelüberschriften, wie:
»Das Erleben immer lustvoll« oder »Der Schein ist Sinn des Lebens« sind glücklich,
und interessant stellt der Verfasser zwei Abschnitte gegenüber mit den Titeln »Das
Moment der Innerlichkeit oder Nähe und der Bewegung« und »Das Moment des
Abstandes und der Ruhe«, worin er dann die Künste Tanz, Musik, Drama und Epos
lichtvoll gruppiert. Manche Abschnitte bringen nichts prinzipiell Neues, z. B. der
erste »Lust am Spiel und Schein« oder der zweite »Nachahmung und Schaffens-
trieb«, der vierte »Das Moment der Freiheit vom Zwang des Lebens«; aber auch
da sind die Gedanken im Konkreten so frisch, finden sich neue Verbindungen von
alten Gedanken, ist die Vortragsweise so lebendig, belebt mit Beispielen, Anekdoten