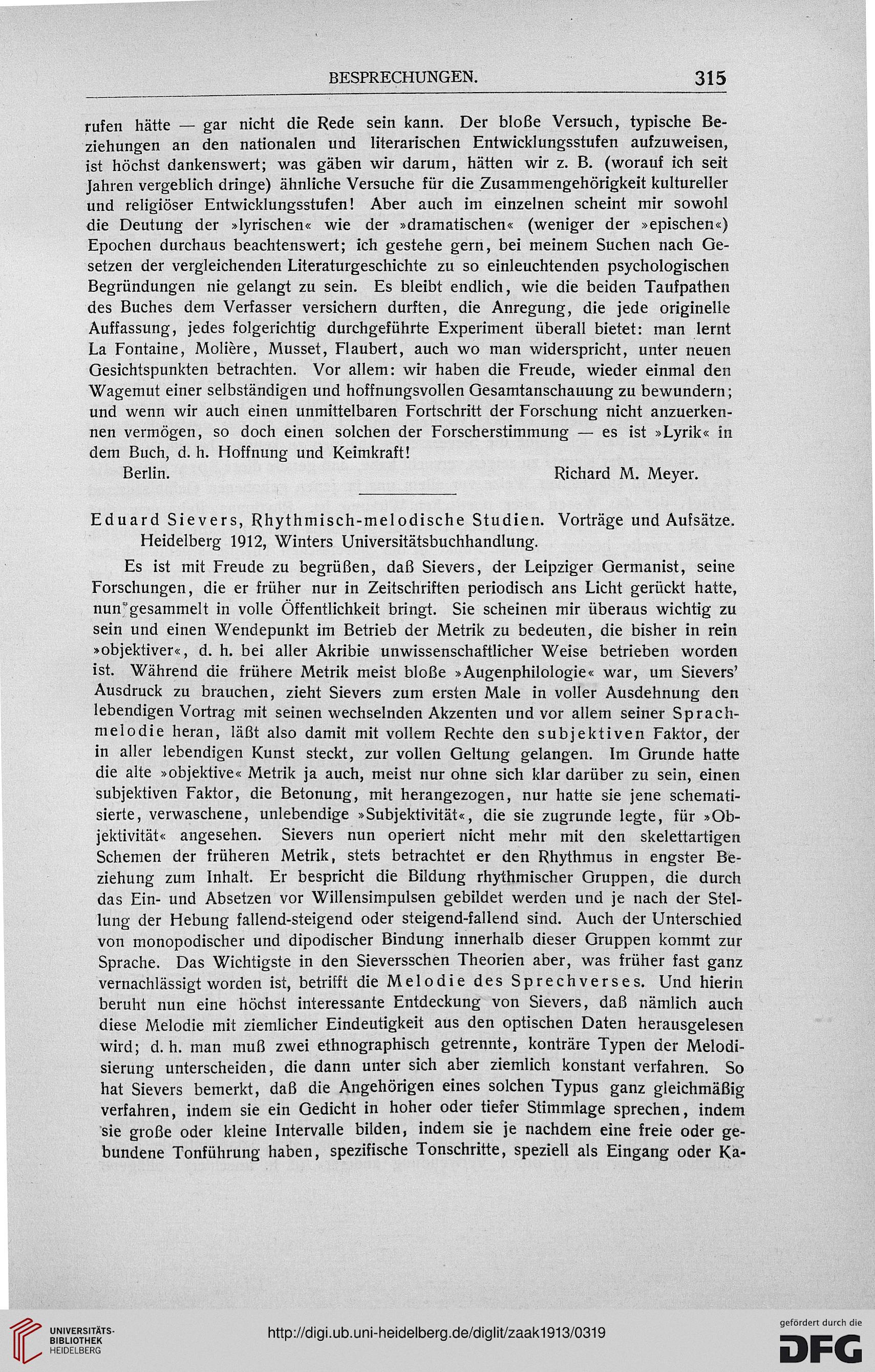BESPRECHUNGEN. 315
rufen hätte — gar nicht die Rede sein kann. Der bloße Versuch, typische Be-
ziehungen an den nationalen und literarischen Entwicklungsstufen aufzuweisen,
ist höchst dankenswert; was gäben wir darum, hätten wir z. B. (worauf ich seit
Jahren vergeblich dringe) ähnliche Versuche für die Zusammengehörigkeit kultureller
und religiöser Entwicklungsstufen! Aber auch im einzelnen scheint mir sowohl
die Deutung der »lyrischen« wie der »dramatischen« (weniger der »epischen«)
Epochen durchaus beachtenswert; ich gestehe gern, bei meinem Suchen nach Ge-
setzen der vergleichenden Literaturgeschichte zu so einleuchtenden psychologischen
Begründungen nie gelangt zu sein. Es bleibt endlich, wie die beiden Taufpathen
des Buches dem Verfasser versichern durften, die Anregung, die jede originelle
Auffassung, jedes folgerichtig durchgeführte Experiment überall bietet: man lernt
La Fontaine, Moliere, Musset, Flaubert, auch wo man widerspricht, unter neuen
Gesichtspunkten betrachten. Vor allem: wir haben die Freude, wieder einmal den
Wagemut einer selbständigen und hoffnungsvollen Gesamtanschauung zu bewundern;
und wenn wir auch einen unmittelbaren Fortschritt der Forschung nicht anzuerken-
nen vermögen, so doch einen solchen der Forscherstimmung — es ist »Lyrik« in
dem Buch, d. h. Hoffnung und Keimkraft!
Berlin. Richard M. Meyer.
Eduard Sievers, Rhythmisch-melodische Studien. Vorträge und Aufsätze.
Heidelberg 1912, Winters Universitätsbuchhandlung.
Es ist mit Freude zu begrüßen, daß Sievers, der Leipziger Germanist, seine
Forschungen, die er früher nur in Zeitschriften periodisch ans Licht gerückt hatte,
nun"gesammelt in volle Öffentlichkeit bringt. Sie scheinen mir überaus wichtig zu
sein und einen Wendepunkt im Betrieb der Metrik zu bedeuten, die bisher in rein
»objektiver«, d. h. bei aller Akribie unwissenschaftlicher Weise betrieben worden
ist. Während die frühere Metrik meist bloße »Augenphilologie« war, um Sievers'
Ausdruck zu brauchen, zieht Sievers zum ersten Male in voller Ausdehnung den
lebendigen Vortrag mit seinen wechselnden Akzenten und vor allem seiner Sprach-
melodie heran, läßt also damit mit vollem Rechte den subjektiven Faktor, der
in aller lebendigen Kunst steckt, zur vollen Geltung gelangen. Im Grunde hatte
die alte »objektive« Metrik ja auch, meist nur ohne sich klar darüber zu sein, einen
subjektiven Faktor, die Betonung, mit herangezogen, nur hatte sie jene schemati-
sierte, verwaschene, unlebendige »Subjektivität«, die sie zugrunde legte, für »Ob-
jektivität« angesehen. Sievers nun operiert nicht mehr mit den skelettartigen
Schemen der früheren Metrik, stets betrachtet er den Rhythmus in engster Be-
ziehung zum Inhalt. Er bespricht die Bildung rhythmischer Gruppen, die durch
das Ein- und Absetzen vor Willensimpulsen gebildet werden und je nach der Stel-
lung der Hebung fallend-steigend oder steigend-fallend sind. Auch der Unterschied
von monopodischer und dipodischer Bindung innerhalb dieser Gruppen kommt zur
Sprache. Das Wichtigste in den Sieversschen Theorien aber, was früher fast ganz
vernachlässigt worden ist, betrifft die Melodie des Sprechverses. Und hierin
beruht nun eine höchst interessante Entdeckung von Sievers, daß nämlich auch
diese Melodie mit ziemlicher Eindeutigkeit aus den optischen Daten herausgelesen
wird; d.h. man muß zwei ethnographisch getrennte, konträre Typen der Melodi-
sierung unterscheiden, die dann unter sich aber ziemlich konstant verfahren. So
hat Sievers bemerkt, daß die Angehörigen eines solchen Typus ganz gleichmäßig
verfahren, indem sie ein Gedicht in hoher oder tiefer Stimmlage sprechen, indem
sie große oder kleine Intervalle bilden, indem sie je nachdem eine freie oder ge-
bundene Tonführung haben, spezifische Tonschritte, speziell als Eingang oder Ka-
rufen hätte — gar nicht die Rede sein kann. Der bloße Versuch, typische Be-
ziehungen an den nationalen und literarischen Entwicklungsstufen aufzuweisen,
ist höchst dankenswert; was gäben wir darum, hätten wir z. B. (worauf ich seit
Jahren vergeblich dringe) ähnliche Versuche für die Zusammengehörigkeit kultureller
und religiöser Entwicklungsstufen! Aber auch im einzelnen scheint mir sowohl
die Deutung der »lyrischen« wie der »dramatischen« (weniger der »epischen«)
Epochen durchaus beachtenswert; ich gestehe gern, bei meinem Suchen nach Ge-
setzen der vergleichenden Literaturgeschichte zu so einleuchtenden psychologischen
Begründungen nie gelangt zu sein. Es bleibt endlich, wie die beiden Taufpathen
des Buches dem Verfasser versichern durften, die Anregung, die jede originelle
Auffassung, jedes folgerichtig durchgeführte Experiment überall bietet: man lernt
La Fontaine, Moliere, Musset, Flaubert, auch wo man widerspricht, unter neuen
Gesichtspunkten betrachten. Vor allem: wir haben die Freude, wieder einmal den
Wagemut einer selbständigen und hoffnungsvollen Gesamtanschauung zu bewundern;
und wenn wir auch einen unmittelbaren Fortschritt der Forschung nicht anzuerken-
nen vermögen, so doch einen solchen der Forscherstimmung — es ist »Lyrik« in
dem Buch, d. h. Hoffnung und Keimkraft!
Berlin. Richard M. Meyer.
Eduard Sievers, Rhythmisch-melodische Studien. Vorträge und Aufsätze.
Heidelberg 1912, Winters Universitätsbuchhandlung.
Es ist mit Freude zu begrüßen, daß Sievers, der Leipziger Germanist, seine
Forschungen, die er früher nur in Zeitschriften periodisch ans Licht gerückt hatte,
nun"gesammelt in volle Öffentlichkeit bringt. Sie scheinen mir überaus wichtig zu
sein und einen Wendepunkt im Betrieb der Metrik zu bedeuten, die bisher in rein
»objektiver«, d. h. bei aller Akribie unwissenschaftlicher Weise betrieben worden
ist. Während die frühere Metrik meist bloße »Augenphilologie« war, um Sievers'
Ausdruck zu brauchen, zieht Sievers zum ersten Male in voller Ausdehnung den
lebendigen Vortrag mit seinen wechselnden Akzenten und vor allem seiner Sprach-
melodie heran, läßt also damit mit vollem Rechte den subjektiven Faktor, der
in aller lebendigen Kunst steckt, zur vollen Geltung gelangen. Im Grunde hatte
die alte »objektive« Metrik ja auch, meist nur ohne sich klar darüber zu sein, einen
subjektiven Faktor, die Betonung, mit herangezogen, nur hatte sie jene schemati-
sierte, verwaschene, unlebendige »Subjektivität«, die sie zugrunde legte, für »Ob-
jektivität« angesehen. Sievers nun operiert nicht mehr mit den skelettartigen
Schemen der früheren Metrik, stets betrachtet er den Rhythmus in engster Be-
ziehung zum Inhalt. Er bespricht die Bildung rhythmischer Gruppen, die durch
das Ein- und Absetzen vor Willensimpulsen gebildet werden und je nach der Stel-
lung der Hebung fallend-steigend oder steigend-fallend sind. Auch der Unterschied
von monopodischer und dipodischer Bindung innerhalb dieser Gruppen kommt zur
Sprache. Das Wichtigste in den Sieversschen Theorien aber, was früher fast ganz
vernachlässigt worden ist, betrifft die Melodie des Sprechverses. Und hierin
beruht nun eine höchst interessante Entdeckung von Sievers, daß nämlich auch
diese Melodie mit ziemlicher Eindeutigkeit aus den optischen Daten herausgelesen
wird; d.h. man muß zwei ethnographisch getrennte, konträre Typen der Melodi-
sierung unterscheiden, die dann unter sich aber ziemlich konstant verfahren. So
hat Sievers bemerkt, daß die Angehörigen eines solchen Typus ganz gleichmäßig
verfahren, indem sie ein Gedicht in hoher oder tiefer Stimmlage sprechen, indem
sie große oder kleine Intervalle bilden, indem sie je nachdem eine freie oder ge-
bundene Tonführung haben, spezifische Tonschritte, speziell als Eingang oder Ka-