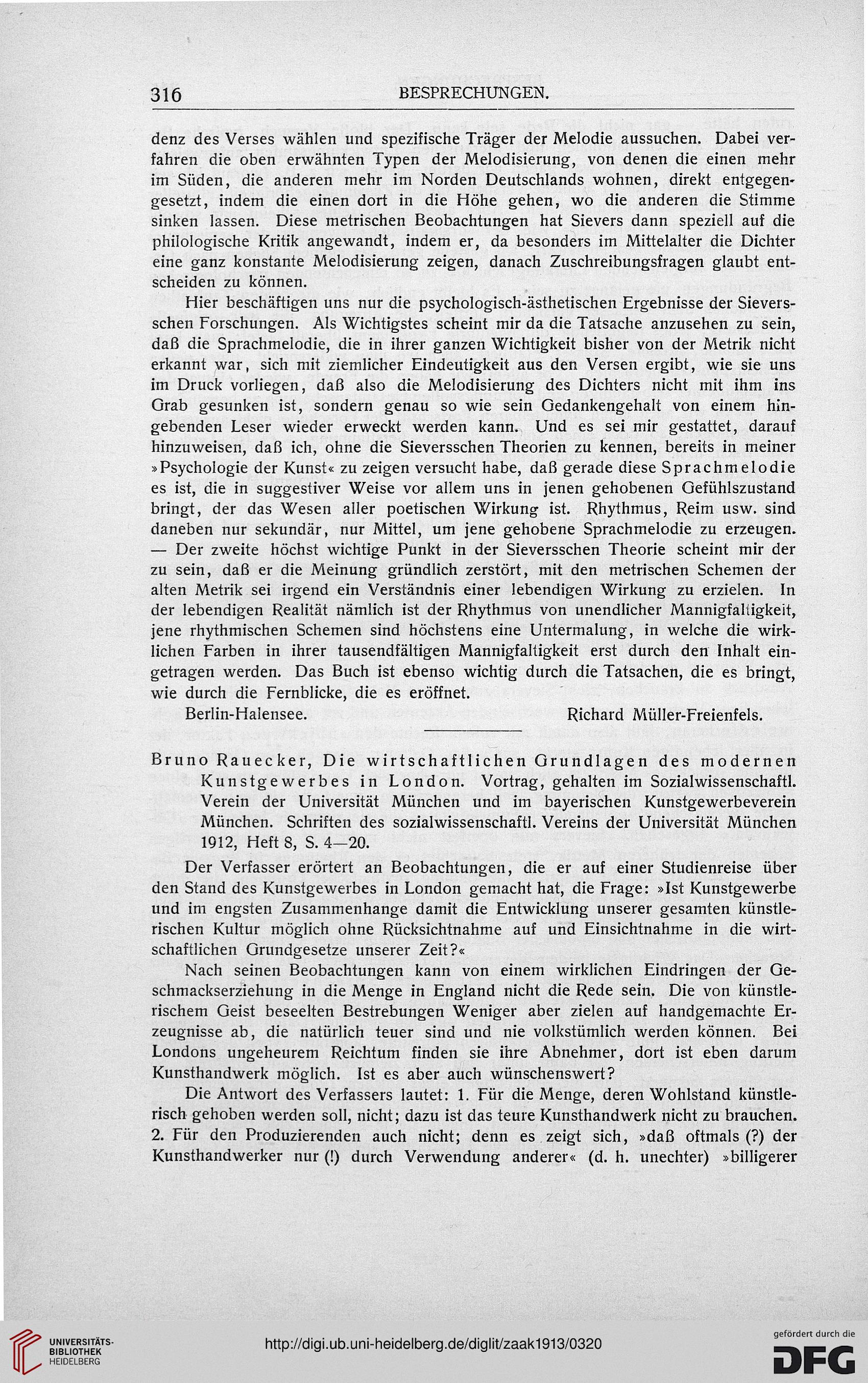316 BESPRECHUNGEN.
denz des Verses wählen und spezifische Träger der Melodie aussuchen. Dabei ver-
fahren die oben erwähnten Typen der Melodisierung, von denen die einen mehr
im Süden, die anderen mehr im Norden Deutschlands wohnen, direkt entgegen-
gesetzt, indem die einen dort in die Höhe gehen, wo die anderen die Stimme
sinken lassen. Diese metrischen Beobachtungen hat Sievers dann speziell auf die
philologische Kritik angewandt, indem er, da besonders im Mittelalter die Dichter
eine ganz konstante Melodisierung zeigen, danach Zuschreibungsfragen glaubt ent-
scheiden zu können.
Hier beschäftigen uns nur die psychologisch-ästhetischen Ergebnisse der Sievers-
schen Forschungen. Als Wichtigstes scheint mir da die Tatsache anzusehen zu sein,
daß die Sprachmelodie, die in ihrer ganzen Wichtigkeit bisher von der Metrik nicht
erkannt war, sich mit ziemlicher Eindeutigkeit aus den Versen ergibt, wie sie uns
im Druck vorliegen, daß also die Melodisierung des Dichters nicht mit ihm ins
Grab gesunken ist, sondern genau so wie sein Gedankengehalt von einem hin-
gebenden Leser wieder erweckt werden kann. Und es sei mir gestattet, darauf
hinzuweisen, daß ich, ohne die Sieversschen Theorien zu kennen, bereits in meiner
»Psychologie der Kunst« zu zeigen versucht habe, daß gerade diese Sprachmelodie
es ist, die in suggestiver Weise vor allem uns in jenen gehobenen Gefühlszustand
bringt, der das Wesen aller poetischen Wirkung ist. Rhythmus, Reim usw. sind
daneben nur sekundär, nur Mittel, um jene gehobene Sprachmelodie zu erzeugen.
— Der zweite höchst wichtige Punkt in der Sieversschen Theorie scheint mir der
zu sein, daß er die Meinung gründlich zerstört, mit den metrischen Schemen der
alten Metrik sei irgend ein Verständnis einer lebendigen Wirkung zu erzielen. In
der lebendigen Realität nämlich ist der Rhythmus von unendlicher Mannigfaltigkeit,
jene rhythmischen Schemen sind höchstens eine Untermalung, in welche die wirk-
lichen Farben in ihrer tausendfältigen Mannigfaltigkeit erst durch den Inhalt ein-
getragen werden. Das Buch ist ebenso wichtig durch die Tatsachen, die es bringt,
wie durch die Fernblicke, die es eröffnet.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Bruno Rauecker, Die wirtschaftlichen Grundlagen des modernen
Kunstgewerbes in London. Vortrag, gehalten im Sozialwissenschaftl.
Verein der Universität München und im bayerischen Kunstgewerbeverein
München. Schriften des sozialwissenschaftl. Vereins der Universität München
1912, Heft 8, S. 4—20.
Der Verfasser erörtert an Beobachtungen, die er auf einer Studienreise über
den Stand des Kunstgewerbes in London gemacht hat, die Frage: »Ist Kunstgewerbe
und im engsten Zusammenhange damit die Entwicklung unserer gesamten künstle-
rischen Kultur möglich ohne Rücksichtnahme auf und Einsichtnahme in die wirt-
schaftlichen Grundgesetze unserer Zeit?«
Nach seinen Beobachtungen kann von einem wirklichen Eindringen der Ge-
schmackserziehung in die Menge in England nicht die Rede sein. Die von künstle-
rischem Geist beseelten Bestrebungen Weniger aber zielen auf handgemachte Er-
zeugnisse ab, die natürlich teuer sind und nie volkstümlich werden können. Bei
Londons ungeheurem Reichtum finden sie ihre Abnehmer, dort ist eben darum
Kunsthandwerk möglich. Ist es aber auch wünschenswert?
Die Antwort des Verfassers lautet: 1. Für die Menge, deren Wohlstand künstle-
risch gehoben werden soll, nicht; dazu ist das teure Kunsthandwerk nicht zu brauchen.
2. Für den Produzierenden auch nicht; denn es zeigt sich, »daß oftmals (?) der
Kunsthandwerker nur (!) durch Verwendung anderer« (d. h. unechter) »billigerer
denz des Verses wählen und spezifische Träger der Melodie aussuchen. Dabei ver-
fahren die oben erwähnten Typen der Melodisierung, von denen die einen mehr
im Süden, die anderen mehr im Norden Deutschlands wohnen, direkt entgegen-
gesetzt, indem die einen dort in die Höhe gehen, wo die anderen die Stimme
sinken lassen. Diese metrischen Beobachtungen hat Sievers dann speziell auf die
philologische Kritik angewandt, indem er, da besonders im Mittelalter die Dichter
eine ganz konstante Melodisierung zeigen, danach Zuschreibungsfragen glaubt ent-
scheiden zu können.
Hier beschäftigen uns nur die psychologisch-ästhetischen Ergebnisse der Sievers-
schen Forschungen. Als Wichtigstes scheint mir da die Tatsache anzusehen zu sein,
daß die Sprachmelodie, die in ihrer ganzen Wichtigkeit bisher von der Metrik nicht
erkannt war, sich mit ziemlicher Eindeutigkeit aus den Versen ergibt, wie sie uns
im Druck vorliegen, daß also die Melodisierung des Dichters nicht mit ihm ins
Grab gesunken ist, sondern genau so wie sein Gedankengehalt von einem hin-
gebenden Leser wieder erweckt werden kann. Und es sei mir gestattet, darauf
hinzuweisen, daß ich, ohne die Sieversschen Theorien zu kennen, bereits in meiner
»Psychologie der Kunst« zu zeigen versucht habe, daß gerade diese Sprachmelodie
es ist, die in suggestiver Weise vor allem uns in jenen gehobenen Gefühlszustand
bringt, der das Wesen aller poetischen Wirkung ist. Rhythmus, Reim usw. sind
daneben nur sekundär, nur Mittel, um jene gehobene Sprachmelodie zu erzeugen.
— Der zweite höchst wichtige Punkt in der Sieversschen Theorie scheint mir der
zu sein, daß er die Meinung gründlich zerstört, mit den metrischen Schemen der
alten Metrik sei irgend ein Verständnis einer lebendigen Wirkung zu erzielen. In
der lebendigen Realität nämlich ist der Rhythmus von unendlicher Mannigfaltigkeit,
jene rhythmischen Schemen sind höchstens eine Untermalung, in welche die wirk-
lichen Farben in ihrer tausendfältigen Mannigfaltigkeit erst durch den Inhalt ein-
getragen werden. Das Buch ist ebenso wichtig durch die Tatsachen, die es bringt,
wie durch die Fernblicke, die es eröffnet.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Bruno Rauecker, Die wirtschaftlichen Grundlagen des modernen
Kunstgewerbes in London. Vortrag, gehalten im Sozialwissenschaftl.
Verein der Universität München und im bayerischen Kunstgewerbeverein
München. Schriften des sozialwissenschaftl. Vereins der Universität München
1912, Heft 8, S. 4—20.
Der Verfasser erörtert an Beobachtungen, die er auf einer Studienreise über
den Stand des Kunstgewerbes in London gemacht hat, die Frage: »Ist Kunstgewerbe
und im engsten Zusammenhange damit die Entwicklung unserer gesamten künstle-
rischen Kultur möglich ohne Rücksichtnahme auf und Einsichtnahme in die wirt-
schaftlichen Grundgesetze unserer Zeit?«
Nach seinen Beobachtungen kann von einem wirklichen Eindringen der Ge-
schmackserziehung in die Menge in England nicht die Rede sein. Die von künstle-
rischem Geist beseelten Bestrebungen Weniger aber zielen auf handgemachte Er-
zeugnisse ab, die natürlich teuer sind und nie volkstümlich werden können. Bei
Londons ungeheurem Reichtum finden sie ihre Abnehmer, dort ist eben darum
Kunsthandwerk möglich. Ist es aber auch wünschenswert?
Die Antwort des Verfassers lautet: 1. Für die Menge, deren Wohlstand künstle-
risch gehoben werden soll, nicht; dazu ist das teure Kunsthandwerk nicht zu brauchen.
2. Für den Produzierenden auch nicht; denn es zeigt sich, »daß oftmals (?) der
Kunsthandwerker nur (!) durch Verwendung anderer« (d. h. unechter) »billigerer