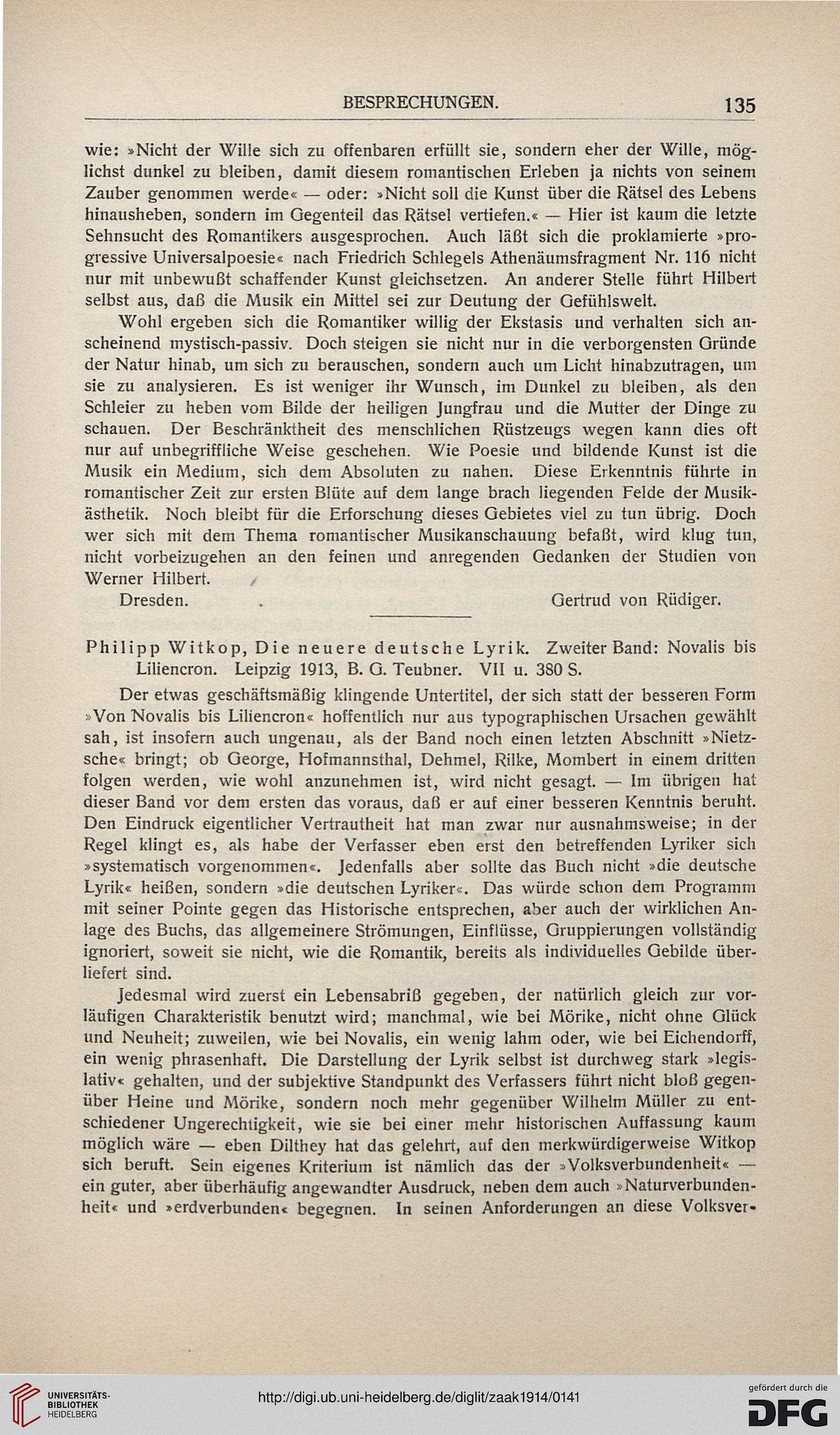BESPRECHUNGEN. 135
wie: »Nicht der Wille sich zu offenbaren erfüllt sie, sondern eher der Wille, mög-
lichst dunkel zu bleiben, damit diesem romantischen Erleben ja nichts von seinem
Zauber genommen werde« — oder: »Nicht soll die Kunst über die Rätsel des Lebens
hinausheben, sondern im Gegenteil das Rätsel vertiefen.« — Hier ist kaum die letzte
Sehnsucht des Romantikers ausgesprochen. Auch läßt sich die proklamierte »pro-
gressive Universalpoesie« nach Friedrich Schlegels Athenäumsfragment Nr. 116 nicht
nur mit unbewußt schaffender Kunst gleichsetzen. An anderer Stelle führt Hubert
selbst aus, daß die Musik ein Mittel sei zur Deutung der Gefühlswelt.
Wohl ergeben sich die Romantiker willig der Ekstasis und verhalten sich an-
scheinend mystisch-passiv. Doch steigen sie nicht nur in die verborgensten Gründe
der Natur hinab, um sich zu berauschen, sondern auch um Licht hinabzutragen, um
sie zu analysieren. Es ist weniger ihr Wunsch, im Dunkel zu bleiben, als den
Schleier zu heben vom Bilde der heiligen Jungfrau und die Mutter der Dinge zu
schauen. Der Beschränktheit des menschlichen Rüstzeugs wegen kann dies oft
nur auf unbegriffliche Weise geschehen. Wie Poesie und bildende Kunst ist die
Musik ein Medium, sich dem Absoluten zu nahen. Diese Erkenntnis führte in
romantischer Zeit zur ersten Blüte auf dem lange brach liegenden Felde der Musik-
ästhetik. Noch bleibt für die Erforschung dieses Gebietes viel zu tun übrig. Doch
wer sich mit dem Thema romantischer Musikanschauung befaßt, wird klug tun,
nicht vorbeizugehen an den feinen und anregenden Gedanken der Studien von
Werner Hubert. /
Dresden. . Gertrud von Rüdiger.
Philipp Witkop, Die neuere deutsche Lyrik. Zweiter Band: Novalis bis
Liliencron. Leipzig 1913, B. G. Teubner. VII u. 380 S.
Der etwas geschäftsmäßig klingende Untertitel, der sich statt der besseren Form
»Von Novalis bis Liliencron« hoffentlich nur aus typographischen Ursachen gewählt
sah, ist insofern auch ungenau, als der Band noch einen letzten Abschnitt »Nietz-
sche« bringt; ob George, Hofmannsthal, Dehmel, Rilke, Mombert in einem dritten
folgen werden, wie wohl anzunehmen ist, wird nicht gesagt. — Im übrigen hat
dieser Band vor dem ersten das voraus, daß er auf einer besseren Kenntnis beruht.
Den Eindruck eigentlicher Vertrautheit hat man zwar nur ausnahmsweise; in der
Regel klingt es, als habe der Verfasser eben erst den betreffenden Lyriker sich
»systematisch vorgenommen«. Jedenfalls aber sollte das Buch nicht »die deutsche
Lyrik« heißen, sondern »die deutschen Lyriker«. Das würde schon dem Programm
mit seiner Pointe gegen das Historische entsprechen, aber auch der wirklichen An-
lage des Buchs, das allgemeinere Strömungen, Einflüsse, Gruppierungen vollständig
ignoriert, soweit sie nicht, wie die Romantik, bereits als individuelles Gebilde über-
liefert sind.
Jedesmal wird zuerst ein Lebensabriß gegeben, der natürlich gleich zur vor-
läufigen Charakteristik benutzt wird; manchmal, wie bei Mörike, nicht ohne Glück
und Neuheit; zuweilen, wie bei Novalis, ein wenig lahm oder, wie bei Eichendorff,
ein wenig phrasenhaft. Die Darstellung der Lyrik selbst ist durchweg stark »legis-
lativ« gehalten, und der subjektive Standpunkt des Verfassers führt nicht bloß gegen-
über Heine und Mörike, sondern noch mehr gegenüber Wilhelm Müller zu ent-
schiedener Ungerechtigkeit, wie sie bei einer mehr historischen Auffassung kaum
möglich wäre — eben Dilthey hat das gelehrt, auf den merkwürdigerweise Witkop
sich beruft. Sein eigenes Kriterium ist nämlich das der »Volksverbundenheit« —
ein guter, aber überhäufig angewandter Ausdruck, neben dem auch »Naturverbunden-
heit« und »erdverbunden« begegnen. In seinen Anforderungen an diese Volksver-
wie: »Nicht der Wille sich zu offenbaren erfüllt sie, sondern eher der Wille, mög-
lichst dunkel zu bleiben, damit diesem romantischen Erleben ja nichts von seinem
Zauber genommen werde« — oder: »Nicht soll die Kunst über die Rätsel des Lebens
hinausheben, sondern im Gegenteil das Rätsel vertiefen.« — Hier ist kaum die letzte
Sehnsucht des Romantikers ausgesprochen. Auch läßt sich die proklamierte »pro-
gressive Universalpoesie« nach Friedrich Schlegels Athenäumsfragment Nr. 116 nicht
nur mit unbewußt schaffender Kunst gleichsetzen. An anderer Stelle führt Hubert
selbst aus, daß die Musik ein Mittel sei zur Deutung der Gefühlswelt.
Wohl ergeben sich die Romantiker willig der Ekstasis und verhalten sich an-
scheinend mystisch-passiv. Doch steigen sie nicht nur in die verborgensten Gründe
der Natur hinab, um sich zu berauschen, sondern auch um Licht hinabzutragen, um
sie zu analysieren. Es ist weniger ihr Wunsch, im Dunkel zu bleiben, als den
Schleier zu heben vom Bilde der heiligen Jungfrau und die Mutter der Dinge zu
schauen. Der Beschränktheit des menschlichen Rüstzeugs wegen kann dies oft
nur auf unbegriffliche Weise geschehen. Wie Poesie und bildende Kunst ist die
Musik ein Medium, sich dem Absoluten zu nahen. Diese Erkenntnis führte in
romantischer Zeit zur ersten Blüte auf dem lange brach liegenden Felde der Musik-
ästhetik. Noch bleibt für die Erforschung dieses Gebietes viel zu tun übrig. Doch
wer sich mit dem Thema romantischer Musikanschauung befaßt, wird klug tun,
nicht vorbeizugehen an den feinen und anregenden Gedanken der Studien von
Werner Hubert. /
Dresden. . Gertrud von Rüdiger.
Philipp Witkop, Die neuere deutsche Lyrik. Zweiter Band: Novalis bis
Liliencron. Leipzig 1913, B. G. Teubner. VII u. 380 S.
Der etwas geschäftsmäßig klingende Untertitel, der sich statt der besseren Form
»Von Novalis bis Liliencron« hoffentlich nur aus typographischen Ursachen gewählt
sah, ist insofern auch ungenau, als der Band noch einen letzten Abschnitt »Nietz-
sche« bringt; ob George, Hofmannsthal, Dehmel, Rilke, Mombert in einem dritten
folgen werden, wie wohl anzunehmen ist, wird nicht gesagt. — Im übrigen hat
dieser Band vor dem ersten das voraus, daß er auf einer besseren Kenntnis beruht.
Den Eindruck eigentlicher Vertrautheit hat man zwar nur ausnahmsweise; in der
Regel klingt es, als habe der Verfasser eben erst den betreffenden Lyriker sich
»systematisch vorgenommen«. Jedenfalls aber sollte das Buch nicht »die deutsche
Lyrik« heißen, sondern »die deutschen Lyriker«. Das würde schon dem Programm
mit seiner Pointe gegen das Historische entsprechen, aber auch der wirklichen An-
lage des Buchs, das allgemeinere Strömungen, Einflüsse, Gruppierungen vollständig
ignoriert, soweit sie nicht, wie die Romantik, bereits als individuelles Gebilde über-
liefert sind.
Jedesmal wird zuerst ein Lebensabriß gegeben, der natürlich gleich zur vor-
läufigen Charakteristik benutzt wird; manchmal, wie bei Mörike, nicht ohne Glück
und Neuheit; zuweilen, wie bei Novalis, ein wenig lahm oder, wie bei Eichendorff,
ein wenig phrasenhaft. Die Darstellung der Lyrik selbst ist durchweg stark »legis-
lativ« gehalten, und der subjektive Standpunkt des Verfassers führt nicht bloß gegen-
über Heine und Mörike, sondern noch mehr gegenüber Wilhelm Müller zu ent-
schiedener Ungerechtigkeit, wie sie bei einer mehr historischen Auffassung kaum
möglich wäre — eben Dilthey hat das gelehrt, auf den merkwürdigerweise Witkop
sich beruft. Sein eigenes Kriterium ist nämlich das der »Volksverbundenheit« —
ein guter, aber überhäufig angewandter Ausdruck, neben dem auch »Naturverbunden-
heit« und »erdverbunden« begegnen. In seinen Anforderungen an diese Volksver-