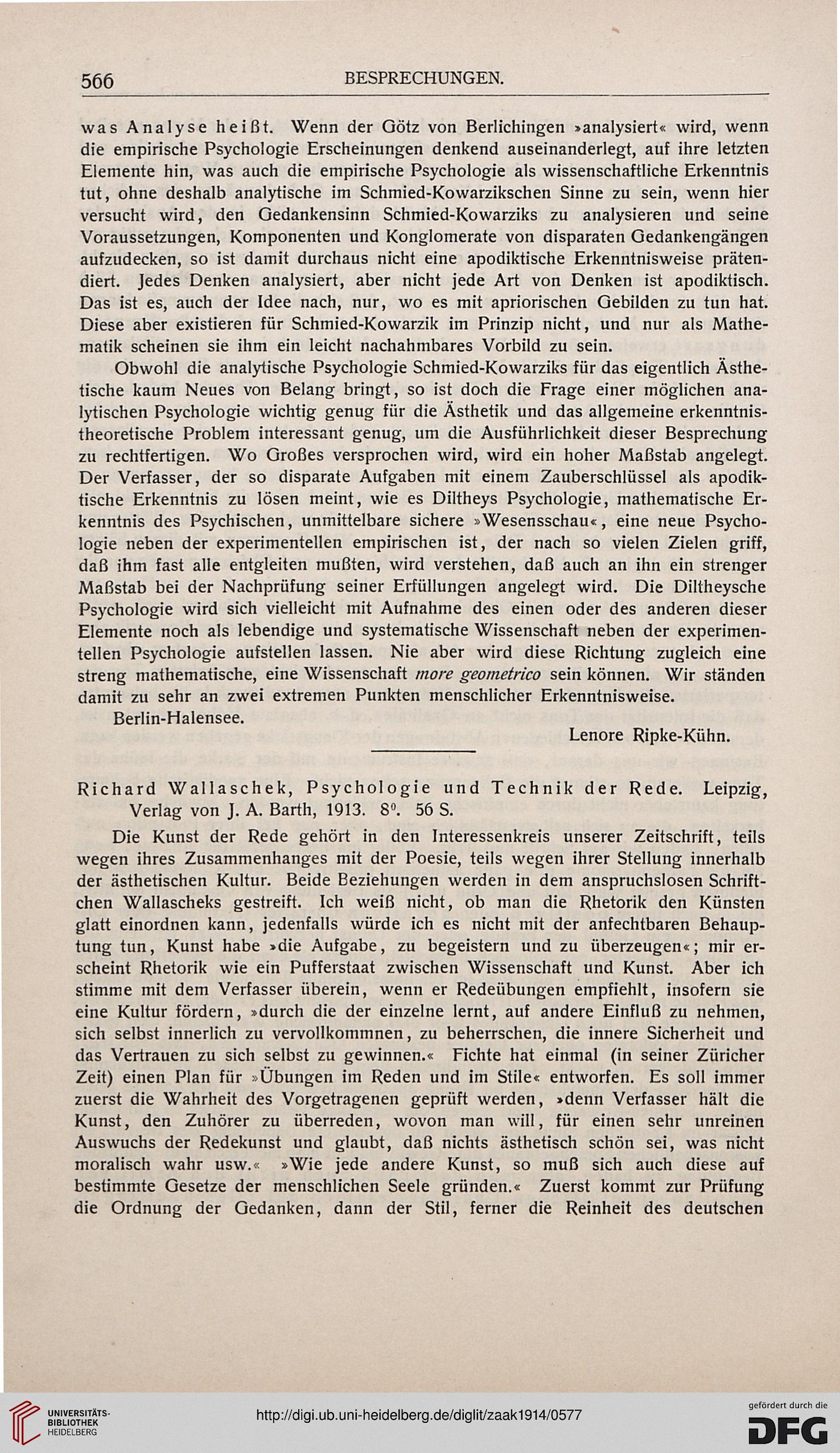566 BESPRECHUNGEN.
was Analyse heißt. Wenn der Götz von Berlichingen >analysiert« wird, wenn
die empirische Psychologie Erscheinungen denkend auseinanderlegt, auf ihre letzten
Elemente hin, was auch die empirische Psychologie als wissenschaftliche Erkenntnis
tut, ohne deshalb analytische im Schmied-Kowarzikschen Sinne zu sein, wenn hier
versucht wird, den Gedankensinn Schmied-Kowarziks zu analysieren und seine
Voraussetzungen, Komponenten und Konglomerate von disparaten Gedankengängen
aufzudecken, so ist damit durchaus nicht eine apodiktische Erkenntnisweise präten-
diert. Jedes Denken analysiert, aber nicht jede Art von Denken ist apodiktisch.
Das ist es, auch der Idee nach, nur, wo es mit apriorischen Gebilden zu tun hat.
Diese aber existieren für Schmied-Kowarzik im Prinzip nicht, und nur als Mathe-
matik scheinen sie ihm ein leicht nachahmbares Vorbild zu sein.
Obwohl die analytische Psychologie Schmied-Kowarziks für das eigentlich Ästhe-
tische kaum Neues von Belang bringt, so ist doch die Frage einer möglichen ana-
lytischen Psychologie wichtig genug für die Ästhetik und das allgemeine erkenntnis-
theoretische Problem interessant genug, um die Ausführlichkeit dieser Besprechung
zu rechtfertigen. Wo Großes versprochen wird, wird ein hoher Maßstab angelegt.
Der Verfasser, der so disparate Aufgaben mit einem Zauberschlüssel als apodik-
tische Erkenntnis zu lösen meint, wie es Diltheys Psychologie, mathematische Er-
kenntnis des Psychischen, unmittelbare sichere »Wesensschau«, eine neue Psycho-
logie neben der experimentellen empirischen ist, der nach so vielen Zielen griff,
daß ihm fast alle entgleiten mußten, wird verstehen, daß auch an ihn ein strenger
Maßstab bei der Nachprüfung seiner Erfüllungen angelegt wird. Die Diltheysche
Psychologie wird sich vielleicht mit Aufnahme des einen oder des anderen dieser
Elemente noch als lebendige und systematische Wissenschaft neben der experimen-
tellen Psychologie aufstellen lassen. Nie aber wird diese Richtung zugleich eine
streng mathematische, eine Wissenschaft more geometrico sein können. Wir ständen
damit zu sehr an zwei extremen Punkten menschlicher Erkenntnisweise.
Berlin-Halensee.
Lenore Ripke-Kühn.
Richard Wallaschek, Psychologie und Technik der Rede. Leipzig,
Verlag von J. A. Barth, 1913. 8°. 56 S.
Die Kunst der Rede gehört in den Interessenkreis unserer Zeitschrift, teils
wegen ihres Zusammenhanges mit der Poesie, teils wegen ihrer Stellung innerhalb
der ästhetischen Kultur. Beide Beziehungen werden in dem anspruchslosen Schrift-
chen Wallascheks gestreift. Ich weiß nicht, ob man die Rhetorik den Künsten
glatt einordnen kann, jedenfalls würde ich es nicht mit der anfechtbaren Behaup-
tung tun, Kunst habe »die Aufgabe, zu begeistern und zu überzeugen«; mir er-
scheint Rhetorik wie ein Pufferstaat zwischen Wissenschaft und Kunst. Aber ich
stimme mit dem Verfasser überein, wenn er Redeübungen empfiehlt, insofern sie
eine Kultur fördern, »durch die der einzelne lernt, auf andere Einfluß zu nehmen,
sich selbst innerlich zu vervollkommnen, zu beherrschen, die innere Sicherheit und
das Vertrauen zu sich selbst zu gewinnen.« Fichte hat einmal (in seiner Züricher
Zeit) einen Plan für »Übungen im Reden und im Stile« entworfen. Es soll immer
zuerst die Wahrheit des Vorgetragenen geprüft werden, »denn Verfasser hält die
Kunst, den Zuhörer zu überreden, wovon man will, für einen sehr unreinen
Auswuchs der Redekunst und glaubt, daß nichts ästhetisch schön sei, was nicht
moralisch wahr usw.« »Wie jede andere Kunst, so muß sich auch diese auf
bestimmte Gesetze der menschlichen Seele gründen.« Zuerst kommt zur Prüfung
die Ordnung der Gedanken, dann der Stil, ferner die Reinheit des deutschen
was Analyse heißt. Wenn der Götz von Berlichingen >analysiert« wird, wenn
die empirische Psychologie Erscheinungen denkend auseinanderlegt, auf ihre letzten
Elemente hin, was auch die empirische Psychologie als wissenschaftliche Erkenntnis
tut, ohne deshalb analytische im Schmied-Kowarzikschen Sinne zu sein, wenn hier
versucht wird, den Gedankensinn Schmied-Kowarziks zu analysieren und seine
Voraussetzungen, Komponenten und Konglomerate von disparaten Gedankengängen
aufzudecken, so ist damit durchaus nicht eine apodiktische Erkenntnisweise präten-
diert. Jedes Denken analysiert, aber nicht jede Art von Denken ist apodiktisch.
Das ist es, auch der Idee nach, nur, wo es mit apriorischen Gebilden zu tun hat.
Diese aber existieren für Schmied-Kowarzik im Prinzip nicht, und nur als Mathe-
matik scheinen sie ihm ein leicht nachahmbares Vorbild zu sein.
Obwohl die analytische Psychologie Schmied-Kowarziks für das eigentlich Ästhe-
tische kaum Neues von Belang bringt, so ist doch die Frage einer möglichen ana-
lytischen Psychologie wichtig genug für die Ästhetik und das allgemeine erkenntnis-
theoretische Problem interessant genug, um die Ausführlichkeit dieser Besprechung
zu rechtfertigen. Wo Großes versprochen wird, wird ein hoher Maßstab angelegt.
Der Verfasser, der so disparate Aufgaben mit einem Zauberschlüssel als apodik-
tische Erkenntnis zu lösen meint, wie es Diltheys Psychologie, mathematische Er-
kenntnis des Psychischen, unmittelbare sichere »Wesensschau«, eine neue Psycho-
logie neben der experimentellen empirischen ist, der nach so vielen Zielen griff,
daß ihm fast alle entgleiten mußten, wird verstehen, daß auch an ihn ein strenger
Maßstab bei der Nachprüfung seiner Erfüllungen angelegt wird. Die Diltheysche
Psychologie wird sich vielleicht mit Aufnahme des einen oder des anderen dieser
Elemente noch als lebendige und systematische Wissenschaft neben der experimen-
tellen Psychologie aufstellen lassen. Nie aber wird diese Richtung zugleich eine
streng mathematische, eine Wissenschaft more geometrico sein können. Wir ständen
damit zu sehr an zwei extremen Punkten menschlicher Erkenntnisweise.
Berlin-Halensee.
Lenore Ripke-Kühn.
Richard Wallaschek, Psychologie und Technik der Rede. Leipzig,
Verlag von J. A. Barth, 1913. 8°. 56 S.
Die Kunst der Rede gehört in den Interessenkreis unserer Zeitschrift, teils
wegen ihres Zusammenhanges mit der Poesie, teils wegen ihrer Stellung innerhalb
der ästhetischen Kultur. Beide Beziehungen werden in dem anspruchslosen Schrift-
chen Wallascheks gestreift. Ich weiß nicht, ob man die Rhetorik den Künsten
glatt einordnen kann, jedenfalls würde ich es nicht mit der anfechtbaren Behaup-
tung tun, Kunst habe »die Aufgabe, zu begeistern und zu überzeugen«; mir er-
scheint Rhetorik wie ein Pufferstaat zwischen Wissenschaft und Kunst. Aber ich
stimme mit dem Verfasser überein, wenn er Redeübungen empfiehlt, insofern sie
eine Kultur fördern, »durch die der einzelne lernt, auf andere Einfluß zu nehmen,
sich selbst innerlich zu vervollkommnen, zu beherrschen, die innere Sicherheit und
das Vertrauen zu sich selbst zu gewinnen.« Fichte hat einmal (in seiner Züricher
Zeit) einen Plan für »Übungen im Reden und im Stile« entworfen. Es soll immer
zuerst die Wahrheit des Vorgetragenen geprüft werden, »denn Verfasser hält die
Kunst, den Zuhörer zu überreden, wovon man will, für einen sehr unreinen
Auswuchs der Redekunst und glaubt, daß nichts ästhetisch schön sei, was nicht
moralisch wahr usw.« »Wie jede andere Kunst, so muß sich auch diese auf
bestimmte Gesetze der menschlichen Seele gründen.« Zuerst kommt zur Prüfung
die Ordnung der Gedanken, dann der Stil, ferner die Reinheit des deutschen