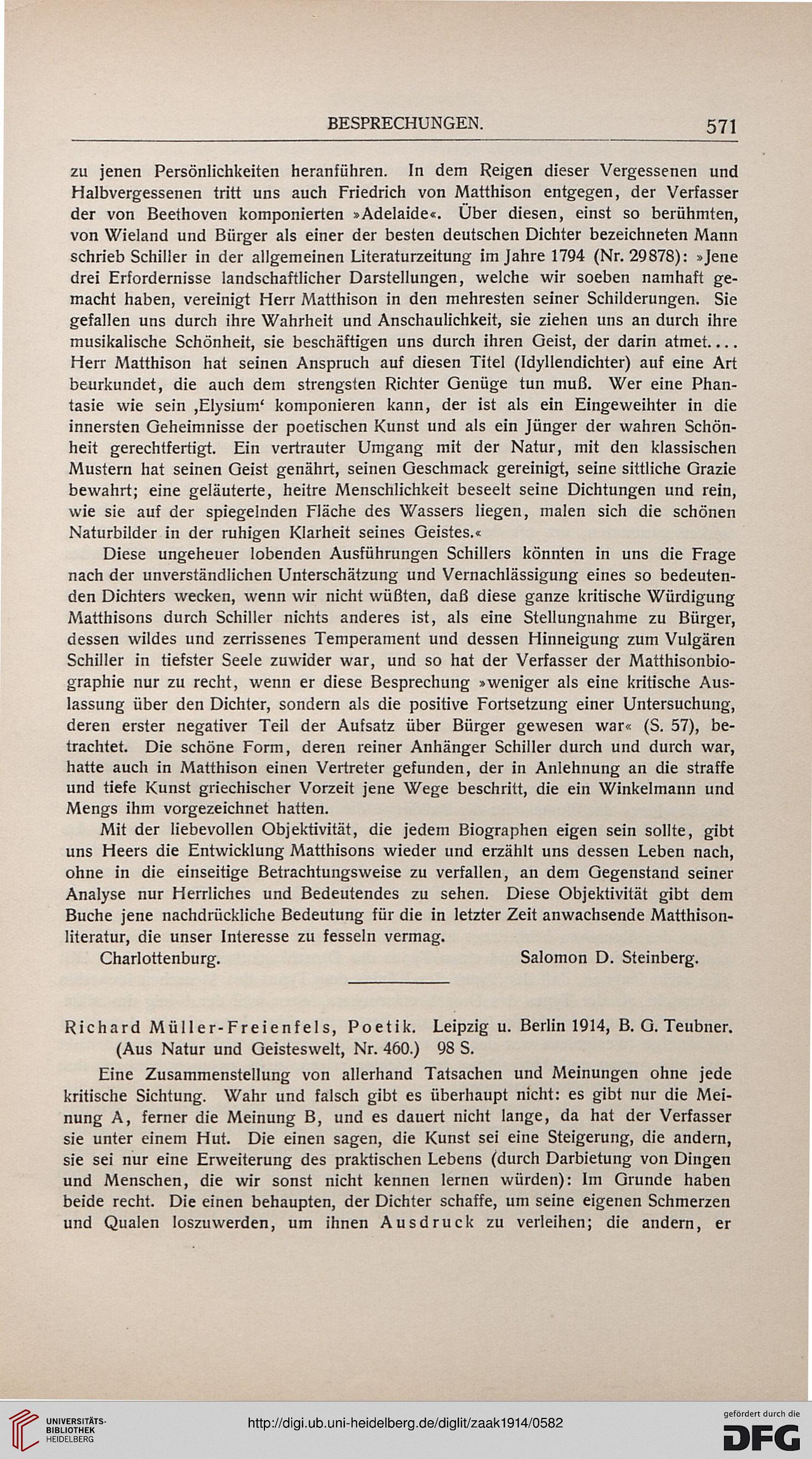BESPRECHUNGEN. 571
zu jenen Persönlichkeiten heranführen. In dem Reigen dieser Vergessenen und
Halbvergessenen tritt uns auch Friedrich von Matthison entgegen, der Verfasser
der von Beethoven komponierten »Adelaide«. Über diesen, einst so berühmten,
von Wieland und Bürger als einer der besten deutschen Dichter bezeichneten Mann
schrieb Schiller in der allgemeinen Literaturzeitung im Jahre 1794 (Nr. 29878): »Jene
drei Erfordernisse landschaftlicher Darstellungen, welche wir soeben namhaft ge-
macht haben, vereinigt Herr Matthison in den mehresten seiner Schilderungen. Sie
gefallen uns durch ihre Wahrheit und Anschaulichkeit, sie ziehen uns an durch ihre
musikalische Schönheit, sie beschäftigen uns durch ihren Geist, der darin atmet___
Herr Matthison hat seinen Anspruch auf diesen Titel (Idyllendichter) auf eine Art
beurkundet, die auch dem strengsten Richter Genüge tun muß. Wer eine Phan-
tasie wie sein ,Elysium' komponieren kann, der ist als ein Eingeweihter in die
innersten Geheimnisse der poetischen Kunst und als ein Jünger der wahren Schön-
heit gerechtfertigt. Ein vertrauter Umgang mit der Natur, mit den klassischen
Mustern hat seinen Geist genährt, seinen Geschmack gereinigt, seine sittliche Grazie
bewahrt; eine geläuterte, heitre Menschlichkeit beseelt seine Dichtungen und rein,
wie sie auf der spiegelnden Fläche des Wassers liegen, malen sich die schönen
Naturbilder in der ruhigen Klarheit seines Geistes.«
Diese ungeheuer lobenden Ausführungen Schillers könnten in uns die Frage
nach der unverständlichen Unterschätzung und Vernachlässigung eines so bedeuten-
den Dichters wecken, wenn wir nicht wüßten, daß diese ganze kritische Würdigung
Matthisons durch Schiller nichts anderes ist, als eine Stellungnahme zu Bürger,
dessen wildes und zerrissenes Temperament und dessen Hinneigung zum Vulgären
Schiller in tiefster Seele zuwider war, und so hat der Verfasser der Matthisonbio-
graphie nur zu recht, wenn er diese Besprechung »weniger als eine kritische Aus-
lassung über den Dichter, sondern als die positive Fortsetzung einer Untersuchung,
deren erster negativer Teil der Aufsatz über Bürger gewesen war« (S. 57), be-
trachtet. Die schöne Form, deren reiner Anhänger Schiller durch und durch war,
hatte auch in Matthison einen Vertreter gefunden, der in Anlehnung an die straffe
und tiefe Kunst griechischer Vorzeit jene Wege beschritt, die ein Winkelmann und
Mengs ihm vorgezeichnet hatten.
Mit der liebevollen Objektivität, die jedem Biographen eigen sein sollte, gibt
uns Heers die Entwicklung Matthisons wieder und erzählt uns dessen Leben nach,
ohne in die einseitige Betrachtungsweise zu verfallen, an dem Gegenstand seiner
Analyse nur Herrliches und Bedeutendes zu sehen. Diese Objektivität gibt dem
Buche jene nachdrückliche Bedeutung für die in letzter Zeit anwachsende Matthison-
literatur, die unser Interesse zu fesseln vermag.
Charlottenburg. Salomon D. Steinberg.
Richard Müller-Freienfels, Poetik. Leipzig u. Berlin 1914, B. G. Teubner.
(Aus Natur und Geisteswelt, Nr. 460.) 98 S.
Eine Zusammenstellung von allerhand Tatsachen und Meinungen ohne jede
kritische Sichtung. Wahr und falsch gibt es überhaupt nicht: es gibt nur die Mei-
nung A, ferner die Meinung B, und es dauert nicht lange, da hat der Verfasser
sie unter einem Hut. Die einen sagen, die Kunst sei eine Steigerung, die andern,
sie sei nur eine Erweiterung des praktischen Lebens (durch Darbietung von Dingen
und Menschen, die wir sonst nicht kennen lernen würden): Im Grunde haben
beide recht. Die einen behaupten, der Dichter schaffe, um seine eigenen Schmerzen
und Qualen loszuwerden, um ihnen Ausdruck zu verleihen; die andern, er
zu jenen Persönlichkeiten heranführen. In dem Reigen dieser Vergessenen und
Halbvergessenen tritt uns auch Friedrich von Matthison entgegen, der Verfasser
der von Beethoven komponierten »Adelaide«. Über diesen, einst so berühmten,
von Wieland und Bürger als einer der besten deutschen Dichter bezeichneten Mann
schrieb Schiller in der allgemeinen Literaturzeitung im Jahre 1794 (Nr. 29878): »Jene
drei Erfordernisse landschaftlicher Darstellungen, welche wir soeben namhaft ge-
macht haben, vereinigt Herr Matthison in den mehresten seiner Schilderungen. Sie
gefallen uns durch ihre Wahrheit und Anschaulichkeit, sie ziehen uns an durch ihre
musikalische Schönheit, sie beschäftigen uns durch ihren Geist, der darin atmet___
Herr Matthison hat seinen Anspruch auf diesen Titel (Idyllendichter) auf eine Art
beurkundet, die auch dem strengsten Richter Genüge tun muß. Wer eine Phan-
tasie wie sein ,Elysium' komponieren kann, der ist als ein Eingeweihter in die
innersten Geheimnisse der poetischen Kunst und als ein Jünger der wahren Schön-
heit gerechtfertigt. Ein vertrauter Umgang mit der Natur, mit den klassischen
Mustern hat seinen Geist genährt, seinen Geschmack gereinigt, seine sittliche Grazie
bewahrt; eine geläuterte, heitre Menschlichkeit beseelt seine Dichtungen und rein,
wie sie auf der spiegelnden Fläche des Wassers liegen, malen sich die schönen
Naturbilder in der ruhigen Klarheit seines Geistes.«
Diese ungeheuer lobenden Ausführungen Schillers könnten in uns die Frage
nach der unverständlichen Unterschätzung und Vernachlässigung eines so bedeuten-
den Dichters wecken, wenn wir nicht wüßten, daß diese ganze kritische Würdigung
Matthisons durch Schiller nichts anderes ist, als eine Stellungnahme zu Bürger,
dessen wildes und zerrissenes Temperament und dessen Hinneigung zum Vulgären
Schiller in tiefster Seele zuwider war, und so hat der Verfasser der Matthisonbio-
graphie nur zu recht, wenn er diese Besprechung »weniger als eine kritische Aus-
lassung über den Dichter, sondern als die positive Fortsetzung einer Untersuchung,
deren erster negativer Teil der Aufsatz über Bürger gewesen war« (S. 57), be-
trachtet. Die schöne Form, deren reiner Anhänger Schiller durch und durch war,
hatte auch in Matthison einen Vertreter gefunden, der in Anlehnung an die straffe
und tiefe Kunst griechischer Vorzeit jene Wege beschritt, die ein Winkelmann und
Mengs ihm vorgezeichnet hatten.
Mit der liebevollen Objektivität, die jedem Biographen eigen sein sollte, gibt
uns Heers die Entwicklung Matthisons wieder und erzählt uns dessen Leben nach,
ohne in die einseitige Betrachtungsweise zu verfallen, an dem Gegenstand seiner
Analyse nur Herrliches und Bedeutendes zu sehen. Diese Objektivität gibt dem
Buche jene nachdrückliche Bedeutung für die in letzter Zeit anwachsende Matthison-
literatur, die unser Interesse zu fesseln vermag.
Charlottenburg. Salomon D. Steinberg.
Richard Müller-Freienfels, Poetik. Leipzig u. Berlin 1914, B. G. Teubner.
(Aus Natur und Geisteswelt, Nr. 460.) 98 S.
Eine Zusammenstellung von allerhand Tatsachen und Meinungen ohne jede
kritische Sichtung. Wahr und falsch gibt es überhaupt nicht: es gibt nur die Mei-
nung A, ferner die Meinung B, und es dauert nicht lange, da hat der Verfasser
sie unter einem Hut. Die einen sagen, die Kunst sei eine Steigerung, die andern,
sie sei nur eine Erweiterung des praktischen Lebens (durch Darbietung von Dingen
und Menschen, die wir sonst nicht kennen lernen würden): Im Grunde haben
beide recht. Die einen behaupten, der Dichter schaffe, um seine eigenen Schmerzen
und Qualen loszuwerden, um ihnen Ausdruck zu verleihen; die andern, er