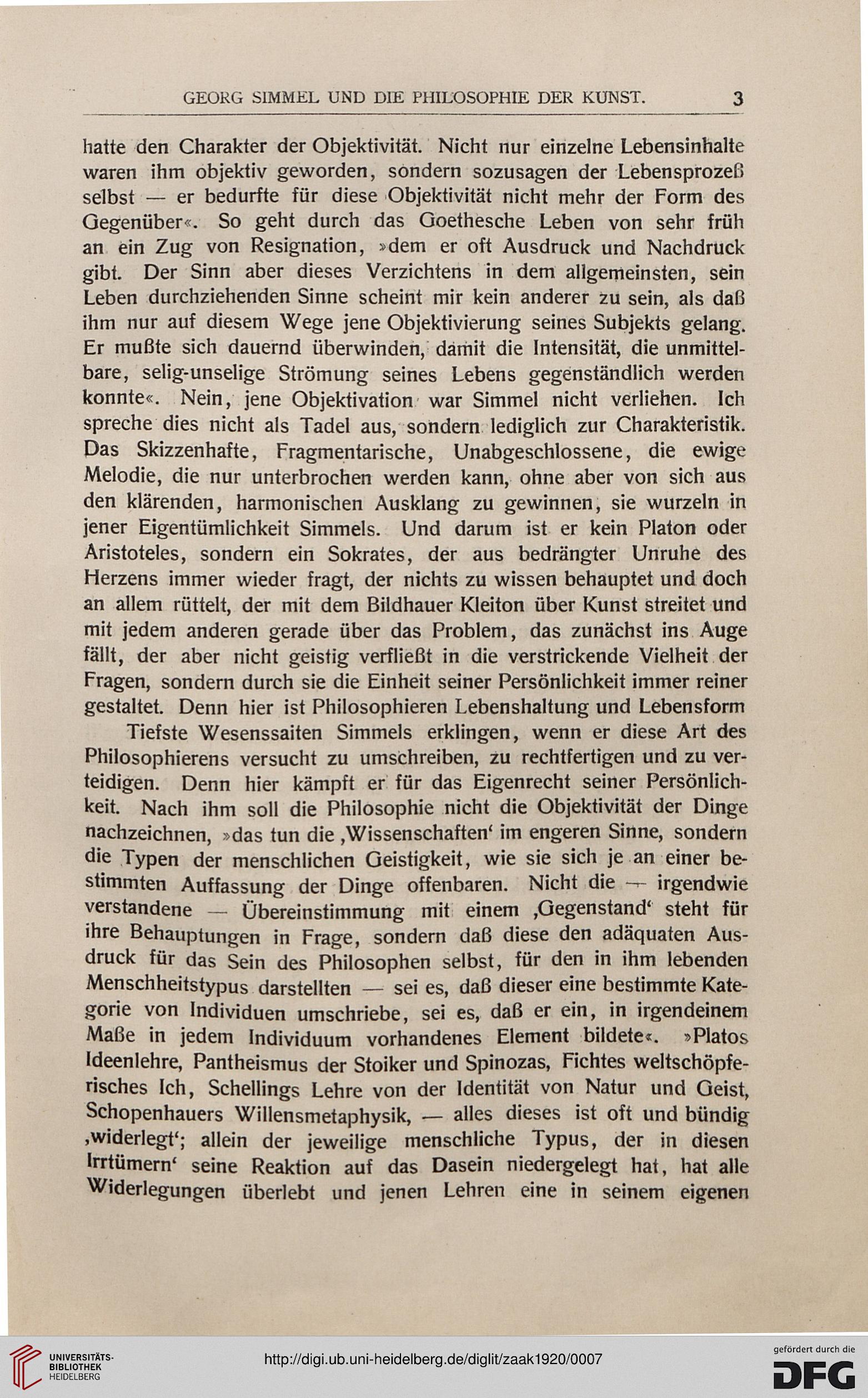GEORG S1MMKL UND DIE PHILOSOPHIE DER KUNST. 3
hatte den Charakter der Objektivität. Nicht nur einzelne Lebensinhalte
waren ihm objektiv geworden, sondern sozusagen der Lebensprozeß
selbst — er bedurfte für diese Objektivität nicht mehr der Form des
Gegenüber«. So geht durch das Goethesche Leben von sehr früh
an ein Zug von Resignation, »dem er oft Ausdruck und Nachdruck
gibt. Der Sinn aber dieses Verzichtens in dem allgemeinsten, sein
Leben durchziehenden Sinne scheint mir kein anderer zu sein, als daß
ihm nur auf diesem Wege jene Objektivierung seines Subjekts gelang.
Er mußte sich dauernd überwinden, damit die Intensität, die unmittel-
bare, selig-unselige Strömung seines Lebens gegenständlich werden
konnte«. Nein, jene Objektivation war Simmel nicht verliehen. Ich
spreche dies nicht als Tadel aus, sondern lediglich zur Charakteristik.
Das Skizzenhafte, Fragmentarische, Unabgeschlossene, die ewige
Melodie, die nur unterbrochen werden kann, ohne aber von sich aus
den klärenden, harmonischen Ausklang zu gewinnen, sie wurzeln in
jener Eigentümlichkeit Simmeis. Und darum ist er kein Piaton oder
Aristoteles, sondern ein Sokrates, der aus bedrängter Unruhe des
Herzens immer wieder fragt, der nichts zu wissen behauptet und doch
an allem rüttelt, der mit dem Bildhauer Kleiton über Kunst streitet und
mit jedem anderen gerade über das Problem, das zunächst ins Auge
fällt, der aber nicht geistig verfließt in die verstrickende Vielheit der
Fragen, sondern durch sie die Einheit seiner Persönlichkeit immer reiner
gestaltet. Denn hier ist Philosophieren Lebenshaltung und Lebensform
Tiefste Wesenssaiten Simmeis erklingen, wenn er diese Art des
Philosophierens versucht zu umschreiben, zu rechtfertigen und zu ver-
teidigen. Denn hier kämpft er für das Eigenrecht seiner Persönlich-
keit. Nach ihm soll die Philosophie nicht die Objektivität der Dinge
nachzeichnen, »das tun die ,Wissenschaften' im engeren Sinne, sondern
die Typen der menschlichen Geistigkeit, wie sie sich je an einer be-
stimmten Auffassung der Dinge offenbaren. Nicht die t- irgendwie
verstandene — Übereinstimmung mit einem .Gegenstand' steht für
ihre Behauptungen in Frage, sondern daß diese den adäquaten Aus-
druck für das Sein des Philosophen selbst, für den in ihm lebenden
Menschheitstypus darstellten — sei es, daß dieser eine bestimmte Kate-
gorie von Individuen umschriebe, sei es, daß er ein, in irgendeinem
Maße in jedem Individuum vorhandenes Element bildete«. »Piatos
Ideenlehre, Pantheismus der Stoiker und Spinozas, Fichtes weltschöpfe-
risches Ich, Schellings Lehre von der Identität von Natur und Geist,
Schopenhauers Willensmetaphysik, — alles dieses ist oft und bündig
.widerlegt'; allein der jeweilige menschliche Typus, der in diesen
Irrtümern' seine Reaktion auf das Dasein niedergelegt hat, hat alle
Widerlegungen überlebt und jenen Lehren eine in seinem eigenen
hatte den Charakter der Objektivität. Nicht nur einzelne Lebensinhalte
waren ihm objektiv geworden, sondern sozusagen der Lebensprozeß
selbst — er bedurfte für diese Objektivität nicht mehr der Form des
Gegenüber«. So geht durch das Goethesche Leben von sehr früh
an ein Zug von Resignation, »dem er oft Ausdruck und Nachdruck
gibt. Der Sinn aber dieses Verzichtens in dem allgemeinsten, sein
Leben durchziehenden Sinne scheint mir kein anderer zu sein, als daß
ihm nur auf diesem Wege jene Objektivierung seines Subjekts gelang.
Er mußte sich dauernd überwinden, damit die Intensität, die unmittel-
bare, selig-unselige Strömung seines Lebens gegenständlich werden
konnte«. Nein, jene Objektivation war Simmel nicht verliehen. Ich
spreche dies nicht als Tadel aus, sondern lediglich zur Charakteristik.
Das Skizzenhafte, Fragmentarische, Unabgeschlossene, die ewige
Melodie, die nur unterbrochen werden kann, ohne aber von sich aus
den klärenden, harmonischen Ausklang zu gewinnen, sie wurzeln in
jener Eigentümlichkeit Simmeis. Und darum ist er kein Piaton oder
Aristoteles, sondern ein Sokrates, der aus bedrängter Unruhe des
Herzens immer wieder fragt, der nichts zu wissen behauptet und doch
an allem rüttelt, der mit dem Bildhauer Kleiton über Kunst streitet und
mit jedem anderen gerade über das Problem, das zunächst ins Auge
fällt, der aber nicht geistig verfließt in die verstrickende Vielheit der
Fragen, sondern durch sie die Einheit seiner Persönlichkeit immer reiner
gestaltet. Denn hier ist Philosophieren Lebenshaltung und Lebensform
Tiefste Wesenssaiten Simmeis erklingen, wenn er diese Art des
Philosophierens versucht zu umschreiben, zu rechtfertigen und zu ver-
teidigen. Denn hier kämpft er für das Eigenrecht seiner Persönlich-
keit. Nach ihm soll die Philosophie nicht die Objektivität der Dinge
nachzeichnen, »das tun die ,Wissenschaften' im engeren Sinne, sondern
die Typen der menschlichen Geistigkeit, wie sie sich je an einer be-
stimmten Auffassung der Dinge offenbaren. Nicht die t- irgendwie
verstandene — Übereinstimmung mit einem .Gegenstand' steht für
ihre Behauptungen in Frage, sondern daß diese den adäquaten Aus-
druck für das Sein des Philosophen selbst, für den in ihm lebenden
Menschheitstypus darstellten — sei es, daß dieser eine bestimmte Kate-
gorie von Individuen umschriebe, sei es, daß er ein, in irgendeinem
Maße in jedem Individuum vorhandenes Element bildete«. »Piatos
Ideenlehre, Pantheismus der Stoiker und Spinozas, Fichtes weltschöpfe-
risches Ich, Schellings Lehre von der Identität von Natur und Geist,
Schopenhauers Willensmetaphysik, — alles dieses ist oft und bündig
.widerlegt'; allein der jeweilige menschliche Typus, der in diesen
Irrtümern' seine Reaktion auf das Dasein niedergelegt hat, hat alle
Widerlegungen überlebt und jenen Lehren eine in seinem eigenen