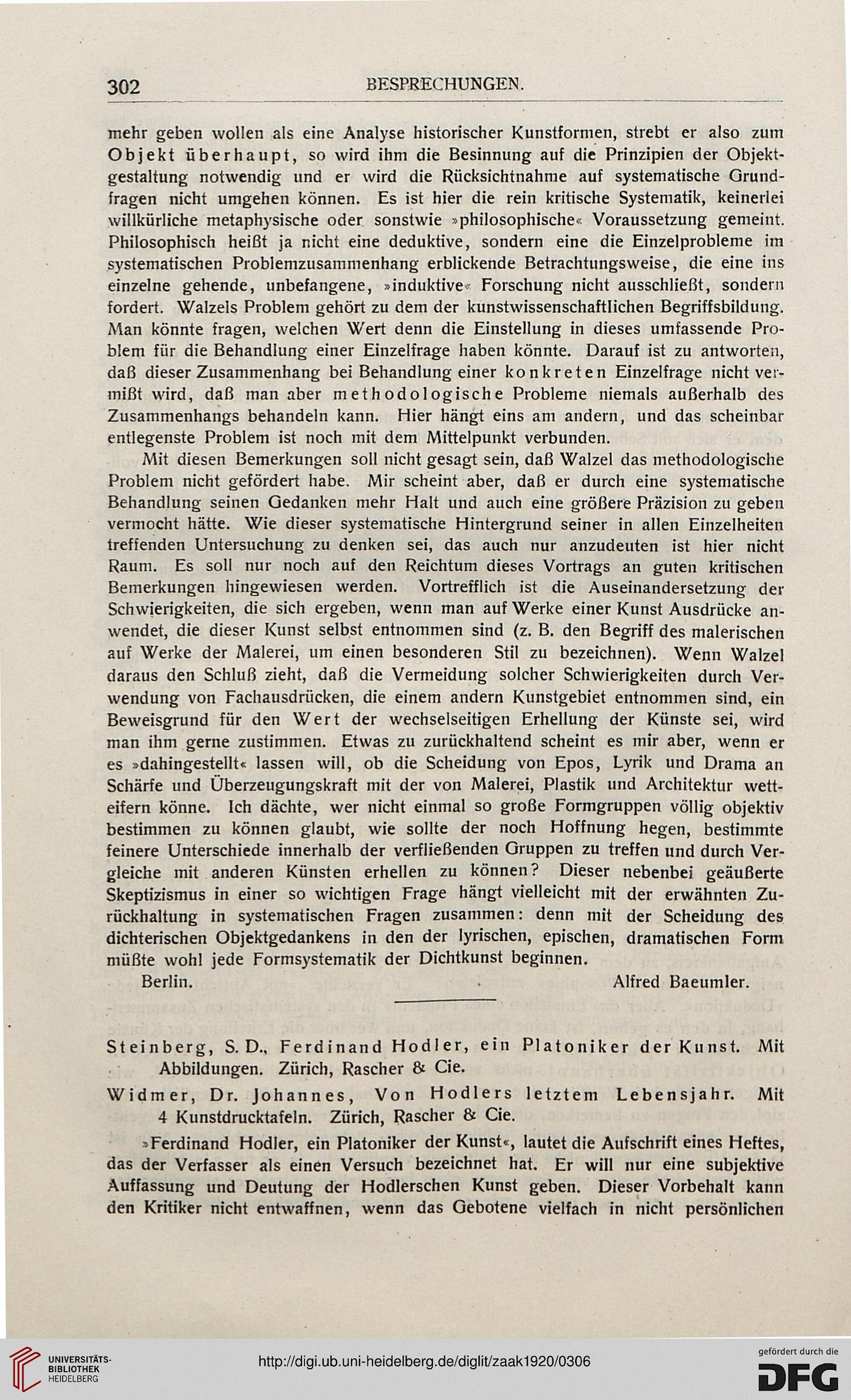302 BESPRECHUNGEN.
mehr geben wollen als eine Analyse historischer Kunstformeii, strebt er also zum
Objekt überhaupt, so wird ihm die Besinnung auf die Prinzipien der Objekt-
gestaltung notwendig und er wird die Rücksichtnahme auf systematische Grund-
fragen nicht umgehen können. Es ist hier die rein kritische Systematik, keinerlei
willkürliche metaphysische oder sonstwie »philosophische« Voraussetzung gemeint.
Philosophisch heißt ja nicht eine deduktive, sondern eine die Einzelprobleme im
systematischen Problemzusammenhang erblickende Betrachtungsweise, die eine ins
einzelne gehende, unbefangene, »induktive^ Forschung nicht ausschließt, sondern
fordert. Walzels Problem gehört zu dem der kunstwissenschaftlichen Begriffsbildung.
Man könnte fragen, welchen Wert denn die Einstellung in dieses umfassende Pro-
blem für die Behandlung einer Einzelfrage haben könnte. Darauf ist zu antworten,
daß dieser Zusammenhang bei Behandlung einer konkreten Einzelfrage nicht ver-
mißt wird, daß man aber methodologische Probleme niemals außerhalb des
Zusammenhangs behandeln kann. Hier hängt eins am andern, und das scheinbar
entlegenste Problem ist noch mit dem Mittelpunkt verbunden.
Mit diesen Bemerkungen soll nicht gesagt sein, daß Walzel das methodologische
Problem nicht gefördert habe. Mir scheint aber, daß er durch eine systematische
Behandlung seinen Gedanken mehr Halt und auch eine größere Präzision zu geben
vermocht hätte. Wie dieser systematische Hintergrund seiner in allen Einzelheiten
treffenden Untersuchung zu denken sei, das auch nur anzudeuten ist hier nicht
Raum. Es soll nur noch auf den Reichtum dieses Vortrags an guten kritischen
Bemerkungen hingewiesen werden. Vortrefflich ist die Auseinandersetzung der
Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn man auf Werke einer Kunst Ausdrücke an-
wendet, die dieser Kunst selbst entnommen sind (z. B. den Begriff des malerischen
auf Werke der Malerei, um einen besonderen Stil zu bezeichnen). Wenn Walzel
daraus den Schluß zieht, daß die Vermeidung solcher Schwierigkeiten durch Ver-
wendung von Fachausdrücken, die einem andern Kunstgebiet entnommen sind, ein
Beweisgrund für den Wert der wechselseitigen Erhellung der Künste sei, wird
man ihm gerne zustimmen. Etwas zu zurückhaltend scheint es mir aber, wenn er
es »dahingestellt« lassen will, ob die Scheidung von Epos, Lyrik und Drama an
Schärfe und Überzeugungskraft mit der von Malerei, Plastik und Architektur wett-
eifern könne. Ich dächte, wer nicht einmal so große Formgruppen völlig objektiv
bestimmen zu können glaubt, wie sollte der noch Hoffnung hegen, bestimmte
feinere Unterschiede innerhalb der verfließenden Gruppen zu treffen und durch Ver-
gleiche mit anderen Künsten erhellen zu können? Dieser nebenbei geäußerte
Skeptizismus in einer so wichtigen Frage hängt vielleicht mit der erwähnten Zu-
rückhaltung in systematischen Fragen zusammen: denn mit der Scheidung des
dichterischen Objektgedankens in den der lyrischen, epischen, dramatischen Form
müßte wohl jede Formsystematik der Dichtkunst beginnen.
Berlin. . Alfred Baeumler.
Steinberg, S.D., Ferdinand Hodler, ein Platoniker der Kunst. Mit
Abbildungen. Zürich, Rascher & Cie.
Widmer, Dr. Johannes, Von Hodlers letztem Lebensjahr. Mit
4 Kunstdrucktafeln. Zürich, Rascher & Cie.
»Ferdinand Hodler, ein Platoniker der Kunst«, lautet die Aufschrift eines Heftes,
das der Verfasser als einen Versuch bezeichnet hat. Er will nur eine subjektive
Auffassung und Deutung der Hodlerschen Kunst geben. Dieser Vorbehalt kann
den Kritiker nicht entwaffnen, wenn das Gebotene vielfach in nicht persönlichen
mehr geben wollen als eine Analyse historischer Kunstformeii, strebt er also zum
Objekt überhaupt, so wird ihm die Besinnung auf die Prinzipien der Objekt-
gestaltung notwendig und er wird die Rücksichtnahme auf systematische Grund-
fragen nicht umgehen können. Es ist hier die rein kritische Systematik, keinerlei
willkürliche metaphysische oder sonstwie »philosophische« Voraussetzung gemeint.
Philosophisch heißt ja nicht eine deduktive, sondern eine die Einzelprobleme im
systematischen Problemzusammenhang erblickende Betrachtungsweise, die eine ins
einzelne gehende, unbefangene, »induktive^ Forschung nicht ausschließt, sondern
fordert. Walzels Problem gehört zu dem der kunstwissenschaftlichen Begriffsbildung.
Man könnte fragen, welchen Wert denn die Einstellung in dieses umfassende Pro-
blem für die Behandlung einer Einzelfrage haben könnte. Darauf ist zu antworten,
daß dieser Zusammenhang bei Behandlung einer konkreten Einzelfrage nicht ver-
mißt wird, daß man aber methodologische Probleme niemals außerhalb des
Zusammenhangs behandeln kann. Hier hängt eins am andern, und das scheinbar
entlegenste Problem ist noch mit dem Mittelpunkt verbunden.
Mit diesen Bemerkungen soll nicht gesagt sein, daß Walzel das methodologische
Problem nicht gefördert habe. Mir scheint aber, daß er durch eine systematische
Behandlung seinen Gedanken mehr Halt und auch eine größere Präzision zu geben
vermocht hätte. Wie dieser systematische Hintergrund seiner in allen Einzelheiten
treffenden Untersuchung zu denken sei, das auch nur anzudeuten ist hier nicht
Raum. Es soll nur noch auf den Reichtum dieses Vortrags an guten kritischen
Bemerkungen hingewiesen werden. Vortrefflich ist die Auseinandersetzung der
Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn man auf Werke einer Kunst Ausdrücke an-
wendet, die dieser Kunst selbst entnommen sind (z. B. den Begriff des malerischen
auf Werke der Malerei, um einen besonderen Stil zu bezeichnen). Wenn Walzel
daraus den Schluß zieht, daß die Vermeidung solcher Schwierigkeiten durch Ver-
wendung von Fachausdrücken, die einem andern Kunstgebiet entnommen sind, ein
Beweisgrund für den Wert der wechselseitigen Erhellung der Künste sei, wird
man ihm gerne zustimmen. Etwas zu zurückhaltend scheint es mir aber, wenn er
es »dahingestellt« lassen will, ob die Scheidung von Epos, Lyrik und Drama an
Schärfe und Überzeugungskraft mit der von Malerei, Plastik und Architektur wett-
eifern könne. Ich dächte, wer nicht einmal so große Formgruppen völlig objektiv
bestimmen zu können glaubt, wie sollte der noch Hoffnung hegen, bestimmte
feinere Unterschiede innerhalb der verfließenden Gruppen zu treffen und durch Ver-
gleiche mit anderen Künsten erhellen zu können? Dieser nebenbei geäußerte
Skeptizismus in einer so wichtigen Frage hängt vielleicht mit der erwähnten Zu-
rückhaltung in systematischen Fragen zusammen: denn mit der Scheidung des
dichterischen Objektgedankens in den der lyrischen, epischen, dramatischen Form
müßte wohl jede Formsystematik der Dichtkunst beginnen.
Berlin. . Alfred Baeumler.
Steinberg, S.D., Ferdinand Hodler, ein Platoniker der Kunst. Mit
Abbildungen. Zürich, Rascher & Cie.
Widmer, Dr. Johannes, Von Hodlers letztem Lebensjahr. Mit
4 Kunstdrucktafeln. Zürich, Rascher & Cie.
»Ferdinand Hodler, ein Platoniker der Kunst«, lautet die Aufschrift eines Heftes,
das der Verfasser als einen Versuch bezeichnet hat. Er will nur eine subjektive
Auffassung und Deutung der Hodlerschen Kunst geben. Dieser Vorbehalt kann
den Kritiker nicht entwaffnen, wenn das Gebotene vielfach in nicht persönlichen