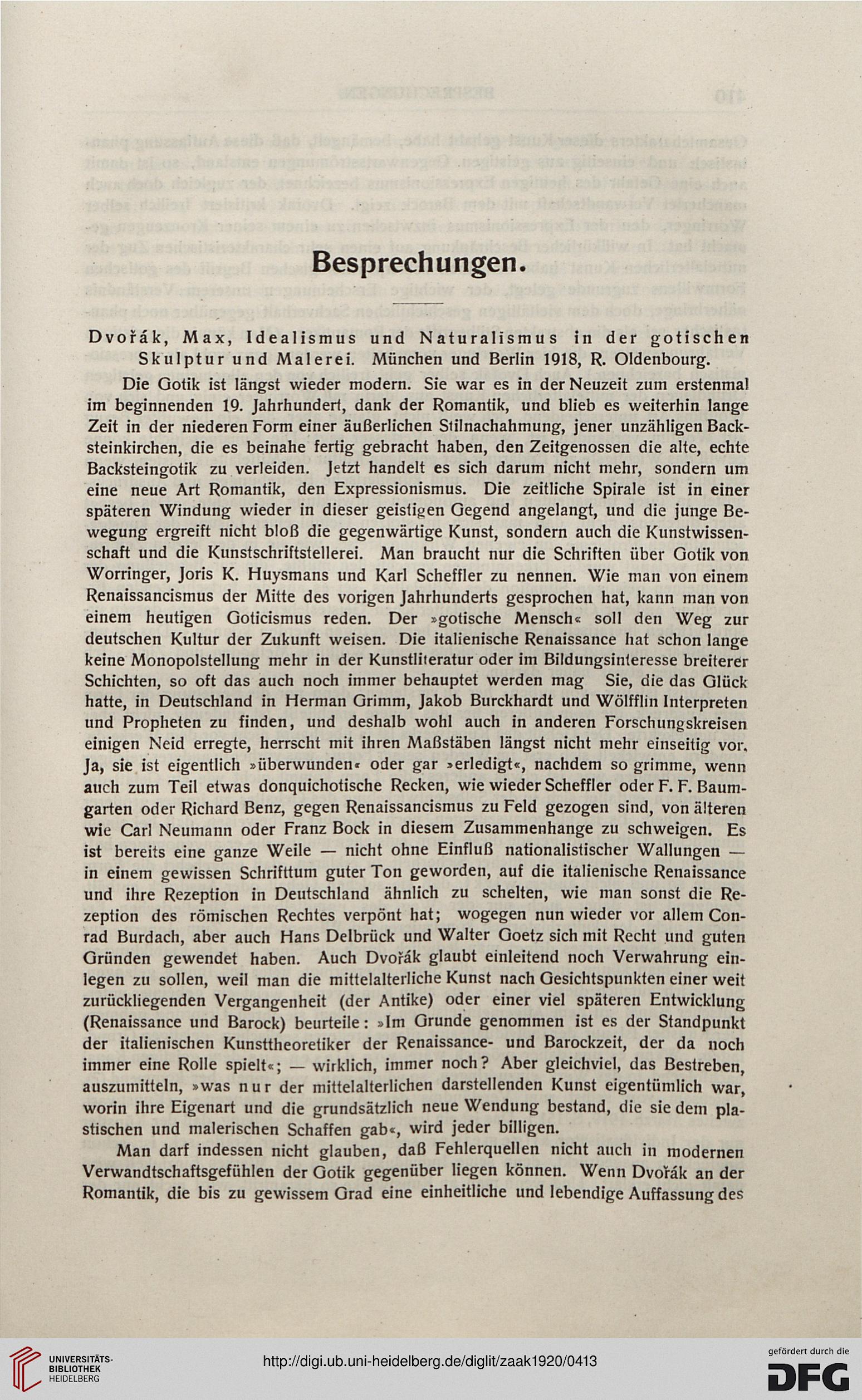Besprechungen.
Dvofäk, Max, Idealismus und Naturalismus in der gotischen
Skulptur und Malerei. München und Berlin 1918, R. Oldenbourg.
Die Gotik ist längst wieder modern. Sie war es in der Neuzeit zum erstenmal
im beginnenden 19. Jahrhundert, dank der Romantik, und blieb es weiterhin lange
Zeit in der niederen Form einer äußerlichen Stilnachahmung, jener unzähligen Back-
steinkirchen, die es beinahe fertig gebracht haben, den Zeitgenossen die alte, echte
Backsteingotik zu verleiden. Jetzt handelt es sich darum nicht mehr, sondern um
eine neue Art Romantik, den Expressionismus. Die zeitliche Spirale ist in einer
späteren Windung wieder in dieser geistigen Gegend angelangt, und die junge Be-
wegung ergreift nicht bloß die gegenwärtige Kunst, sondern auch die Kunstwissen-
schaft und die Knnstschriftstellerei. Man braucht nur die Schriften über Gotik von
Worringer, Joris K. Huysmans und Karl Scheffler zu nennen. Wie man von einem
Renaissancismus der Mitte des vorigen Jahrhunderts gesprochen hat, kann man von
einem heutigen Goticismus reden. Der »gotische Mensch« soll den Weg zur
deutschen Kultur der Zukunft weisen. Die italienische Renaissance hat schon lange
keine Monopolstellung mehr in der Kunstliieratur oder im Bildungsinteresse breiterer
Schichten, so oft das auch noch immer behauptet werden mag Sie, die das Glück
hatte, in Deutschland in Herman Grimm, Jakob Burckhardt und Wölfflin Interpreten
und Propheten zu finden, und deshalb wohl auch in anderen Forschungskreisen
einigen Neid erregte, herrscht mit ihren Maßstäben längst nicht mehr einseitig vor.
Ja, sie ist eigentlich »überwunden« oder gar »erledigt«, nachdem so grimme, wenn
auch zum Teil etwas donquichotische Recken, wie wieder Scheffler oder F. F. Baum-
garten oder Richard Benz, gegen Renaissancismus zu Feld gezogen sind, von älteren
wie Carl Neumann oder Franz Bock in diesem Zusammenhange zu schweigen. Es
ist bereits eine ganze Weile — nicht ohne Einfluß nationalistischer Wallungen —
in einem gewissen Schrifttum guter Ton geworden, auf die italienische Renaissance
und ihre Rezeption in Deutschland ähnlich zu schelten, wie man sonst die Re-
zeption des römischen Rechtes verpönt hat; wogegen nun wieder vor allem Con-
rad Burdach, aber auch Hans Delbrück und Walter Goetz sich mit Recht und guten
Gründen gewendet haben. Auch Dvofäk glaubt einleitend noch Verwahrung ein-
legen zu sollen, weil man die mittelalterliche Kunst nach Gesichtspunkten einer weit
zurückliegenden Vergangenheit (der Antike) oder einer viel späteren Entwicklung
(Renaissance und Barock) beurteile: »Im Grunde genommen ist es der Standpunkt
der italienischen Kunsttheoretiker der Renaissance- und Barockzeit, der da noch
immer eine Rolle spielt«; — wirklich, immer noch? Aber gleichviel, das Bestreben,
auszumitteln, »was nur der mittelalterlichen darstellenden Kunst eigentümlich war,
worin ihre Eigenart und die grundsätzlich neue Wendung bestand, die sie dem pla-
stischen und malerischen Schaffen gab«, wird jeder billigen.
Man darf indessen nicht glauben, daß Fehlerquellen nicht auch in modernen
Verwandtschaftsgefühlen der Gotik gegenüber liegen können. Wenn Dvorak an der
Romantik, die bis zu gewissem Grad eine einheitliche und lebendige Auffassung des
Dvofäk, Max, Idealismus und Naturalismus in der gotischen
Skulptur und Malerei. München und Berlin 1918, R. Oldenbourg.
Die Gotik ist längst wieder modern. Sie war es in der Neuzeit zum erstenmal
im beginnenden 19. Jahrhundert, dank der Romantik, und blieb es weiterhin lange
Zeit in der niederen Form einer äußerlichen Stilnachahmung, jener unzähligen Back-
steinkirchen, die es beinahe fertig gebracht haben, den Zeitgenossen die alte, echte
Backsteingotik zu verleiden. Jetzt handelt es sich darum nicht mehr, sondern um
eine neue Art Romantik, den Expressionismus. Die zeitliche Spirale ist in einer
späteren Windung wieder in dieser geistigen Gegend angelangt, und die junge Be-
wegung ergreift nicht bloß die gegenwärtige Kunst, sondern auch die Kunstwissen-
schaft und die Knnstschriftstellerei. Man braucht nur die Schriften über Gotik von
Worringer, Joris K. Huysmans und Karl Scheffler zu nennen. Wie man von einem
Renaissancismus der Mitte des vorigen Jahrhunderts gesprochen hat, kann man von
einem heutigen Goticismus reden. Der »gotische Mensch« soll den Weg zur
deutschen Kultur der Zukunft weisen. Die italienische Renaissance hat schon lange
keine Monopolstellung mehr in der Kunstliieratur oder im Bildungsinteresse breiterer
Schichten, so oft das auch noch immer behauptet werden mag Sie, die das Glück
hatte, in Deutschland in Herman Grimm, Jakob Burckhardt und Wölfflin Interpreten
und Propheten zu finden, und deshalb wohl auch in anderen Forschungskreisen
einigen Neid erregte, herrscht mit ihren Maßstäben längst nicht mehr einseitig vor.
Ja, sie ist eigentlich »überwunden« oder gar »erledigt«, nachdem so grimme, wenn
auch zum Teil etwas donquichotische Recken, wie wieder Scheffler oder F. F. Baum-
garten oder Richard Benz, gegen Renaissancismus zu Feld gezogen sind, von älteren
wie Carl Neumann oder Franz Bock in diesem Zusammenhange zu schweigen. Es
ist bereits eine ganze Weile — nicht ohne Einfluß nationalistischer Wallungen —
in einem gewissen Schrifttum guter Ton geworden, auf die italienische Renaissance
und ihre Rezeption in Deutschland ähnlich zu schelten, wie man sonst die Re-
zeption des römischen Rechtes verpönt hat; wogegen nun wieder vor allem Con-
rad Burdach, aber auch Hans Delbrück und Walter Goetz sich mit Recht und guten
Gründen gewendet haben. Auch Dvofäk glaubt einleitend noch Verwahrung ein-
legen zu sollen, weil man die mittelalterliche Kunst nach Gesichtspunkten einer weit
zurückliegenden Vergangenheit (der Antike) oder einer viel späteren Entwicklung
(Renaissance und Barock) beurteile: »Im Grunde genommen ist es der Standpunkt
der italienischen Kunsttheoretiker der Renaissance- und Barockzeit, der da noch
immer eine Rolle spielt«; — wirklich, immer noch? Aber gleichviel, das Bestreben,
auszumitteln, »was nur der mittelalterlichen darstellenden Kunst eigentümlich war,
worin ihre Eigenart und die grundsätzlich neue Wendung bestand, die sie dem pla-
stischen und malerischen Schaffen gab«, wird jeder billigen.
Man darf indessen nicht glauben, daß Fehlerquellen nicht auch in modernen
Verwandtschaftsgefühlen der Gotik gegenüber liegen können. Wenn Dvorak an der
Romantik, die bis zu gewissem Grad eine einheitliche und lebendige Auffassung des