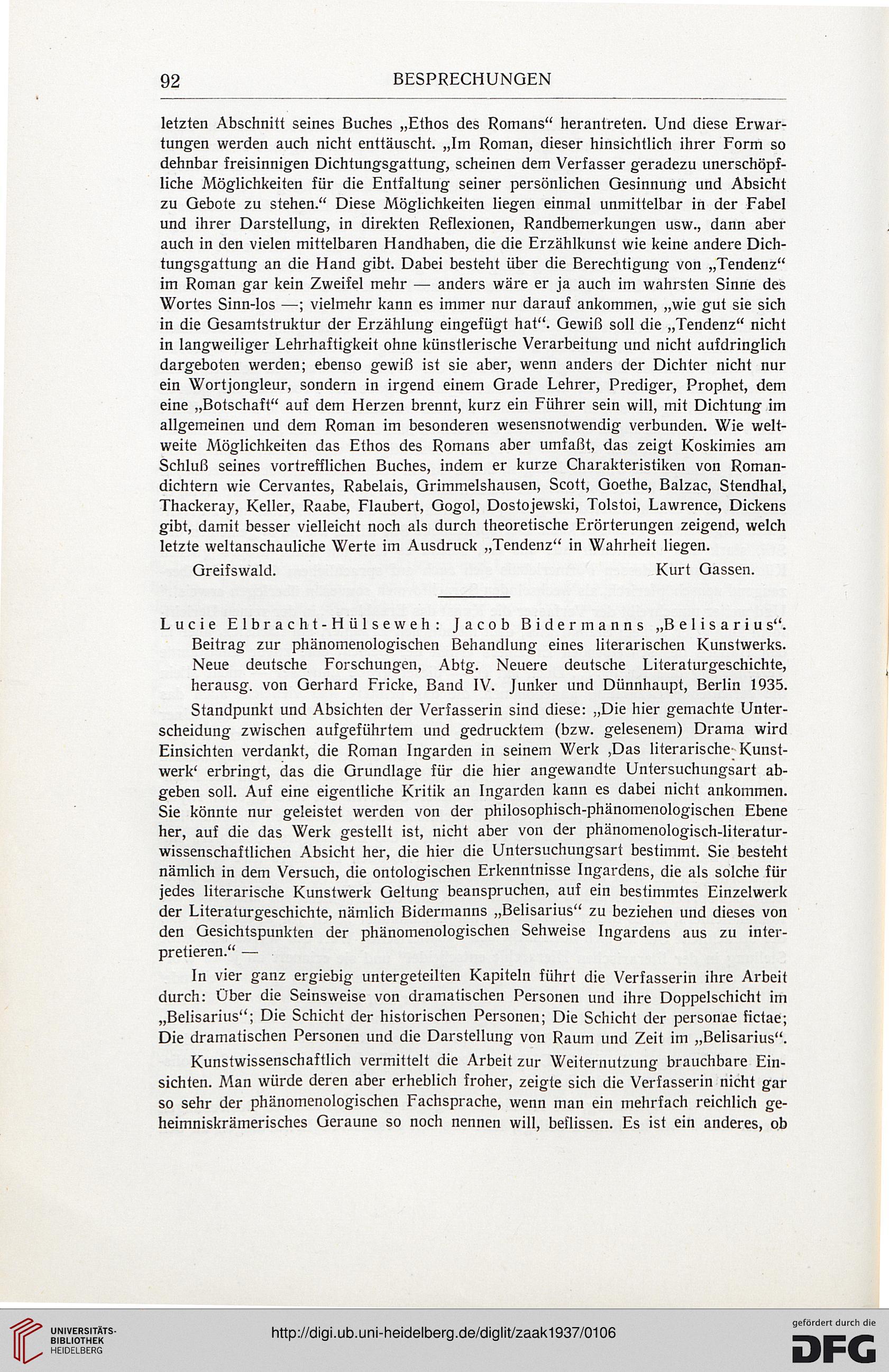92
BESPRECHUNGEN
letzten Abschnitt seines Buches „Ethos des Romans" herantreten. Und diese Erwar-
tungen werden auch nicht enttäuscht. „Im Roman, dieser hinsichtlich ihrer Form so
dehnbar freisinnigen Dichtungsgattung, scheinen dem Verfasser geradezu unerschöpf-
liche Möglichkeiten für die Entfaltung seiner persönlichen Gesinnung und Absicht
zu Gebote zu stehen." Diese Möglichkeiten liegen einmal unmittelbar in der Fabel
und ihrer Darstellung, in direkten Reflexionen, Randbemerkungen usw., dann aber
auch in den vielen mittelbaren Handhaben, die die Erzählkunst wie keine andere Dich-
tungsgattung an die Hand gibt. Dabei besteht über die Berechtigung von „Tendenz"
im Roman gar kein Zweifel mehr — anders wäre er ja auch im wahrsten Sinne des
Wortes Sinn-los —; vielmehr kann es immer nur darauf ankommen, „wie gut sie sich
in die Gesamtstruktur der Erzählung eingefügt hat". Gewiß soll die „Tendenz" nicht
in langweiliger Lehrhaftigkeit ohne künstlerische Verarbeitung und nicht aufdringlich
dargeboten werden; ebenso gewiß ist sie aber, wenn anders der Dichter nicht nur
ein Wortjongleur, sondern in irgend einem Grade Lehrer, Prediger, Prophet, dem
eine „Botschaft" auf dem Herzen brennt, kurz ein Führer sein will, mit Dichtung im
allgemeinen und dem Roman im besonderen wesensnotwendig verbunden. Wie welt-
weite Möglichkeiten das Ethos des Romans aber umfaßt, das zeigt Koskimies am
Schluß seines vortrefflichen Buches, indem er kurze Charakteristiken von Roman-
dichtern wie Cervantes, Rabelais, Grimmelshausen, Scott, Goethe, Balzac, Stendhal,
Thackeray, Keller, Raabe, Flaubert, Gogol, Dostojewski, Tolstoi, Lawrence, Dickens
gibt, damit besser vielleicht noch als durch theoretische Erörterungen zeigend, welch
letzte weltanschauliche Werte im Ausdruck „Tendenz" in Wahrheit liegen.
Greifswald. Kurt Gassen.
Lucie Elbracht-Hülseweh: Jacob Bidermanns „B e 1 i s a r i u s".
Beitrag zur phänomenologischen Behandlung eines literarischen Kunstwerks.
Neue deutsche Forschungen, Abtg. Neuere deutsche Literaturgeschichte,
herausg. von Gerhard Fricke, Band IV. Junker und Dünnhaupt, Berlin 1935.
Standpunkt und Absichten der Verfasserin sind diese: „Die hier gemachte Unter-
scheidung zwischen aufgeführtem und gedrucktem (bzw. gelesenem) Drama wird
Einsichten verdankt, die Roman Ingarden in seinem Werk ,Das literarische-Kunst-
werk' erbringt, das die Grundlage für die hier angewandte Untersuchungsart ab-
geben soll. Auf eine eigentliche Kritik an Ingarden kann es dabei nicht ankommen.
Sie könnte nur geleistet werden von der philosophisch-phänomenologischen Ebene
her, auf die das Werk gestellt ist, nicht aber von der phänomenologisch-literatur-
wissenschaftlichen Absicht her, die hier die Untersuchungsart bestimmt. Sie besteht
nämlich in dem Versuch, die ontologischen Erkenntnisse Ingardens, die als solche für
jedes literarische Kunstwerk Geltung beanspruchen, auf ein bestimmtes Einzelwerk
der Literaturgeschichte, nämlich Bidermanns „Belisarius" zu beziehen und dieses von
den Gesichtspunkten der phänomenologischen Sehweise Ingardens aus zu inter-
pretieren." —
In vier ganz ergiebig untergeteilten Kapiteln führt die Verfasserin ihre Arbeit
durch: Über die Seinsweise von dramatischen Personen und ihre Doppelschicht im
„Belisarius"; Die Schicht der historischen Personen; Die Schicht der personae h'ctae;
Die dramatischen Personen und die Darstellung von Raum und Zeit im „Belisarius".
Kunstwissenschaftlich vermittelt die Arbeit zur Weiternutzung brauchbare Ein-
sichten. Man würde deren aber erheblich froher, zeigte sich die Verfasserin nicht gar
so sehr der phänomenologischen Fachsprache, wenn man ein mehrfach reichlich ge-
heimniskrämerisches Geraune so noch nennen will, beflissen. Es ist ein anderes, ob
BESPRECHUNGEN
letzten Abschnitt seines Buches „Ethos des Romans" herantreten. Und diese Erwar-
tungen werden auch nicht enttäuscht. „Im Roman, dieser hinsichtlich ihrer Form so
dehnbar freisinnigen Dichtungsgattung, scheinen dem Verfasser geradezu unerschöpf-
liche Möglichkeiten für die Entfaltung seiner persönlichen Gesinnung und Absicht
zu Gebote zu stehen." Diese Möglichkeiten liegen einmal unmittelbar in der Fabel
und ihrer Darstellung, in direkten Reflexionen, Randbemerkungen usw., dann aber
auch in den vielen mittelbaren Handhaben, die die Erzählkunst wie keine andere Dich-
tungsgattung an die Hand gibt. Dabei besteht über die Berechtigung von „Tendenz"
im Roman gar kein Zweifel mehr — anders wäre er ja auch im wahrsten Sinne des
Wortes Sinn-los —; vielmehr kann es immer nur darauf ankommen, „wie gut sie sich
in die Gesamtstruktur der Erzählung eingefügt hat". Gewiß soll die „Tendenz" nicht
in langweiliger Lehrhaftigkeit ohne künstlerische Verarbeitung und nicht aufdringlich
dargeboten werden; ebenso gewiß ist sie aber, wenn anders der Dichter nicht nur
ein Wortjongleur, sondern in irgend einem Grade Lehrer, Prediger, Prophet, dem
eine „Botschaft" auf dem Herzen brennt, kurz ein Führer sein will, mit Dichtung im
allgemeinen und dem Roman im besonderen wesensnotwendig verbunden. Wie welt-
weite Möglichkeiten das Ethos des Romans aber umfaßt, das zeigt Koskimies am
Schluß seines vortrefflichen Buches, indem er kurze Charakteristiken von Roman-
dichtern wie Cervantes, Rabelais, Grimmelshausen, Scott, Goethe, Balzac, Stendhal,
Thackeray, Keller, Raabe, Flaubert, Gogol, Dostojewski, Tolstoi, Lawrence, Dickens
gibt, damit besser vielleicht noch als durch theoretische Erörterungen zeigend, welch
letzte weltanschauliche Werte im Ausdruck „Tendenz" in Wahrheit liegen.
Greifswald. Kurt Gassen.
Lucie Elbracht-Hülseweh: Jacob Bidermanns „B e 1 i s a r i u s".
Beitrag zur phänomenologischen Behandlung eines literarischen Kunstwerks.
Neue deutsche Forschungen, Abtg. Neuere deutsche Literaturgeschichte,
herausg. von Gerhard Fricke, Band IV. Junker und Dünnhaupt, Berlin 1935.
Standpunkt und Absichten der Verfasserin sind diese: „Die hier gemachte Unter-
scheidung zwischen aufgeführtem und gedrucktem (bzw. gelesenem) Drama wird
Einsichten verdankt, die Roman Ingarden in seinem Werk ,Das literarische-Kunst-
werk' erbringt, das die Grundlage für die hier angewandte Untersuchungsart ab-
geben soll. Auf eine eigentliche Kritik an Ingarden kann es dabei nicht ankommen.
Sie könnte nur geleistet werden von der philosophisch-phänomenologischen Ebene
her, auf die das Werk gestellt ist, nicht aber von der phänomenologisch-literatur-
wissenschaftlichen Absicht her, die hier die Untersuchungsart bestimmt. Sie besteht
nämlich in dem Versuch, die ontologischen Erkenntnisse Ingardens, die als solche für
jedes literarische Kunstwerk Geltung beanspruchen, auf ein bestimmtes Einzelwerk
der Literaturgeschichte, nämlich Bidermanns „Belisarius" zu beziehen und dieses von
den Gesichtspunkten der phänomenologischen Sehweise Ingardens aus zu inter-
pretieren." —
In vier ganz ergiebig untergeteilten Kapiteln führt die Verfasserin ihre Arbeit
durch: Über die Seinsweise von dramatischen Personen und ihre Doppelschicht im
„Belisarius"; Die Schicht der historischen Personen; Die Schicht der personae h'ctae;
Die dramatischen Personen und die Darstellung von Raum und Zeit im „Belisarius".
Kunstwissenschaftlich vermittelt die Arbeit zur Weiternutzung brauchbare Ein-
sichten. Man würde deren aber erheblich froher, zeigte sich die Verfasserin nicht gar
so sehr der phänomenologischen Fachsprache, wenn man ein mehrfach reichlich ge-
heimniskrämerisches Geraune so noch nennen will, beflissen. Es ist ein anderes, ob