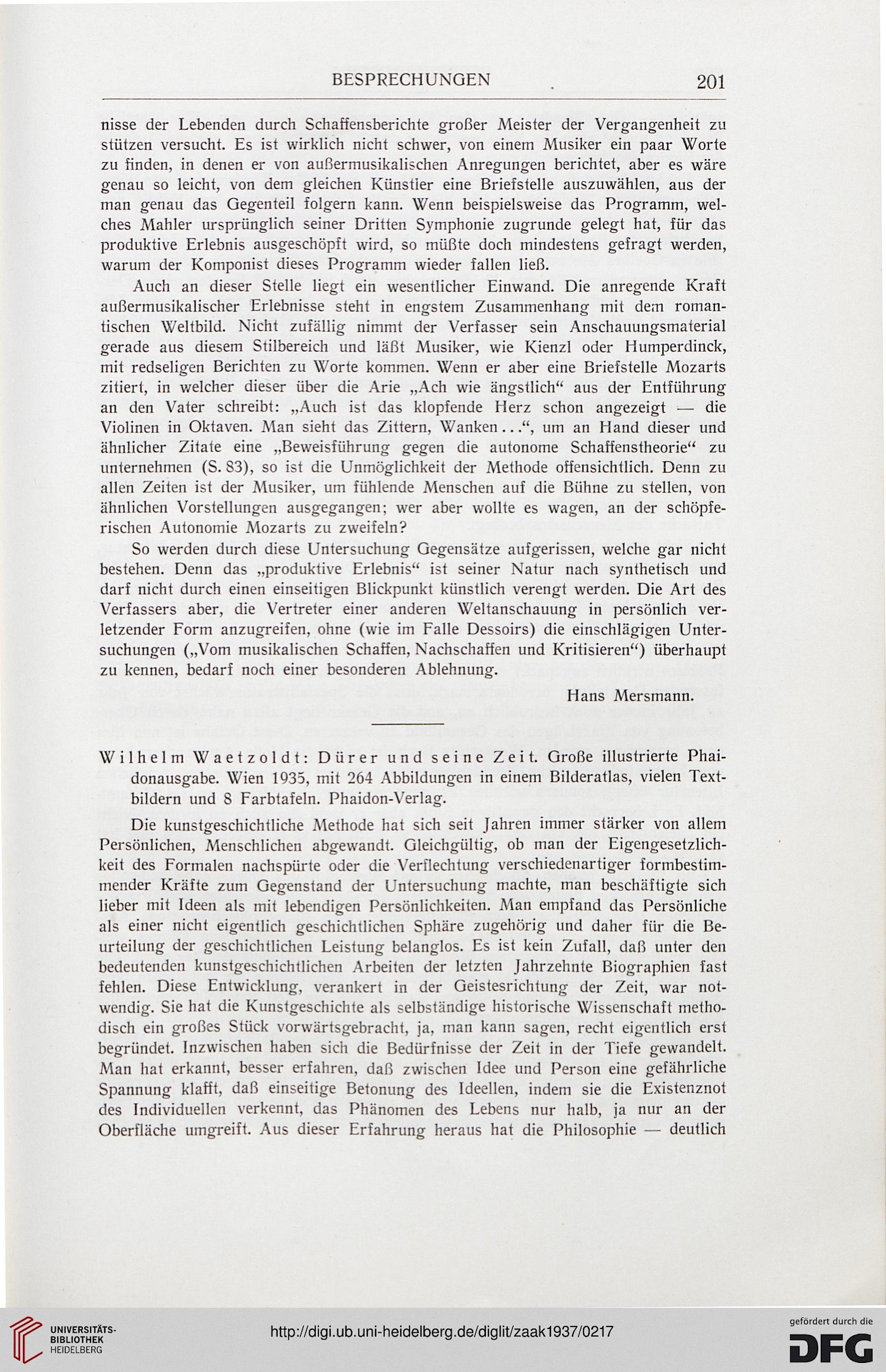BESPRECHUNGEN
201
nisse der Lebenden durch Schaffensberichte großer Meister der Vergangenheit zu
stützen versucht. Es ist wirklich nicht schwer, von einem Musiker ein paar Worte
zu finden, in denen er von außermusikalischen Anregungen berichtet, aber es wäre
genau so leicht, von dem gleichen Künstler eine Briefstelle auszuwählen, aus der
man genau das Gegenteil folgern kann. Wenn beispielsweise das Programm, wel-
ches Mahler ursprünglich seiner Dritten Symphonie zugrunde gelegt hat, für das
produktive Erlebnis ausgeschöpft wird, so müßte doch mindestens gefragt werden,
warum der Komponist dieses Programm wieder fallen ließ.
Auch an dieser Stelle liegt ein wesentlicher Einwand. Die anregende Kraft
außermusikalischer Erlebnisse steht in engstem Zusammenhang mit dem roman-
tischen Weltbild. Nicht zufällig nimmt der Verfasser sein Anschauungsmaterial
gerade aus diesem Stilbereich und läßt Musiker, wie Kienzl oder Humperdinck,
mit redseligen Berichten zu Worte kommen. Wenn er aber eine Briefstelle Mozarts
zitiert, in welcher dieser über die Arie „Ach wie ängstlich" aus der Entführung
an den Vater schreibt: „Auch ist das klopfende Herz schon angezeigt — die
Violinen in Oktaven. Man sieht das Zittern, Wanken...", um an Hand dieser und
ähnlicher Zitate eine „Beweisführung gegen die autonome Schaffenstheorie" zu
unternehmen (S. 83), so ist die Unmöglichkeit der Methode offensichtlich. Denn zu
allen Zeiten ist der Musiker, um fühlende Menschen auf die Bühne zu stellen, von
ähnlichen Vorstellungen ausgegangen; wer aber wollte es wagen, an der schöpfe-
rischen Autonomie Mozarts zu zweifeln?
So werden durch diese Untersuchung Gegensätze aufgerissen, welche gar nicht
bestehen. Denn das „produktive Erlebnis" ist seiner Natur nach synthetisch und
darf nicht durch einen einseitigen Blickpunkt künstlich verengt werden. Die Art des
Verfassers aber, die Vertreter einer anderen Weltanschauung in persönlich ver-
letzender Form anzugreifen, ohne (wie im Falle Dessoirs) die einschlägigen Unter-
suchungen („Vom musikalischen Schaffen, Nachschaffen und Kritisieren") überhaupt
zu kennen, bedarf noch einer besonderen Ablehnung.
Hans Mersmann.
Wilhelm Waetzoldt: Dürer und seine Zeit. Große illustrierte Phai-
donausgabe. Wien 1Q35, mit 264 Abbildungen in einem Bilderatlas, vielen Text-
bildern und 8 Farbtafeln. Phaidon-Verlag.
Die kunstgeschichtliche Methode hat sich seit Jahren immer stärker von allem
Persönlichen, Menschlichen abgewandt. Gleichgültig, ob man der Eigengesetzlich-
keit des Formalen nachspürte oder die Verflechtung verschiedenartiger formbestim-
inender Kräfte zum Gegenstand der Untersuchung machte, man beschäftigte sich
lieber mit Ideen als mit lebendigen Persönlichkeiten. Man empfand das Persönliche
als einer nicht eigentlich geschichtlichen Sphäre zugehörig und daher für die Be-
urteilung der geschichtlichen Leistung belanglos. Es ist kein Zufall, daß unter den
bedeutenden kunstgeschichtlichen Arbeiten der letzten Jahrzehnte Biographien fast
fehlen. Diese Entwicklung, verankert in der Geistesrichtung der Zeit, war not-
wendig. Sie hat die Kunstgeschichte als selbständige historische Wissenschaft metho-
disch ein großes Stück vorwärtsgebracht, ja, man kann sagen, recht eigentlich erst
begründet. Inzwischen haben sich die Bedürfnisse der Zeit in der Tiefe gewandelt.
Alan hat erkannt, besser erfahren, daß zwischen Idee und Person eine gefährliche
Spannung klafft, daß einseitige Betonung des Ideellen, indem sie die Existenznot
des Individuellen verkennt, das Phänomen des Lebens nur halb, ja nur an der
Oberfläche umgreift. Aus dieser Erfahrung heraus hat die Philosophie — deutlich
201
nisse der Lebenden durch Schaffensberichte großer Meister der Vergangenheit zu
stützen versucht. Es ist wirklich nicht schwer, von einem Musiker ein paar Worte
zu finden, in denen er von außermusikalischen Anregungen berichtet, aber es wäre
genau so leicht, von dem gleichen Künstler eine Briefstelle auszuwählen, aus der
man genau das Gegenteil folgern kann. Wenn beispielsweise das Programm, wel-
ches Mahler ursprünglich seiner Dritten Symphonie zugrunde gelegt hat, für das
produktive Erlebnis ausgeschöpft wird, so müßte doch mindestens gefragt werden,
warum der Komponist dieses Programm wieder fallen ließ.
Auch an dieser Stelle liegt ein wesentlicher Einwand. Die anregende Kraft
außermusikalischer Erlebnisse steht in engstem Zusammenhang mit dem roman-
tischen Weltbild. Nicht zufällig nimmt der Verfasser sein Anschauungsmaterial
gerade aus diesem Stilbereich und läßt Musiker, wie Kienzl oder Humperdinck,
mit redseligen Berichten zu Worte kommen. Wenn er aber eine Briefstelle Mozarts
zitiert, in welcher dieser über die Arie „Ach wie ängstlich" aus der Entführung
an den Vater schreibt: „Auch ist das klopfende Herz schon angezeigt — die
Violinen in Oktaven. Man sieht das Zittern, Wanken...", um an Hand dieser und
ähnlicher Zitate eine „Beweisführung gegen die autonome Schaffenstheorie" zu
unternehmen (S. 83), so ist die Unmöglichkeit der Methode offensichtlich. Denn zu
allen Zeiten ist der Musiker, um fühlende Menschen auf die Bühne zu stellen, von
ähnlichen Vorstellungen ausgegangen; wer aber wollte es wagen, an der schöpfe-
rischen Autonomie Mozarts zu zweifeln?
So werden durch diese Untersuchung Gegensätze aufgerissen, welche gar nicht
bestehen. Denn das „produktive Erlebnis" ist seiner Natur nach synthetisch und
darf nicht durch einen einseitigen Blickpunkt künstlich verengt werden. Die Art des
Verfassers aber, die Vertreter einer anderen Weltanschauung in persönlich ver-
letzender Form anzugreifen, ohne (wie im Falle Dessoirs) die einschlägigen Unter-
suchungen („Vom musikalischen Schaffen, Nachschaffen und Kritisieren") überhaupt
zu kennen, bedarf noch einer besonderen Ablehnung.
Hans Mersmann.
Wilhelm Waetzoldt: Dürer und seine Zeit. Große illustrierte Phai-
donausgabe. Wien 1Q35, mit 264 Abbildungen in einem Bilderatlas, vielen Text-
bildern und 8 Farbtafeln. Phaidon-Verlag.
Die kunstgeschichtliche Methode hat sich seit Jahren immer stärker von allem
Persönlichen, Menschlichen abgewandt. Gleichgültig, ob man der Eigengesetzlich-
keit des Formalen nachspürte oder die Verflechtung verschiedenartiger formbestim-
inender Kräfte zum Gegenstand der Untersuchung machte, man beschäftigte sich
lieber mit Ideen als mit lebendigen Persönlichkeiten. Man empfand das Persönliche
als einer nicht eigentlich geschichtlichen Sphäre zugehörig und daher für die Be-
urteilung der geschichtlichen Leistung belanglos. Es ist kein Zufall, daß unter den
bedeutenden kunstgeschichtlichen Arbeiten der letzten Jahrzehnte Biographien fast
fehlen. Diese Entwicklung, verankert in der Geistesrichtung der Zeit, war not-
wendig. Sie hat die Kunstgeschichte als selbständige historische Wissenschaft metho-
disch ein großes Stück vorwärtsgebracht, ja, man kann sagen, recht eigentlich erst
begründet. Inzwischen haben sich die Bedürfnisse der Zeit in der Tiefe gewandelt.
Alan hat erkannt, besser erfahren, daß zwischen Idee und Person eine gefährliche
Spannung klafft, daß einseitige Betonung des Ideellen, indem sie die Existenznot
des Individuellen verkennt, das Phänomen des Lebens nur halb, ja nur an der
Oberfläche umgreift. Aus dieser Erfahrung heraus hat die Philosophie — deutlich