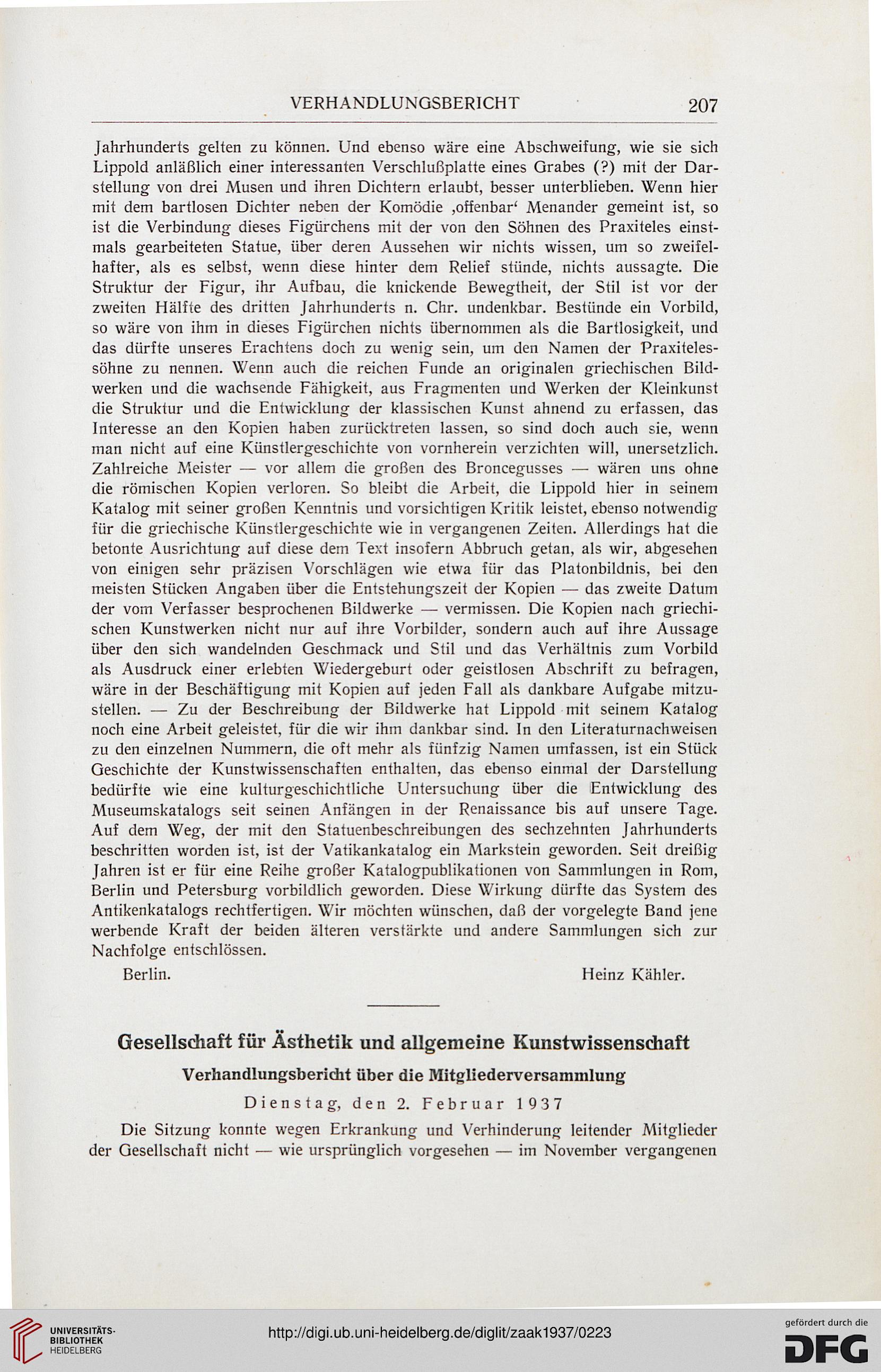VERHANDLUNGSBERICHT
207
Jahrhunderts gelten zu können. Und ebenso wäre eine Abschweifung, wie sie sich
Lippold anläßlich einer interessanten Verschlußplatte eines Grabes (?) mit der Dar-
stellung von drei Musen und ihren Dichtern erlaubt, besser unterblieben. Wenn hier
mit dem bartlosen Dichter neben der Komödie ,offenbar' Menander gemeint ist, so
ist die Verbindung dieses Figürchens mit der von den Söhnen des Praxiteles einst-
mals gearbeiteten Statue, über deren Aussehen wir nichts wissen, um so zweifel-
hafter, als es selbst, wenn diese hinter dem Relief stünde, nichts aussagte. Die
Struktur der Figur, ihr Aufbau, die knickende Bewegtheit, der Stil ist vor der
zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr. undenkbar. Bestünde ein Vorbild,
so wäre von ihm in dieses Figürchen nichts übernommen als die Bartlosigkeit, und
das dürfte unseres Erachtens doch zu wenig sein, um den Namen der Praxiteles-
söhne zu nennen. Wenn auch die reichen Funde an originalen griechischen Bild-
werken und die wachsende Fähigkeit, aus Fragmenten und Werken der Kleinkunst
die Struktur und die Entwicklung der klassischen Kunst ahnend zu erfassen, das
Interesse an den Kopien haben zurücktreten lassen, so sind doch auch sie, wenn
man nicht auf eine Künstlergeschichte von vornherein verzichten will, unersetzlich.
Zahlreiche Meister — vor allem die großen des Broncegusses — wären uns ohne
die römischen Kopien verloren. So bleibt die Arbeit, die Lippold hier in seinem
Katalog mit seiner großen Kenntnis und vorsichtigen Kritik leistet, ebenso notwendig
für die griechische Künstlergeschichte wie in vergangenen Zeiten. Allerdings hat die
betonte Ausrichtung auf diese dem Text insofern Abbruch getan, als wir, abgesehen
von einigen sehr präzisen Vorschlägen wie etwa für das Platonbildnis, bei den
meisten Stücken Angaben über die Entstehungszeit der Kopien — das zweite Datum
der vom Verfasser besprochenen Bildwerke — vermissen. Die Kopien nach griechi-
schen Kunstwerken nicht nur auf ihre Vorbilder, sondern auch auf ihre Aussage
über den sich wandelnden Geschmack und Stil und das Verhältnis zum Vorbild
als Ausdruck einer erlebten Wiedergeburt oder geistlosen Abschrift zu befragen,
wäre in der Beschäftigung mit Kopien auf jeden Fall als dankbare Aufgabe mitzu-
stellen. — Zu der Beschreibung der Bildwerke hat Lippold mit seinem Katalog
noch eine Arbeit geleistet, für die wir ihm dankbar sind. In den Literaturnachweisen
zu den einzelnen Nummern, die oft mehr als fünfzig Namen umfassen, ist ein Stück
Geschichte der Kunstwissenschaften enthalten, das ebenso einmal der Darstellung
bedürfte wie eine kulturgeschichtliche Untersuchung über die Entwicklung des
Museumskatalogs seit seinen Anfängen in der Renaissance bis auf unsere Tage.
Auf dem Weg, der mit den Statuenbeschreibungen des sechzehnten Jahrhunderts
beschritten worden ist, ist der Vatikankatalog ein Markstein geworden. Seit dreißig
Jahren ist er für eine Reihe großer Katalogpublikationen von Sammlungen in Rom,
Berlin und Petersburg vorbildlich geworden. Diese Wirkung dürfte das System des
Antikenkatalogs rechtfertigen. Wir möchten wünschen, daß der vorgelegte Band jene
werbende Kraft der beiden älteren verstärkte und andere Sammlungen sich zur
Nachfolge entschlössen.
Berlin. Heinz Kahler.
Gesellschaft für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft
Verhandlungsbericht über die Mitgliederversammlung
Dienstag, den 2. Februar 1937
Die Sitzung konnte wegen Erkrankung und Verhinderung leitender Mitglieder
der Gesellschaft nicht — wie ursprünglich vorgesehen — im November vergangenen
207
Jahrhunderts gelten zu können. Und ebenso wäre eine Abschweifung, wie sie sich
Lippold anläßlich einer interessanten Verschlußplatte eines Grabes (?) mit der Dar-
stellung von drei Musen und ihren Dichtern erlaubt, besser unterblieben. Wenn hier
mit dem bartlosen Dichter neben der Komödie ,offenbar' Menander gemeint ist, so
ist die Verbindung dieses Figürchens mit der von den Söhnen des Praxiteles einst-
mals gearbeiteten Statue, über deren Aussehen wir nichts wissen, um so zweifel-
hafter, als es selbst, wenn diese hinter dem Relief stünde, nichts aussagte. Die
Struktur der Figur, ihr Aufbau, die knickende Bewegtheit, der Stil ist vor der
zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr. undenkbar. Bestünde ein Vorbild,
so wäre von ihm in dieses Figürchen nichts übernommen als die Bartlosigkeit, und
das dürfte unseres Erachtens doch zu wenig sein, um den Namen der Praxiteles-
söhne zu nennen. Wenn auch die reichen Funde an originalen griechischen Bild-
werken und die wachsende Fähigkeit, aus Fragmenten und Werken der Kleinkunst
die Struktur und die Entwicklung der klassischen Kunst ahnend zu erfassen, das
Interesse an den Kopien haben zurücktreten lassen, so sind doch auch sie, wenn
man nicht auf eine Künstlergeschichte von vornherein verzichten will, unersetzlich.
Zahlreiche Meister — vor allem die großen des Broncegusses — wären uns ohne
die römischen Kopien verloren. So bleibt die Arbeit, die Lippold hier in seinem
Katalog mit seiner großen Kenntnis und vorsichtigen Kritik leistet, ebenso notwendig
für die griechische Künstlergeschichte wie in vergangenen Zeiten. Allerdings hat die
betonte Ausrichtung auf diese dem Text insofern Abbruch getan, als wir, abgesehen
von einigen sehr präzisen Vorschlägen wie etwa für das Platonbildnis, bei den
meisten Stücken Angaben über die Entstehungszeit der Kopien — das zweite Datum
der vom Verfasser besprochenen Bildwerke — vermissen. Die Kopien nach griechi-
schen Kunstwerken nicht nur auf ihre Vorbilder, sondern auch auf ihre Aussage
über den sich wandelnden Geschmack und Stil und das Verhältnis zum Vorbild
als Ausdruck einer erlebten Wiedergeburt oder geistlosen Abschrift zu befragen,
wäre in der Beschäftigung mit Kopien auf jeden Fall als dankbare Aufgabe mitzu-
stellen. — Zu der Beschreibung der Bildwerke hat Lippold mit seinem Katalog
noch eine Arbeit geleistet, für die wir ihm dankbar sind. In den Literaturnachweisen
zu den einzelnen Nummern, die oft mehr als fünfzig Namen umfassen, ist ein Stück
Geschichte der Kunstwissenschaften enthalten, das ebenso einmal der Darstellung
bedürfte wie eine kulturgeschichtliche Untersuchung über die Entwicklung des
Museumskatalogs seit seinen Anfängen in der Renaissance bis auf unsere Tage.
Auf dem Weg, der mit den Statuenbeschreibungen des sechzehnten Jahrhunderts
beschritten worden ist, ist der Vatikankatalog ein Markstein geworden. Seit dreißig
Jahren ist er für eine Reihe großer Katalogpublikationen von Sammlungen in Rom,
Berlin und Petersburg vorbildlich geworden. Diese Wirkung dürfte das System des
Antikenkatalogs rechtfertigen. Wir möchten wünschen, daß der vorgelegte Band jene
werbende Kraft der beiden älteren verstärkte und andere Sammlungen sich zur
Nachfolge entschlössen.
Berlin. Heinz Kahler.
Gesellschaft für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft
Verhandlungsbericht über die Mitgliederversammlung
Dienstag, den 2. Februar 1937
Die Sitzung konnte wegen Erkrankung und Verhinderung leitender Mitglieder
der Gesellschaft nicht — wie ursprünglich vorgesehen — im November vergangenen