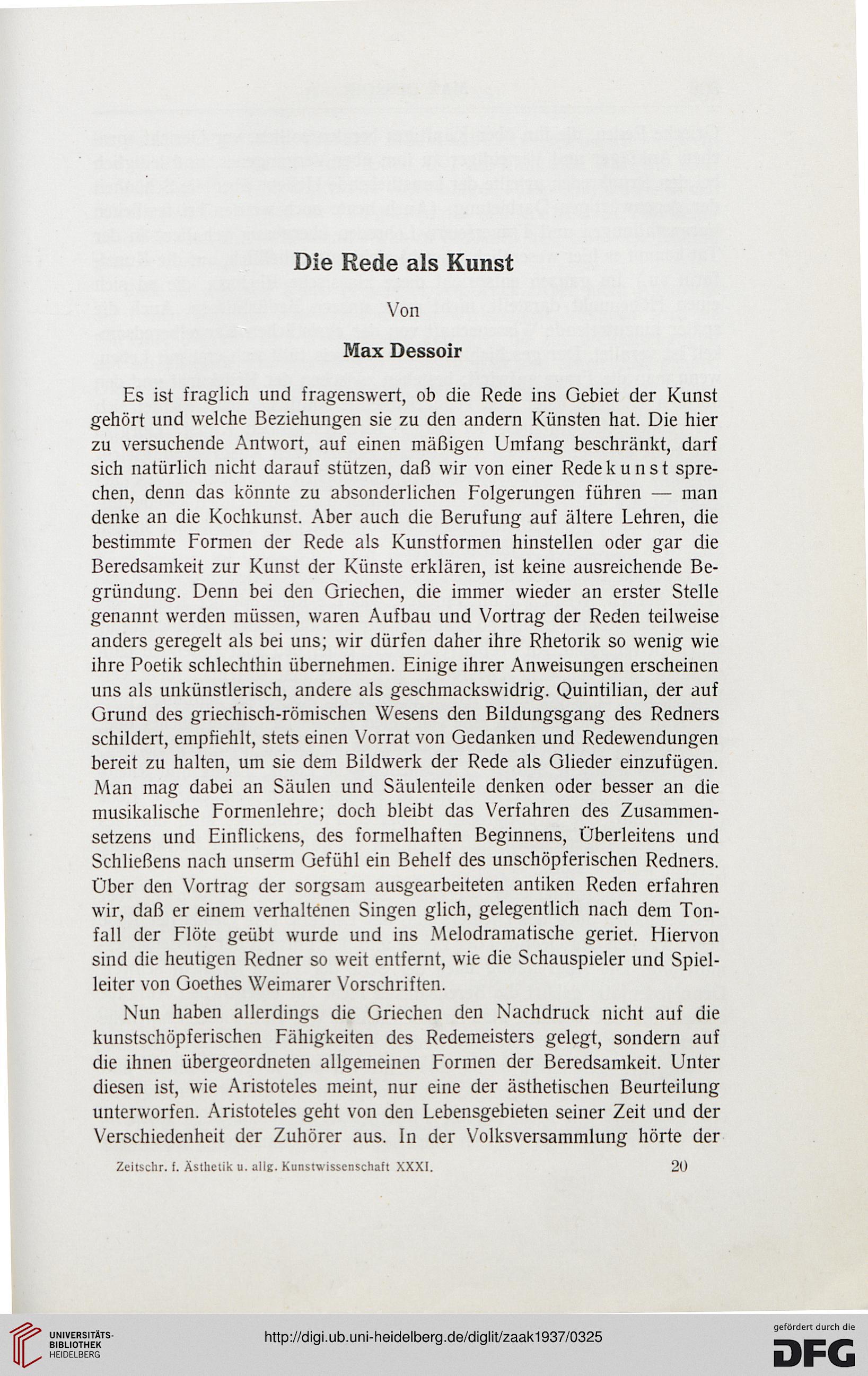Die Rede als Kunst
Von
Max Dessoir
Es ist fraglich und fragenswert, ob die Rede ins Gebiet der Kunst
gehört und welche Beziehungen sie zu den andern Künsten hat. Die hier
zu versuchende Antwort, auf einen mäßigen Umfang beschränkt, darf
sich natürlich nicht darauf stützen, daß wir von einer Redekunst spre-
chen, denn das könnte zu absonderlichen Folgerungen führen — man
denke an die Kochkunst. Aber auch die Berufung auf ältere Lehren, die
bestimmte Formen der Rede als Kunstformen hinstellen oder gar die
Beredsamkeit zur Kunst der Künste erklären, ist keine ausreichende Be-
gründung. Denn bei den Griechen, die immer wieder an erster Stelle
genannt werden müssen, waren Aufbau und Vortrag der Reden teilweise
anders geregelt als bei uns; wir dürfen daher ihre Rhetorik so wenig wie
ihre Poetik schlechthin übernehmen. Einige ihrer Anweisungen erscheinen
uns als unkünstlerisch, andere als geschmackswidrig. Quintilian, der auf
Grund des griechisch-römischen Wesens den Bildungsgang des Redners
schildert, empfiehlt, stets einen Vorrat von Gedanken und Redewendungen
bereit zu halten, um sie dem Bildwerk der Rede als Glieder einzufügen.
Man mag dabei an Säulen und Säulenteile denken oder besser an die
musikalische Formenlehre; doch bleibt das Verfahren des Zusammen-
setzens und Einflickens, des formelhaften Beginnens, Überleitens und
Schließens nach unserm Gefühl ein Behelf des unschöpferischen Redners.
Über den Vortrag der sorgsam ausgearbeiteten antiken Reden erfahren
wir, daß er einem verhaltenen Singen glich, gelegentlich nach dem Ton-
fall der Flöte geübt wurde und ins Melodramatische geriet. Hiervon
sind die heutigen Redner so weit entfernt, wie die Schauspieler und Spiel-
leiter von Goethes Weimarer Vorschriften.
Nun haben allerdings die Griechen den Nachdruck nicht auf die
kunstschöpferischen Fähigkeiten des Redemeisters gelegt, sondern auf
die ihnen übergeordneten allgemeinen Formen der Beredsamkeit. Unter
diesen ist, wie Aristoteles meint, nur eine der ästhetischen Beurteilung
unterworfen. Aristoteles geht von den Lebensgebieten seiner Zeit und der
Verschiedenheit der Zuhörer aus. In der Volksversammlung hörte der
Zeitschr. f. Ästhelik u. allg. Kunstwissenschaft XXXI. 20
Von
Max Dessoir
Es ist fraglich und fragenswert, ob die Rede ins Gebiet der Kunst
gehört und welche Beziehungen sie zu den andern Künsten hat. Die hier
zu versuchende Antwort, auf einen mäßigen Umfang beschränkt, darf
sich natürlich nicht darauf stützen, daß wir von einer Redekunst spre-
chen, denn das könnte zu absonderlichen Folgerungen führen — man
denke an die Kochkunst. Aber auch die Berufung auf ältere Lehren, die
bestimmte Formen der Rede als Kunstformen hinstellen oder gar die
Beredsamkeit zur Kunst der Künste erklären, ist keine ausreichende Be-
gründung. Denn bei den Griechen, die immer wieder an erster Stelle
genannt werden müssen, waren Aufbau und Vortrag der Reden teilweise
anders geregelt als bei uns; wir dürfen daher ihre Rhetorik so wenig wie
ihre Poetik schlechthin übernehmen. Einige ihrer Anweisungen erscheinen
uns als unkünstlerisch, andere als geschmackswidrig. Quintilian, der auf
Grund des griechisch-römischen Wesens den Bildungsgang des Redners
schildert, empfiehlt, stets einen Vorrat von Gedanken und Redewendungen
bereit zu halten, um sie dem Bildwerk der Rede als Glieder einzufügen.
Man mag dabei an Säulen und Säulenteile denken oder besser an die
musikalische Formenlehre; doch bleibt das Verfahren des Zusammen-
setzens und Einflickens, des formelhaften Beginnens, Überleitens und
Schließens nach unserm Gefühl ein Behelf des unschöpferischen Redners.
Über den Vortrag der sorgsam ausgearbeiteten antiken Reden erfahren
wir, daß er einem verhaltenen Singen glich, gelegentlich nach dem Ton-
fall der Flöte geübt wurde und ins Melodramatische geriet. Hiervon
sind die heutigen Redner so weit entfernt, wie die Schauspieler und Spiel-
leiter von Goethes Weimarer Vorschriften.
Nun haben allerdings die Griechen den Nachdruck nicht auf die
kunstschöpferischen Fähigkeiten des Redemeisters gelegt, sondern auf
die ihnen übergeordneten allgemeinen Formen der Beredsamkeit. Unter
diesen ist, wie Aristoteles meint, nur eine der ästhetischen Beurteilung
unterworfen. Aristoteles geht von den Lebensgebieten seiner Zeit und der
Verschiedenheit der Zuhörer aus. In der Volksversammlung hörte der
Zeitschr. f. Ästhelik u. allg. Kunstwissenschaft XXXI. 20